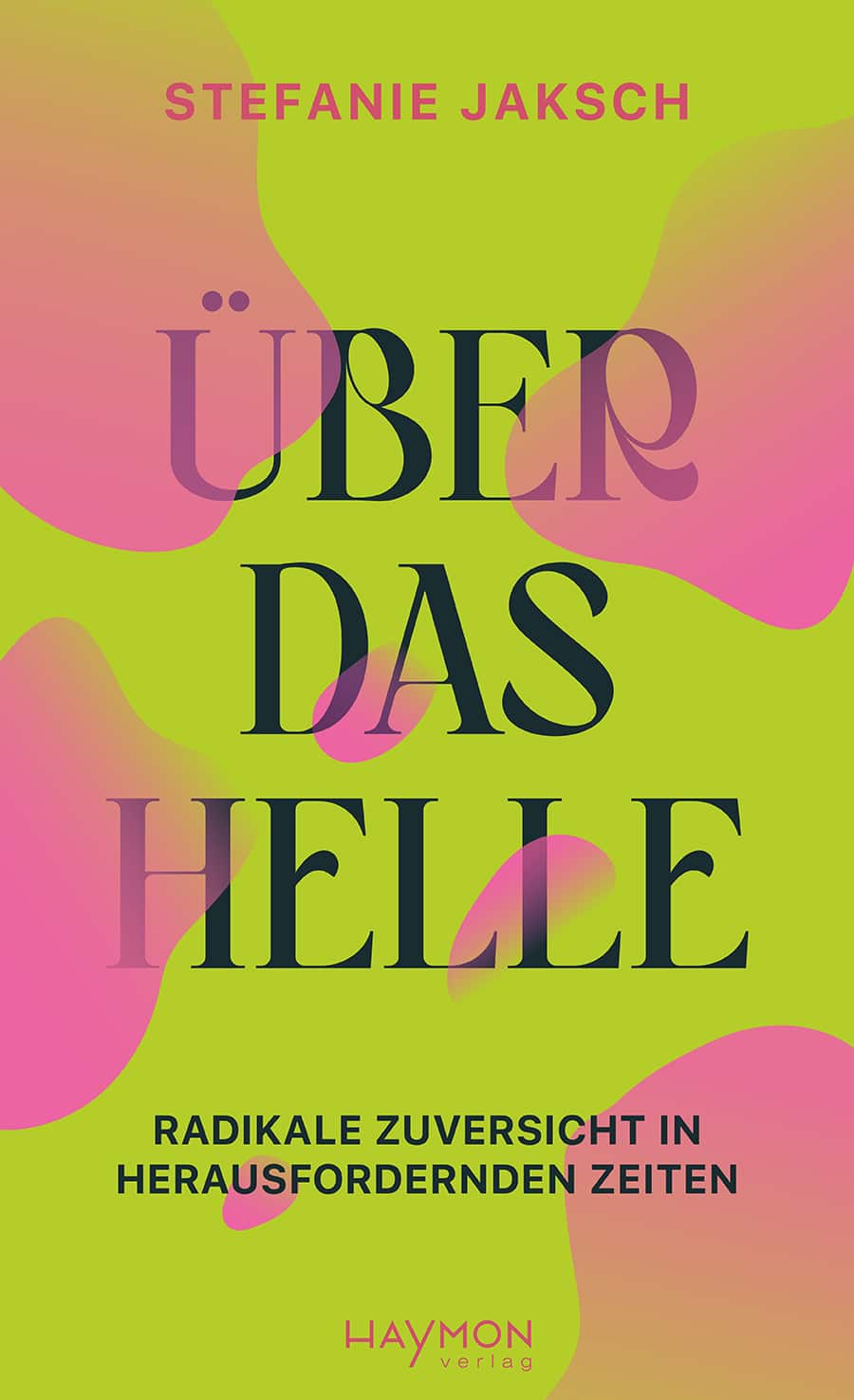Ein Essay, der die Dämmerung unserer Zeit durchbricht: Leseprobe aus „Über das Helle“ von Stefanie Jaksch
Krisen, Kriege, Klimawandel – sie haben die Welt fest im Griff, das wird uns Tag für Tag vor Augen gehalten. Beim Scrollen durch Social-Media-Feeds, in den Abendnachrichten, im Podcast, der uns eigentlich Zerstreuung versprach. Wenn wir ehrlich sind, faszinieren und beschäftigen uns Katastrophenmeldungen mehr als die guten Neuigkeiten – so funktioniert die Aufmerksamkeitsökonomie. Und wir haben uns in gewisser Weise an das apokalyptische Dauerfeuer und die alltäglichen Untergangsfantasien gewöhnt. So sehr, dass wir auf das Helle in unserem Leben vergessen. Tatsächlich ist unsere Gegenwart nicht dazu angetan, uns Mut zu machen und den Optimismus nicht zu verlieren. Doch die Autorin Stefanie Jaksch begibt sich auf die Suche: nach dem Licht in dunklen Zeiten.
Mit dieser Leseprobe bekommst du einen Einblick in Stefanie Jakschs „Über das Helle“, ein Buch, das uns Hoffnung gibt und den Widerstand in uns erweckt.
Notizen aus dem Dunkeln
Out of the dark
And into the light
I give up and you
Waste your tears
To the night
Falco
Nur ein bisschen noch. Fünf Minuten. Drei Minuten. Eine vielleicht? Vorbei, seufze ich in die Kissen und kneife meine Augenlider noch einmal trotzig wie ein Kind zusammen, bevor ich aufgebe. Ich starre in die Nacht, in den lichtlosen Raum über mir, nichts ist zu hören außer dem leisen Luftholen und unrhythmischen Schnarchen des Wolfs, mit dem ich seit einigen Jahren zusammenlebe. In unserem Schlafzimmer gibt es keine Uhr, aber mein Körper braucht auch keine, um zu wissen, dass es eigentlich zu früh ist, um aufzustehen. Was ich ebenfalls weiß: Dass ich, einmal wach, nicht mehr in den Schlaf finden werde, dass mein Gehirn nun anspringt, dass es mich geweckt hat, weil seit gestern Abend zu viele unterschiedliche Baustellen in mir arbeiten. Weil ich wieder einmal nicht dafür gesorgt habe, vor dem zu Bett gehen ein bisschen Ruhe einzuplanen, zu lange noch erst auf meinen Laptop gestarrt habe, dann doch noch schnell einen Blick aufs Smartphone gewagt habe – und natürlich prompt hängengeblieben bin an einigen Desaster-News, die sich etwas unscharf in meine Träume geschlichen haben. Schemenhaft erinnere ich mich daran, dass ich durch eine wirre Abfolge von Actionszenen gejagt wurde und ich dabei penibel darauf achten musste, eine neon-orange Aktentasche nicht zu verlieren und mir das sogar gelang, nur um am Ende auf den billigsten Taschenspielertrick hereinzufallen, mich kurz von einer Frage ablenken ließ und mir das kostbare Gut entwendet wurde, als ich mich zu der Person umdrehte, die die Frage an mich gerichtet hatte. Der Stich in der Magengrube, als mir mein Fehler bewusst wurde, und der leere Fleck, an dem die Tasche gestanden hatte, den ich nun anstarrte, sind mir im Aufwachen realer als der Rest der Welt, der nur unscharf und in Graustufen an mich heranschwappt. Keinen Schlaf finden zu können, verdunkelt alles, besonders aber das Gemüt und ist, hält der Zustand länger als ein paar Tage an, mit einer eigenartigen Versagensangst verbunden. Warum ich? Warum fällt mir das vermeintlich Einfachste zurzeit nicht leichter? Wut gesellt sich dazu, Ungerechtigkeit, eine der dunkelsten Empfindungen, auch und vor allem dem Wolf an meiner Seite gegenüber. Was erlaubt er sich eigentlich, so ohne Probleme in den Schlaf zu finden, einen eigenen Rhythmus zu haben, der ihm erlaubt, sich hinzulegen und sofort in tiefen Schlummer zu finden? Als wäre Schlaf ein Hochleistungssport.
Die längste Zeit, die ein Mensch offiziell dokumentiert ohne Schlaf verbracht hat, beträgt 264 Stunden, das sind elf Tage, und bis heute hält diesen zweifelhaften Rekord aus dem Jahr 1964 der damals 17-jährige Randy Gardner aus San Diego, USA. Aus einem Grund, der sich mir nicht erschließt, zumindest nicht in meinem leicht angeschlagenen Zustand, hat ein Brite aus Penzance im Jahr 2007 einen weiteren Weltrekordversuch gestartet, den er per Video dokumentierte. Er überbot Gardners Leistung um zwei Stunden, darf sich aber bis heute nicht über die Nennung als Rekordhalter freuen, da die Kategorie „Längste Zeit ohne Schlaf“ schon längst nicht mehr existierte im Guinness Buch der Rekorde: „aus gesundheitlichen Bedenken“.1 Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen: In Laborversuchen, bei denen man Mäuse wachhielt und weckte, sobald sie einschliefen, starben die Versuchstiere nach durchschnittlich sieben Tagen. Grund dafür: vermutlich multiples Organversagen.2
Wie ich da so liege, frage ich mich, wie lange ich es wohl aushalten könnte ohne Schlaf, vermutlich keine 48 Stunden, und mir läuft bei dem Gedanken ein Schauer über den Rücken. Ich kenne mich, innerhalb weniger Tage ohne meine normale Dosis Schlaf von sieben bis acht Stunden werde ich zu einem kränklichen, weinerlichen Etwas, bin unkonzentriert, breche schnell in Tränen aus und glaube, dass die Welt dem Untergang nahe ist. Ich finde mich selbst lächerlich, wie ich mir das so überlege, im Warmen, in der Sicherheit meiner Wohnung, in einem insgesamt recht aufgeräumten Leben. Ja, ich habe eine Phase des beruflichen Komplettumbruchs hinter mir, habe mir manche Sicherheiten selbst unter den Füßen weggezogen in einem Mix aus Vertrauen und Wagemut, und sicher, die letzten Jahre mit Pandemie, näher rückenden Kriegen und sich immer mehr radikalisierender Weltpolitik sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen, wie auch, wenn erstmals Menschen rund um den Globus gleichzeitig in eine grundlegende Verunsicherung geworfen waren, die man nicht mehr von sich weghalten konnte, sich eben nicht mehr sicher fühlen konnte, sich nicht mehr zurückziehen konnte auf ein „Ach, zu uns kommt das schon nicht“. Es ist alles zu uns gekommen: das Virus, die Krankheit, die Angst, die Einsamkeit, die Verletzlichkeit, der Tod. Und auch die Erkenntnis: Wir Menschen sind nur bedingt solidarisch, ich erinnere an die allwöchentlichen Demonstrationen der „Querdenker:innen“, eine Petrischale für das Anmischen einer reaktionären, von Wut und Hass getriebenen Soße, in der es sich besorgte Bürger:innen nicht nehmen ließen, mit Rechtsradikalen zu marschieren. Ich erinnere mich an meinen Unglauben, an meinen mir ebenfalls gerecht vorkommenden Zorn auf Menschen, die ich nicht mehr verstand und die mich wohl umgekehrt auch nicht verstanden. Und auch der Krieg steht wieder vor unseren Toren. Ich lebe in Wien, das sind gerade einmal 1.000 Kilometer entfernt von Kiew, für jeden Sommerurlaub nehmen wir gern größere Entfernungen in Kauf, und während ich also hier liege und nachdenke, kämpfen Menschen in der Ukraine um ihr Leben. In vielen Teilen der Welt leiden Menschen Hunger, werden ihre Grundrechte mit Füßen getreten, müssen Frauen, queere Personen, Personen mit anderer Hautfarbe oder anderem Glauben sowie viele andere marginalisierte Gruppen um ihre Unversehrtheit fürchten, sitzen Journalist:innen und unliebsame Regimegegner:innen für kritische Berichterstattung in Isolationshaft oder werden dort „weißer Folter“ unterzogen, der Schlafdeprivation, rund um die Uhr dem Licht ausgesetzt.
Ich setze mich auf und bin wütend, auf mich, weil ich mir wieder selbst auf den Leim gegangen bin. Weil ich mein Gedankenkarussell nicht rechtzeitig gestoppt habe, und noch viel mehr, weil ich klein beigegeben habe und mich in die Negativspirale, die wir alle kennen, hineingedreht habe. Ich bin wütend, weil es so viel schwerer scheint, so viel mehr Energie braucht, sich dem Hellen zuzuwenden, als sich von Negativität fressen zu lassen. Es reicht, und ich steige vorsichtig aus dem Bett, der Wolf grummelt undeutlich, bevor er sich umdreht und weiterschläft, während ich auf Zehenspitzen ins Arbeitszimmer schleiche, die dunklen Gedanken abzuschütteln versuche und mich auf das Jetzt zu besinnen.
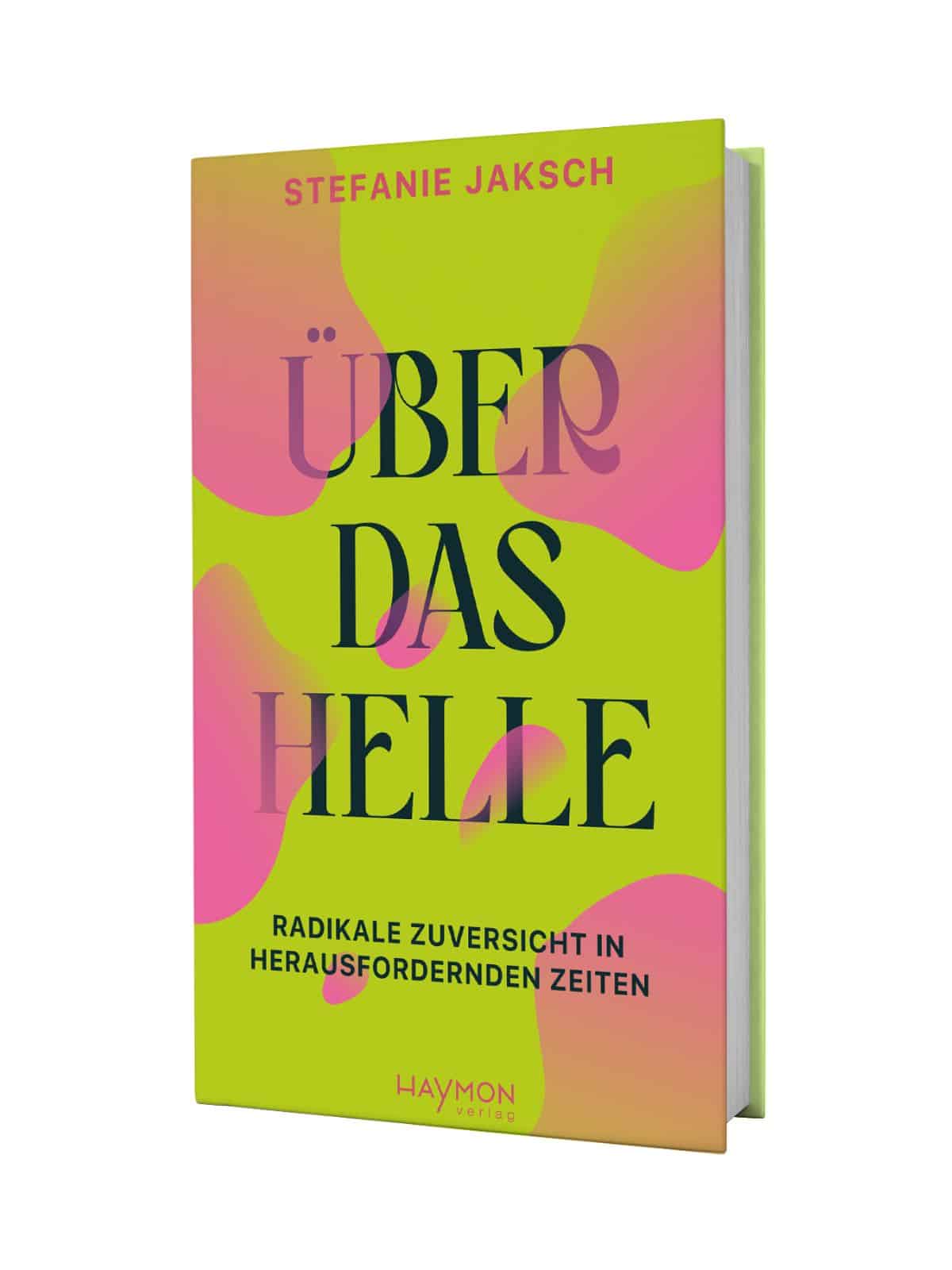
Seit ich denken kann, bin ich eine Frühaufsteherin. Meine produktivste Zeit des Tages ist sein Anbruch, wenn (fast) alles noch schläft, vor dem Fenster sich noch keine Autolawinen durch die Stadt wälzen, wenn die meisten Wohnungen noch nicht von Lichterschein erhellt sind, wenn die Nacht noch ihre letzten Ausläufer verteidigt. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, im Dunkeln zu sitzen und einfach nur zu schauen, dabei den einen oder anderen Gedanken kommen und gehen zu lassen: Gedanken zum sich anbahnenden Tag, Gedanken zu alten und neuen unbeantworteten Fragen, Gedanken, die mich manchmal schrecken und manchmal ermutigen. Für die erste vorsichtige Phase der Wachheit schalte ich keine Lampe ein, lasse mich von der Dunkelheit umhüllen und empfinde das als erstaunlich tröstlich, imaginiere sie mir als eine Decke, die mich wärmt mit vorläufiger Gleichgültigkeit gegenüber allen Bemühungen, die wir mit einem erfolgreichen Tag verbinden. Die Abwesenheit von Licht signalisiert mir in diesen Stunden: Du musst nichts, nimm dir noch Zeit, bleib noch ein Weilchen, die meisten sind noch nicht wach, das Zeichen, das Tagwerk zu beginnen, ist noch nicht gekommen (oder ich habe es übersehen).
Dieser paradiesische Zustand ändert sich schlagartig, sobald sich – je nach Jahreszeit früher oder später – der erste Silberstreif am Horizont erblicken lässt. Nichts verheißt uns Geschäftigkeit oder ist uns so sehr Gebot, endlich mit dem Tun zu beginnen, den Müßiggang sausen zu lassen, wie der Anfang eines neuen Tages. Carpe diem!, schallt es uns, die wir unsere eigenen gelernten Motivationstrainer:innen sind, immer wieder entgegen, sitze nicht auf der faulen Haut, mach etwas aus dem Tag, aus dem Monat, dem Jahr, deinem Leben! Daran lässt sich grundsätzlich nichts ändern, Lebewesen sind so gepolt, Pflanzen recken sich gottergeben dem Licht entgegen. In Ländern, die dem Polarkreis näherliegen, tut man sich im Sommer mitunter schwer, Schlaf zu finden, wenn die Sonne nicht untergeht, und es muss zu fast gewaltsamen Verdunkelungsmethoden gegriffen werden. Am Ende einer durchtanzten Nacht unter Stroboskoplicht erntet meist eine überrascht hochgezogene Augenbraue, wer sich verabschiedet, bevor die Party zu Ende ist und die letzten Scheinwerfer im Club gelöscht sind. Solange Licht ist, gehen wir nicht heim!
„Mehr Licht!“, so will es die Legende, war Goethes letzte Forderung auf dem Sterbebett, und auch wenn ich bezweifle, dass es ausgerechnet diese zwei Worte waren, die dem Dichtergenie entfuhren, bevor er sein Lebenslicht aushauchte, so verstehe ich doch den Zweck ihrer mythischen Überhöhung: Auch wenn wir noch so viel geschafft haben, auch wenn wir noch so erfolgreich sind, es gibt wohl keinen Menschen, der trotz aller Mühsal die Möglichkeit, einen weiteren Tag zu erleben, ausschlagen würde. Mehr Licht, mehr Möglichkeiten, mehr Beweise für die eigene Existenz und ihre Gewichtigkeit, ihre Relevanz, ihre Wirkmächtigkeit. Denn die im Dunkeln sieht man nicht; gesehen werden wollen wir aber alle.
Zugegeben, das klingt ein wenig, als sei ich auf der dunklen Seite der Macht zuhause oder zumindest deren Sympathisantin, als verstünde ich einen Text über das Helle als ein Vehikel, um eine Lanze für das Dunkle zu brechen. Mitnichten. Dass ich mich im lichtlosen Raum ab und an sehr wohl fühle, heißt nicht, dass ich dies generell vorzöge oder frei von Geltungsdrang wäre, der das Ausleuchten der eigenen, sonst verborgen bleibenden Winkel zulässt; wir alle streben letztendlich dem Hellen entgegen, und ich möchte glauben, das ist gut so.
1 Vgl. https://www.derstandard.at/story/2000082079528/wie-lange-ueberlebt-ein-mensch-ohne-schlaf
2 https://www.spektrum.de/frage/wie-lange-kann-man-wach-bleiben/1321562