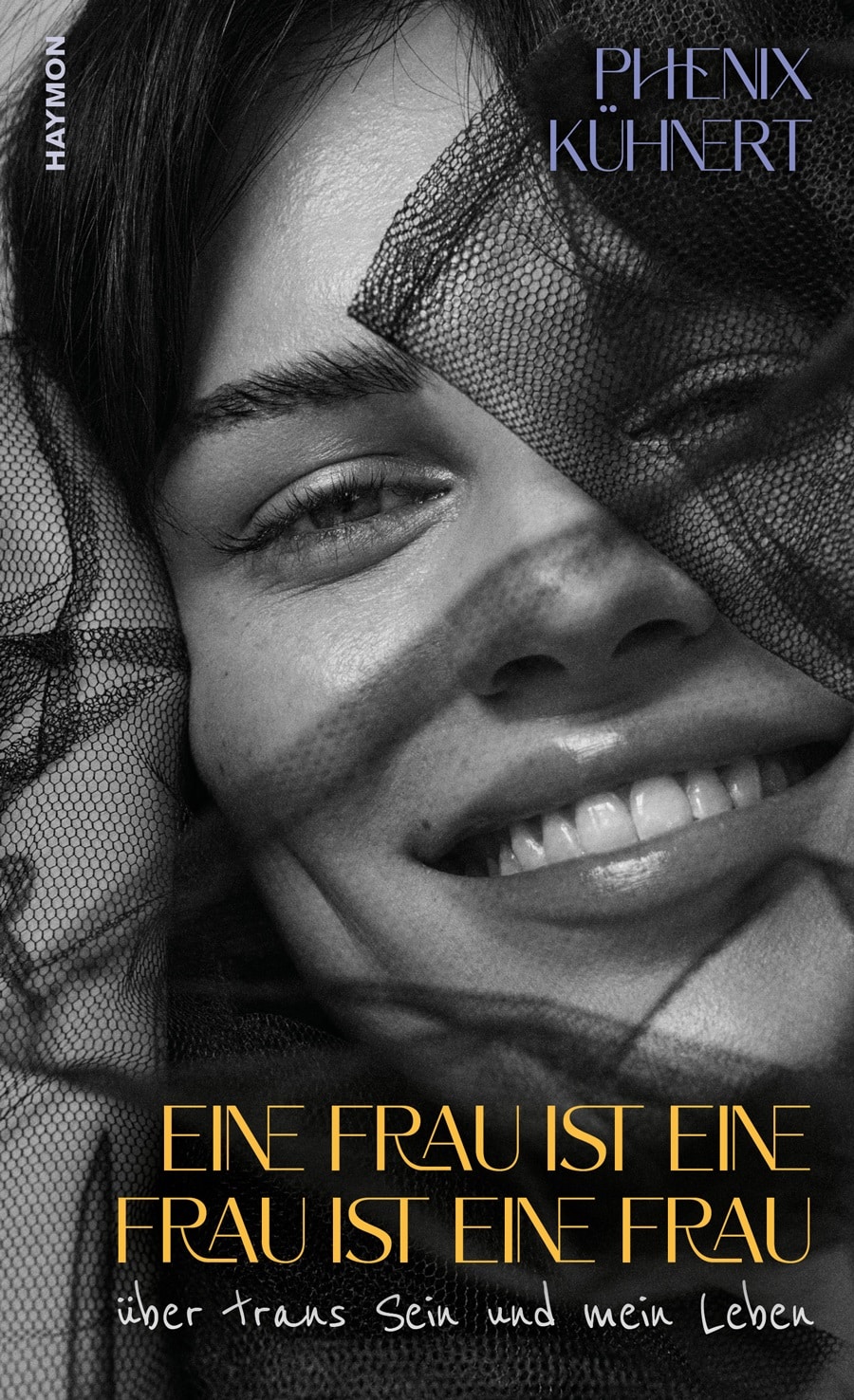Eine literarische Auflehnung gegen die vorherrschende Klassenpolitik: Leseprobe aus „Von der namenlosen Menge“ von Olivier David
Geschichten von der unteren Klasse, Literatur über soziale Herkunft – meist sind das Erzählungen von Aufbruch und Aufstieg. Olivier Davids Essays kreisen um diejenigen, die unten geblieben sind. Die mit den schmerzenden Körpern, die Nachtarbeitenden, die Vergessenen – und um ihn selbst. Wie fühlt es sich an, mit dem eigenen Körper und der eigenen Gesundheit den Wohlstand höherer Klassen zu bezahlen? Wie selbstbestimmt kann die Entscheidung, allein zu bleiben, sein, wenn soziale Beziehungen durch Vereinzelung, Geldmangel und eingeschränkte Teilhabe unter Druck stehen? Wie soll Geschichte weitergegeben werden, wenn es kein kollektives Gedächtnis armer Menschen gibt? Mit dieser Leseprobe bekommst du einen Einblick in Olivier Davids „Von der namenlosen Menge“, das unsere Gesellschaft in ein anderes, oft ausgeblendetes Licht rückt.
Innere Migration
In ihrer sozialen Identität, in ihrem Selbstbild zutiefst infrage gestellt durch ein Schulsystem und eine Gesellschaft, von diesen mit leeren Worten abgespeist, bleibt ihnen zur Wiederherstellung ihrer persönlichen und sozialen Integrität kein anderer Ausweg, als jenen Verdikten ihre globale Verweigerung entgegenzusetzen.
Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede
Ein später Nachmittag am letzten Tag des alten Jahrtausends. Um dem Gefühl des Alleinseins zu entfliehen, schnüre ich meine Schuhe, ich rufe meiner Mutter ein paar Worte zu und verlasse die Wohnung. Raus aus dem Haus, vorbei an dem Fenster meines ghanaischen Nachbarn, aus dem Gelächter und Musik dringen, durch das Tor, das verschlossen aussieht, aber nur angelehnt ist und das eines Tages eingebaut wurde, um zu verhindern, dass Drogensüchtige ihre Spritzen in unserer Sandkiste liegen lassen. Meine Stimmung passt zu diesem nasskalten Dezembertag, sie passt zum taubengrauen Himmel, sie passt nicht zum Tag der Tage, für den ich zu wenig enge Freunde habe, zu pleite und zu hobbylos bin. Ich bin elf Jahre alt, ich bin draußen auf der Straße unterwegs, streife durch die Stadt, mit einer Handvoll Böller. Auch, wenn wir für richtige Partys eigentlich zu jung sind, meine Mitschüler und ich, weiß ich, dass manche von ihnen mit ihren Familien ins neue Jahrtausend hineinfeiern und andere die Jahrtausendwende bei ihren Freunden verbringen.
Die Dämmerung bricht langsam herein, als ich beschließe, mich auf den Rückweg zu machen. Vorbei an den sechs oder acht Stufen, die an die Außenmauer des Karstadtgebäudes angrenzen, vorbei an der Post nahe der großen Bergstraße. Am Schaufenster des Klamottenladens Hundertmark bleibt mein Blick an der dunkelbraunen Lederjacke für 699 Mark kleben. Kurz hellt sich meine Stimmung auf, als ich mir vorstelle, diese schwere, edle Lederjacke eines Tages zu besitzen. Nach ein paar Sekunden reiße ich mich los. Es gibt die Welt hinter der Auslage, und es gibt meine Welt, und dazwischen gibt es die Sicherheitsscheibe, die unüberwindbar zwischen meinen Tagträumen und der Realität steht. Das hinter der Scheibe, das bin nicht ich, das werde ich nie sein.
Die Kälte zieht mich wie an einer Schnur zurück nach Hause. Allein Böller auf die Straße zu werfen, so wie ich es bis vor wenigen Minuten gemacht habe, erzeugt keine Freude in mir, es ist eher etwas, das ich pflichtbewusst erledige, weil alle Jungs in meinem Umfeld vernarrt darin sind, etwas in die Luft zu jagen. Die letzten zwei D-Böller stecke ich zurück in die Tasche. Am Ende der großen Bergstraße explodiert plötzlich etwas unmittelbar vor meinen Füßen. Die Detonation ist heftig, sie reißt mich aus meiner Lethargie. Ich sehe ein paar übermütige Jugendliche, die sich mit Böllern beschmeißen, und hoffe, dass sie nicht auf mich zielen. Der Schock, den die Explosion in mir auslöst, wird verstärkt durch die empfundene Isolation von der Welt, die mich schon umgeben hat, lange bevor ich das Haus verlassen habe. Eine Isolation, die genau genommen ein Teil von mir ist. Eine Isolation, die gleichzeitig auch ein Trugschluss ist, denn ich bin nicht allein, meine Mutter wartet zu Hause, auch ihr geht es nicht gut, auch sie ist allein. Genau genommen ist es kein isoliertes Alleinsein, wir sind jeder für sich nebeneinander allein. Es ist das Alleinsein des versprengten Rests einer Familie aus der unteren Klasse.
Vor einiger Zeit habe ich online einer Podiumsdiskussion über soziale Herkunft und Klassenwechsel zugesehen, und in den Wochen und Monaten danach ploppte der Titel der Veranstaltung immer wieder in meinem Inneren auf: Die Klasse, die es nicht gibt. Die Formulierung zeigte mir eine Realität auf, die sich meinem Bewusstsein bisher entzogen hatte, obgleich ich ihre Wahrheit körperlich spürte. Schon seit meiner Kindheit existieren für mich parallel zwei Realitäten, die sich zu widersprechen scheinen.
Die eine besagt, dass es nur mich gibt, nur ich allein kann mir meiner selbst sicher sein. Klar, da sind noch meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, aber es ist wichtig, dass ich mich auf niemanden verlasse. Keine Freunde werden bleiben, keine Frau. Es ist eine Art innerer Kern, der nicht durch das Vertrauen in andere Menschen kontaminiert werden darf, denn im Außen wartet der Verrat. Hoffnung nur dann, wenn ich bereit bin, die der Hoffnung auf dem Fuß folgende Enttäuschung zu akzeptieren, die zum Gefühl, verlassen zu werden, dazugehört. Gefühle dieser Art haben mit dem Pathos nichts gemein, das der unteren
Klasse zugeschrieben wird. Teile der Gesellschaft haben es sich angewöhnt, mit unversöhnlichem Blick auf die Empfindungen der Menschen aus der Unterklasse zu schauen. Den Problemanalysen und Schlüssen der Menschen von unten wird misstraut. Der Entzug der Deutungshoheit über die eigene Situation funktioniert als nachgelagertes Herrschaftsinstrument, als Enteignung nach der Enteignung. Erst nimmt die herrschende Klasse einem die Mittel zu einem würdevollen Leben, dann diskreditiert die kulturelle Fraktion derselben Klasse die Intensität der Gefühle, die ob des Verlustes aufsteigen.
Diese Gefühle, über die ich hier zu sprechen versuche, sind Teil eines verkörperten Wissens. In ihnen liegt keine Trauer und auch keine Überhöhung, dafür ist ihnen eine Desillusionierung eigen. Mir kommt kein Gefühl in den Sinn, das gleichzeitig ehrlicher und ernüchternder zugleich ist als jenes, das beim Vorgang spürbar wird, sich der Realität zu stellen, in der es für die meisten so wenig zu gewinnen gibt. Dieselbe Wahrheit besagt, dass ich alleine von dieser Erde gehen werde. Eine Wahrheit, in der geschrieben steht, dass ich in Einsamkeit und Armut sterben muss, zu früh sterben muss, weil diese Phänomene einer Gesetzmäßigkeit folgen.
Die zweite Realität meiner Kindheit ist die eines Miteinanders, das sich durch Mitgefühl zeigte. Zu Hause waren die Herzen so offen, wie sie nur sein konnten, wenn einem die Ungerechtigkeiten (und manchmal auch das erlernte Wissen, es nicht besser verdient zu haben) in den Lebenslauf eingeschrieben worden sind. Neben dem Mitgefühl war da Platz für Diskussionen am Küchentisch, da gab es die Freude meiner Mutter, wenn anderen kleinen Leuten ein bisschen Gerechtigkeit widerfuhr. Da wurde der Glaube verteidigt, dass ihre Kinder den eigenen Weg finden würden. Trotz allem – oder gerade deswegen.
Wie gehen diese beiden Wissensstände zusammen? Wie kann die eine Wahrheit stimmen – die Wahrheit um das Wissen einer kollektiven Betroffenheit und eine damit verbundene Empathie für viele, deren Leben den Gesetzen dieser selektierenden Welt unterworfen sind – , während das Wissen darüber, dass das Leben in der Unterklasse vereinzelt, sich jeden Tag mit kalter Präzision in mein Bewusstsein eingeschrieben hat?
Für mich beschreibt der Begriff der inneren Migration am treffendsten den Mechanismus der Vereinzelung, der nicht nur, aber insbesondere ein Phänomen der unteren Klasse ist. In Deutschland wird vor allem im Kontext des Nationalsozialismus von innerer Migration gesprochen. Der Begriff beschreibt in diesem Zusammenhang eine innere Haltung, die einige Schriftsteller und Künstler nach der Machtergreifung der Nazis 1933 bis zum Kriegsende 1945 für sich beanspruchten. Aus Furcht vor Berufsverboten und Konzentrationslager produzierten viele Künstler gefällige oder seichte Kunst, Kritik an der NS-Diktatur wurde zurückgehalten oder auf ein Minimum reduziert. Der Widerstand der Künstler fand nur vereinzelt und im Geheimen statt, in den allermeisten Fällen bestand er aus einem bloßen Rückzug ins Innere.
Im Sammelband Zwischen innerer Emigration und Exil zeigt die Autorin und Herausgeberin Leonore Krenzlin auf, dass der Begriff nicht, wie oft fälschlich behauptet, von Frank Thiess begründet wurde, der ihn auf die Zeit des Nationalsozialismus angewendet hat. Schon in den 1920er-Jahren fand die innere Migration in Leo Trotzkis Literatur und Revolution Erwähnung. Für Krenzlin behauptet die Formulierung innere (E-)Migration, dass es „eine Abwesenheit ohne eine reale körperliche Auswanderung gebe, eine Absetzbewegung in irgendeiner indirekten Bedeutung: als Nichtübereinstimmung mit den Zuständen des
Landes, als ein Sichausgliedern aus den Anforderungen des Staates, als Weigerung, ihn zu unterstützen – oder sogar auf einer ganz unkörperlichen Ebene als ein Rückzug in das Innere des Geistes oder der Seele.“
Wichtiger erscheint es mir, den Begriff von historischen Kontexten losgelöst auf soziale Fragen im Hier und Jetzt zu übertragen. Denn wenn wir uns die Lage der unteren Klasse ansehen, ist Krenzlins Definition die Zustandsbeschreibung der Gegenwart vieler armer Menschen. Fast jeder vierte Wahlberechtigte gab 2021 bei der Bundestagswahl keine Stimme ab. Politikverdrossenheit, Populismus und der Glaube an Verschwörungserzählungen sind in der unteren Klasse überproportional vertreten.
~

Ich muss an mein Aufwachsen in Altona denken, einem Viertel von Hamburg, in dem Arbeiterinnen neben Künstlern und arme Menschen neben Bildungsbürgern wohnten. Ein Viertel, in dem Gewalt in manchen Wohnblöcken, Straßen und Häusern Teil des Alltags war. Wie viele Jugendliche und Erwachsene sind hier dem Alkohol, Gras oder harten Drogen verfallen? Wie viele sind eingefahren, ins Gefängnis?
Ein alter Freund, mit dem ich gemeinsam Musik gemacht und bei dem ich Songs aufgenommen habe, wurde vor ein paar Monaten zu zwei Jahren auf Bewährung und einer hohen Geldstrafe verurteilt.
Vor einem Jahr traf ich in Hamburg durch Zufall einen Bekannten wieder. Er erzählte mir, dass sein Prozess wegen des Handelns mit Kokain anstand. Erst vor ein paar Tagen erfuhr ich, dass er nun im Gefängnis sitzt.
Es gibt bis heute alte Bekannte, die mich, wenn ich sie treffe, mit dem Pseudonym ansprechen, unter dem ich früher gerappt habe. Einer von ihnen ist B. „Soma, digga, ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben!“, ruft er, als ich einem Kamerateam mein altes Viertel zeige. „Ich wusste gar nicht, dass es früher bei dir auch so schlimm war. Bei uns ist ja auch richtig heftig gewesen, aber uff, wenn du Buch schreibst darüber, dann …“ Er hört auf zu reden, sein Blick erstarrt auf eine Weise, die ich kenne, weil mein eigener Blick zuvor oft genauso erstarrt ist. Man kann sehen, wie es in ihm rattert: Wie schlimm musste eine Form der Armut sein, die es nötig machte, ein Buch über sie zu schreiben?
Eine weitere Erinnerung. Ich bin mit ein paar alten Freunden in Altona an dem Platz unserer Jugend auf ein Bier verabredet. Wir alle wurden schon über diesen Platz gejagt, mal von anderen Jugendlichen oder Erwachsenen, mal von der Polizei. Ich wurde auf dem Platz geschlagen, habe mich erbrochen, habe ein paarmal Gras verkauft, öfter aber Gras gekauft. Ich habe an Wände gepinkelt, Mauern und Mülleimer angemalt und mit Stickern beklebt. Ein Bekannter von früher stößt dazu, er will ebenfalls über mein Buch sprechen und nimmt mich zur Seite. Er wolle es mir persönlich sagen und nicht hinter meinem Rücken
reden. Er habe Respekt davor, dass ich ein Buch geschrieben habe, aber ganz ehrlich und ohne mir zu nahe treten zu wollen, so wie ich seien doch viele aufgewachsen, das sei doch gar nicht so krass. Er erzählt mir die Geschichte seiner Familie.
Zu erkennen, dass der eigene Lebenslauf, die Hautfarbe, der Nachname oder die Straße, in der man lebt, Türen verschließt, ist für die meisten Menschen nicht leicht zu ertragen. Ich weiß von einigen Beispielen, in denen junge Erwachsene, Männer öfter als Frauen, auf diese Zuschreibungen affirmativ reagieren. Meine Mutter putzt Toiletten, mein Vater ist abgehauen, die Gesellschaft traut mir nichts zu, die Initiative, die ich zeige, um vom Fleck zu kommen, wird zurückgewiesen – dann soll es so sein. Dann mache ich euch den Gangster, den Dealer, den Alkoholiker, den Taugenichts, die Depressive, bitte schön. Das sind Zeichen innerer Migration. Ein Verstummen; sich den Zuständen und Spielregeln ergeben, die Rolle annehmen. Seinen Platz kennen. Nicht aufsteigen können und also auch nicht wollen, den Mächtigen die Zustimmung verwehren. Merkmale innerer Migration weisen auch die oben beschriebenen Situationen auf, in denen es nur dann möglich erscheint, ein Buch über die sozialen Bedingungen des Aufwachsens zu schreiben, wenn die Zustände wüster sind als Hartz 4, als die Intervention des Jugendamtes in der Familie, als Drogenprobleme, Vorstrafen, Ärger um den Duldungsstatus und das Über-die-Runden-Kommen durch Kleinkriminalität. Umgekehrt gesprochen: Was sagt es aus, wenn das alles als eine Form der Normalität empfunden wird, über die man nicht zu sprechen braucht? Was sagt es über eine Gesellschaft aus, in der ein Teil glaubt, dass ihm kein würdevolles Leben zusteht?