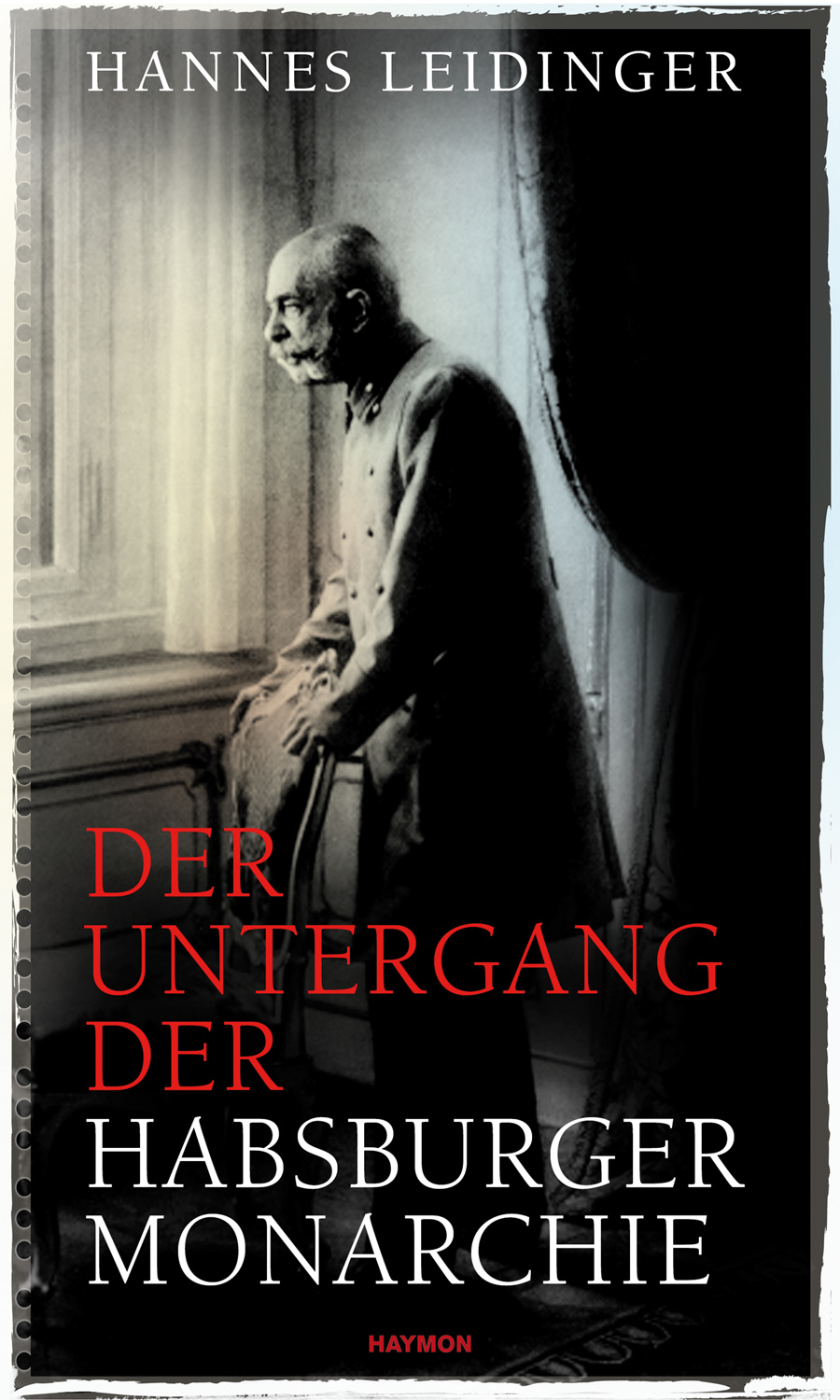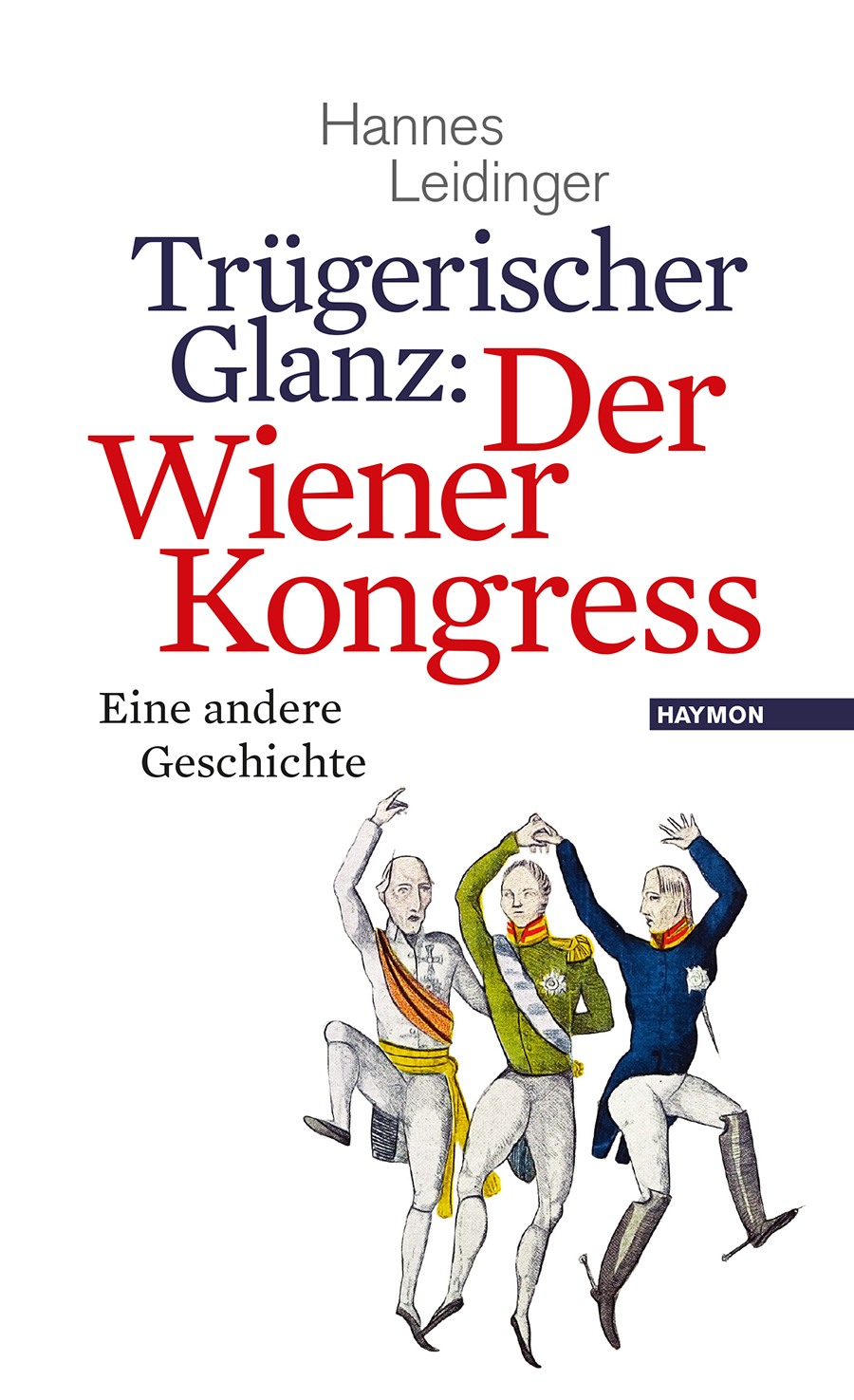Historische Erbschaften – Interview mit Hannes Leidinger und Lenz Mosbacher
Wie ging die Geschichte des k.u.k.-Doppelstaates und der Entwicklungen nach 1918, die im Grunde bis heute andauern, weiter? Wie betrachten wir das habsburgische Erbe? Wie steht es um seine Relevanz, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa? Hannes Leidinger, Historiker und Autor, und Lenz Mosbacher, Illustrator von „Habsburgs langes Sterben“ erzählen vom Ausverkauf der österreichischen Identität, von der Romantisierung und den hartnäckigen Mythen der Geschichte und von den Schlüsselmomenten der Habsburgerzeit.
Offiziell endete die Zeit der Habsburger 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Trotzdem sind die Habsburger noch tief im nationalen Gedächtnis der Österreicher*innen verwurzelt, sie leben weiter „in den Köpfen und Herzen, in den Empfindungen und Vorlieben, in den Sitten und Normen seiner ehemaligen Bewohner“, wie Sie in Ihrem neuen Buch erklären. Hat sich das nationale Selbst- und Fremdbild in den letzten Jahren gewandelt und wenn ja, wie?
Hannes Leidinger: Entscheidend ist nach 1918 das Lagerdenken, das sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Grob gesagt geht es vor allem um die Stellung der Kirche, um den Kampf zwischen antiklerikalen und klerikalen Kräften. Letztere tendieren – vereinfacht gesagt – schon aus weltanschaulichen bzw. konfessionellen Gründen zum katholischen „Erzhaus“. Hinzu kommt eine eigene Mentalität, die dem Herrscher verpflichtet war, auch ohne religiöse Gefühle. Beamte, städtisches Bürgertum oder „mittelständische Gruppen“ gehören hier dazu. Ein klar republikanisches Bekenntnis legt die organisierte Arbeiterbewegung. Der Nationalsozialismus wird darüber hinaus zu einer eigenen antihabsburgischen Kraft, vor allem im Laufe der 1930er Jahre. Politisch haben Monarchisten bzw. Legitimisten keine Massenbasis. Sympathien beschränken sich vor allem auf eine prohabsburgische Geschichtspolitik und entsprechende (erinnerungs-)kulturelle Initiativen, insbesondere während des „Austrofaschismus“ bzw. des sogenannten „Ständestaates“.
Diese durchaus einflussreiche Strömung hat aber keine Chance, zur Restaurationsbewegung zu werden. Die Wiedererrichtung einer Monarchie ist auch aufgrund internationaler Kräfteverhältnisse kein Thema, trotz gelegentlicher Tendenzen innerhalb konservativer österreichischer Eliten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lösen sich dann nach und nach die älteren Gesellschaftsstrukturen auf. Ideologische Lager, traditionelle Berufsgruppen und soziale Milieus erodieren, in den 1980ern ändert sich auch die Geschichtsbetrachtung. Die dunklen Kapitel der Vergangenheit rücken in den Mittelpunkt der Betrachtung, tendenziell auch eine kritische Betrachtung der k.u.k.-Monarchie. Österreich rückt mehrheitlich, wenn auch nicht vollständig, von seinem bisherigen Selbstbild ab, von älteren Stereotypen und Geschichtsklitterungen. Eine über Dekaden anhaltende Liberalisierungstendenz drängt hierarchische Denkweisen teilweise zurück, der fortgesetzte Säkularisierungsprozess trennt die Gegenwart von der Religiosität früherer Epochen. Das alles kann sich mit autoritären Trends und neuen Glaubensvorstellungen auch wieder ändern. Im Augenblick aber ist das Thema Habsburg vor allem ein klischeebesetztes Stück Kultur und vor allem Tourismus – und in diesem Sinne mehr nach außen als nach innen, also auf das Fremdbild und nicht auf das Selbstbild, gerichtet.
Weshalb ist ein besseres Verständnis der Habsburger wichtig für ein besseres Verständnis der Gegenwart?
Hannes Leidinger: Wer Geschichte als Erklärung zum besseren Verständnis der Gegenwart begreift, wird die heutige Alpenrepublik nicht zuletzt auch aus der Perspektive der jahrhundertelangen Habsburgerherrschaft betrachten. Die Prägung durch Gegenreformation, Administration, Kultur, Gesellschaftsstrukturen, Feindbilder, Geschlechter- und Eigentumsverhältnisse, beginnende Demokratisierung bei gleichzeitiger Autoritätsgläubigkeit und hierarchischem Denken erfolgt in hohem Maße unter dem „Doppeladler“, ist in gewisser Weise also eine „lange Zeitgeschichte“.
Die Habsburgerfamilie und monarchische Strukturen allgemein sind häufig Gegenstand von Romantisierung und Kommerzialisierung. Welche Probleme können durch diese Verklärung oder Idealisierung entstehen?
Hannes Leidinger: Die Auseinandersetzung mit einer Romantisierung der Geschichte könnte man als eher „akademisches Geschäft“ der HistorikerInnen verstehen. Eine Verklärung monarchischer Strukturen steht aber oft der kritischen Beurteilung von Verantwortlichkeiten und Machtfragen generell im Weg.
Mit Gegenwartsbezug geht es dabei etwa um den Umgang mit Schwächeren und Minderheiten, die Kluft zwischen Arm und Reich, die Entscheidung über Krieg und Frieden. Die Imagebildung der Monarchie geht auch gerne über das Thema Privilegien und Geburtsrechte hinweg. Sie widersprechen demokratischen Prinzipien, die sich letztlich nur in einer Republik zur Gänze verwirklichen können.
Und wie sehen Sie den Ausverkauf der Identität, der durch Tourismus und Souvenirs nicht nur in Österreich gang und gäbe ist?
Hannes Leidinger: Gewiss hat der Tourismus gerade die österreichische Republik sowohl mit Blick auf Fremd- als auch auf Selbstbilder sehr stark geprägt. Der „Doppeladler“ hat da oft für Ausblendungen herhalten müssen, Kriege der Habsburger waren eher kein Thema. Eine Art Eskapismus, die Flucht in idyllische Phantasiewelten der Könige, Kaiser, Prinzessinnen, Reichen und Schönen, ist gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ein Instrument der Geschichtsvergessenheit und der Verdrängung von Schuld und Traumata gewesen. Das war ein internationales Phänomen, ebenso wie die spätere kritische Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg und den NS-Verbrechen.
Seit der Waldheim-Affäre hat sich die Wahrnehmung Österreichs im Ausland stark geändert, parallel zu den internen Transformationen. Ebenso grenzüberschreitend bleibt aber auch das Bedürfnis nach harmonischen Scheinwelten bestehen. Wenngleich mit Augenzwinkern, konsumieren doch viele die Produkte einer Art Sisi-Industrie weiterhin gerne. Persönliche Nöte und Beschwerden der HerrscherInnen werden dabei gelegentlich als Hinweise auf die Schattenseiten der „guten alten Zeit“ präsentiert und empfunden.
Kann eine nationale und kulturelle Identität der Österreicher*innen getrennt von den Habsburgern existieren?
Hannes Leidinger: Habsburg war das „(Erz)Haus Österreich“. Für viele MitteleuropäerInnen gab es lange keinen anderen Österreich-Begriff. Ansonsten definierte man sich über Nation und Sprachgemeinschaft, Religion, Berufe, Gesellschaftsschicht, Regionen und Kronländer. Habsburg, der Kaiser, war die gemeinsame Klammer. Das Übrige waren „Trümmer“, würde die verklärende Literatur sagen. Es dauerte lange, bis sich gerade die Menschen in der Alpenrepublik vom großen Reich verabschiedeten. Über den tragischen und schuldbeladenen Umweg des Nationalsozialismus, des „völkischen Ungeistes“ und der gewaltsamen Expansion gelangte man zur Kleinstaatsidentität und damit zu einem neuen, weithin anerkannten Österreich-Begriff. Dieser verliert allerdings im Rahmen der Europäischen Union, der Globalisierung, internationaler Militärbündnisse und einer schwelenden Neutralitätsdebatte bereits wieder an Strahlkraft und wirkt gelegentlich außerdem chauvinistisch und realitätsfremd.

Hannes Leidinger erzählt in seinem neuen Buch „Habsburgs langes Sterben – Eine kurze Geschichte vom schleichenden Untergang der Donaumonarchie“ vom habsburgischen Erbe und dessen Relevanz für Österreich und Europa. Die Publikation dient als Portal, als Eintritt in die Welt der Habsburger lange nach dem Einläuten der Republik. Mit Illustrationen von Lenz Mosbacher.
Sie sind ein langjähriger Experte auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie. Haben Sie bei Ihren Recherchen für dieses Buch vielleicht doch etwas Überraschendes entdeckt?
Hannes Leidinger: Wenn man sich schwerpunktmäßig mit dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang Österreich-Ungarns befasst, stößt man erwartungsgemäß auf Zeichen des Zerfalls, auf Zentrifugalkräfte, Erklärungen für das Auseinanderbrechen der Doppelmonarchie – sowohl international als auch innerhalb der Grenzen des Habsburgerreiches. Bekannt war seit Langem, dass sich die Großmächte eine „Desintegration“ des Donauraumes nur bedingt oder gar nicht wünschten. Daher gab es selbst bei den feindlichen Mächten noch bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Befürworter des k.u.k.-Doppelstaates. Überraschend war die Haltung der Menschen in der Monarchie, der habsburgischen „Untertanen“, das Ausmaß und die Dauerhaftigkeit der Zustimmung und der Loyalität gegenüber dem Herrscherhaus. Der Einfluss mehr oder minder nationaler und nationalistischer Geschichtsinterpretationen hat dieses Phänomen oft wirkmächtig marginalisiert oder verschwiegen. Da habe auch ich gängige Darstellungen hinterfragen und revidieren müssen.
Es gibt viele weitverbreitete Fehlannahmen über die Habsburger. Welche hartnäckigen Mythen sind falsch, lassen sich aber einfach nicht abschütteln?
Hannes Leidinger: Die Reformen unter Maria Theresia und Joseph II. werden gerne als fortschrittliche Maßnahmen gesehen, gerade wenn es sich um Maßnahmen im Justiz- und Bildungswesen oder um Lockerungen von feudalen Bindungen handelte. Das ist zumindest nur die halbe Wahrheit. Erstens wirkten sich viele Regelungen nicht auf sämtliche Reichsteile aus und zweitens ging es vielfach um die Schaffung eines Machtstaates, der effizientere Verwaltungsstrukturen und eine schlagkräftige Armee mit besser ausgebildeten „Untertanen“ brauchte. Die starke, homogene „Monarchia Austriaca“ blieb jedoch eher ein Wunschgebilde. Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass die Meinungen darüber in der Forschung auseinandergehen.
Dass das „Haus Österreich“ eher eine friedliebende Heiratspolitik betrieben hat und Kriege eher vermeiden wollte, ist sicher ein weitverbreitetes Klischee. Vor allem wird außer Acht gelassen, dass dynastische Ehen und militärische Auseinandersetzungen einander vielfach bedingten und miteinander verbunden waren. Überdies suchte gerade Kaiser Franz Joseph die Entscheidung im Konfliktfall mehrmals auf dem Schlachtfeld. Das passt freilich nicht so ganz zu den Verniedlichungsversuchen einer prohabsburgischen Historiographie. Franz Joseph muss eher als Wiederholungstäter unter widrigen politischen und militärischen Rahmenbedingungen angesehen werden, mit einem gerade selbstmörderischen Prestigedenken. In „Ehren unterzugehen“ hieß dann auch, die Welt oder wenigstens Europa mit in den Abgrund zu reißen. Auch unter HistorikerInnen wird immer wieder betont, dass er keinen „Flächenbrand“ auslösen wollte und nur auf eine Abrechnung mit Serbien abzielte. Durch die Bündnissysteme bis 1914 wurde eine Eingrenzung des Konflikts aber unmöglich. Franz Joseph und seine engsten Berater wussten nachweislich von den Gefahren, die mit ihren Entscheidungen verbunden waren.
Die Illustrationen öffnen einen weiteren Gedankenraum zu Hannes Leidingers Einordnungen. Wie drücken Sie, als Illustrator, die Gefühle einer Zeit, die Sie nicht persönlich erlebt haben, in Ihren Bildern aus?
Lenz Mosbacher: Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es eine anwachsende Fülle an Zeitungen und Zeitschriften, die vielzählig in Archiven erhalten sind. Um ein Gefühl für eine Zeit zu bekommen, lassen sich Tageszeitungen – mit Vorsicht genossen – als gesellschaftliches Barometer verwenden. Für mich als Zeichner war zusätzlich noch interessant, dass bis in den Ersten Weltkrieg hinein der Großteil an Nachrichten illustriert war. Hierbei handelt es sich teils um idealisierte oder verzerrte Illustrationen von Tagesthemen oder um politische Cartoons und Karikaturen. Im Buch bemühte ich mich daher um einen Stil, der über das Dargestellte hinausweist, aber im Gegensatz zu den historischen Zeitungsillustrationen keine idealisierten Szenen darstellt.
Mir war deshalb wichtig, einen sinnlichen Zugang zur Zeit und den jeweiligen Situationen zu bekommen. Wie fühlt es sich an? Wie riecht die Luft? Welche Geräusche hört man auf der Straße? Auch wenn ich um die Jahrhundertwende nicht am Leben war, suchte ich nach Parallelen zu meinem eigenen Erfahrungsschatz. Erst dann konnte ich Zeichnungen machen, die sich (für mich) anfühlen, als wäre ich vor Ort gewesen.
War hierfür eine besondere Recherche notwendig oder ist die Ikonografie der Zeit ohnehin sehr präsent in unserem kollektiven Gedächtnis? Ist das vielleicht sogar eine besondere Herausforderung an der Arbeit mit einer Epoche, deren Bildsprache in unseren Köpfen so allgegenwärtig scheint?
Lenz Mosbacher: Eine ausgedehnte Recherche und Beschäftigung mit der Zeit war notwendig, um mich vom Kitsch des Heimatfilms zu befreien, der das kollektive Bild der Habsburgermonarchie seit den 1950ern stark verfärbt. Meine Recherche beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Bildsprache. In einer Zeit, in der visuelle Medien noch nicht so allgegenwärtig verbreitet waren wie heute, kam der Sprache mehr Bedeutung zu. Einige Monate las ich intensiv Literatur um die Jahrhundertwende herum. In ihr konnte ich die Aufbruchs- und Umbruchstendenzen, die sich durch die Gesellschaft zogen, weit besser nachvollziehen und auch emotional in meinen Zeichnungen verbildlichen.
Im Laufe Ihrer Zusammenarbeit musste eine Auswahl der Motive getroffen werden, die Sie ausdrucksvoll illustriert haben. Wie haben Sie diese Wahl getroffen? Wie haben sich diese Schlüsselmomente herauskristallisiert?
Lenz Mosbacher: Der Niedergang der Habsburgermonarchie lässt sich kaum in einen dramatischen Handlungsbogen pressen – diese Vereinfachung wird dem komplexen Sachverhalt nicht gerecht und steht auch quer zum Inhalt des Buchs. Trotzdem sollten die Zeichnungen einen Strang durch das Buch bilden, entlang dessen man sich hanteln kann. Unterstützend sind die Bildtexte, die ich gemeinsam mit Hannes geschrieben habe und die sozusagen das Bindeglied zwischen Buchtext und Zeichnungen sind. Idealerweise soll das Lesevergnügen so sein, dass die Zeichnungen den Text mit Emotion und der Text die Zeichnungen mit Information auflädt. Zusammen ergibt sich dann ein Bild.
Noch eine kleine Frage zum Schluss an Sie beide: Haben Sie einen Lieblingshabsburger?
Hannes Leidinger: Hagiographien sind grundsätzlich meine Sache nicht. Es darf als Gemeinplatz gelten, dass Menschen nicht selten zu widersprüchlichen Handlungen neigen und sehr verschiedene Charaktereigenschaften entwickeln. Lassen wir einmal unbeantwortet, was darunter wiederum genau zu verstehen ist und wie die Beurteilungskategorien für diverse Wesenszüge festgelegt werden. Es gibt immerhin Momente, in denen mir überlieferte Verhaltensweisen, wenn sie denn so stimmen, sympathisch erscheinen. Im Augenblick des Reichszerfalls und drohender gewaltsamer Konfrontationen will Karl, der letzte Kaiser und König, kein Blut mehr vergießen. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Auch die eher moderate Denkweise Leopolds II. nach dem Reformeifer seines stürmischen Bruders Joseph ist von tieferen Einsichten geprägt. Kronprinz Rudolf hätte vielleicht das Potenzial zu zeitgemäßen Liberalisierungen und einer offeneren Politik gegenüber maßgeblichen europäischen Mächten gehabt, wäre er nicht Opfer seiner psychischen Leiden geworden.
In Summe geht es wohl um System- und Gesellschaftsanalysen, weniger um persönliche Vorlieben. Lediglich bei besonderen Machtpositionen und größeren Handlungsspielräumen stellt sich in einem gewissen Maße die Frage der individuellen Verantwortung mehr als sonst.
„Habsburg-Kannibalismus“ ist jedenfalls ebenso wenig am Platz wie die Idealisierung oder die kollektive Be- und Aburteilung einer Familie, die unter den Herrschaftsverhältnissen gelegentlich selbst gelitten hat und manchmal auch daran zerbrochen ist. Nicht nur die Tragödie von Mayerling und der Thronfolger Rudolf erinnern uns daran.
Lenz Mosbacher: Der Hof der Habsburgermonarchie war schrecklich repressiv und starr. ZeitzeugenInnen berichten etwa immer wieder, wie stinklangweilig es im engeren Familienkreis um Franz Joseph gewesen sei: Betretenes Schweigen, niemand traut sich, offen miteinander zu reden. Da halte ich zu den AußenseiterInnen des Hofs, wie etwa Kaiserin Sisi oder Kronprinz Rudolf, die wenigstens versuchten, auszubrechen – und daran leider schlussendlich zerbrachen.