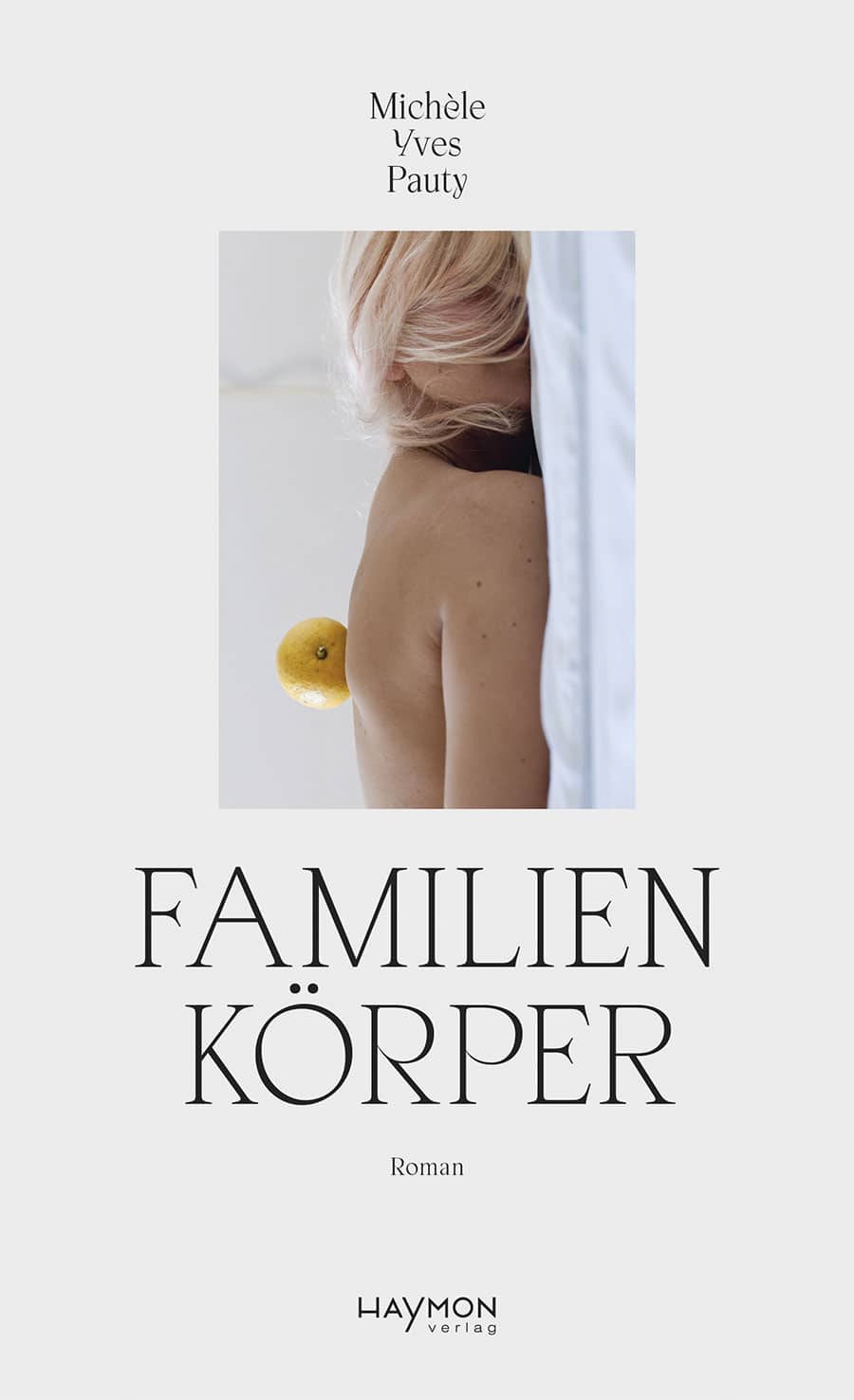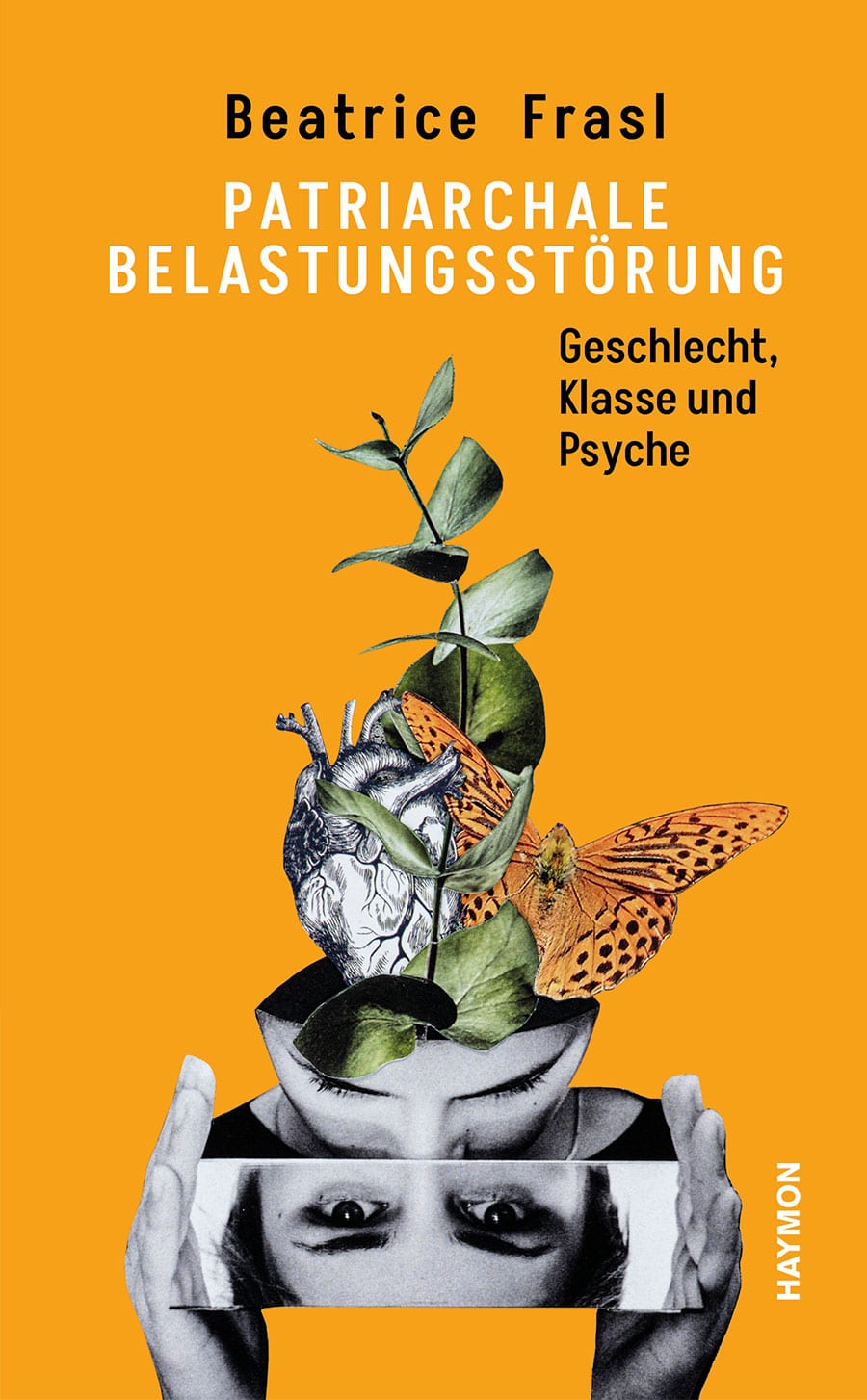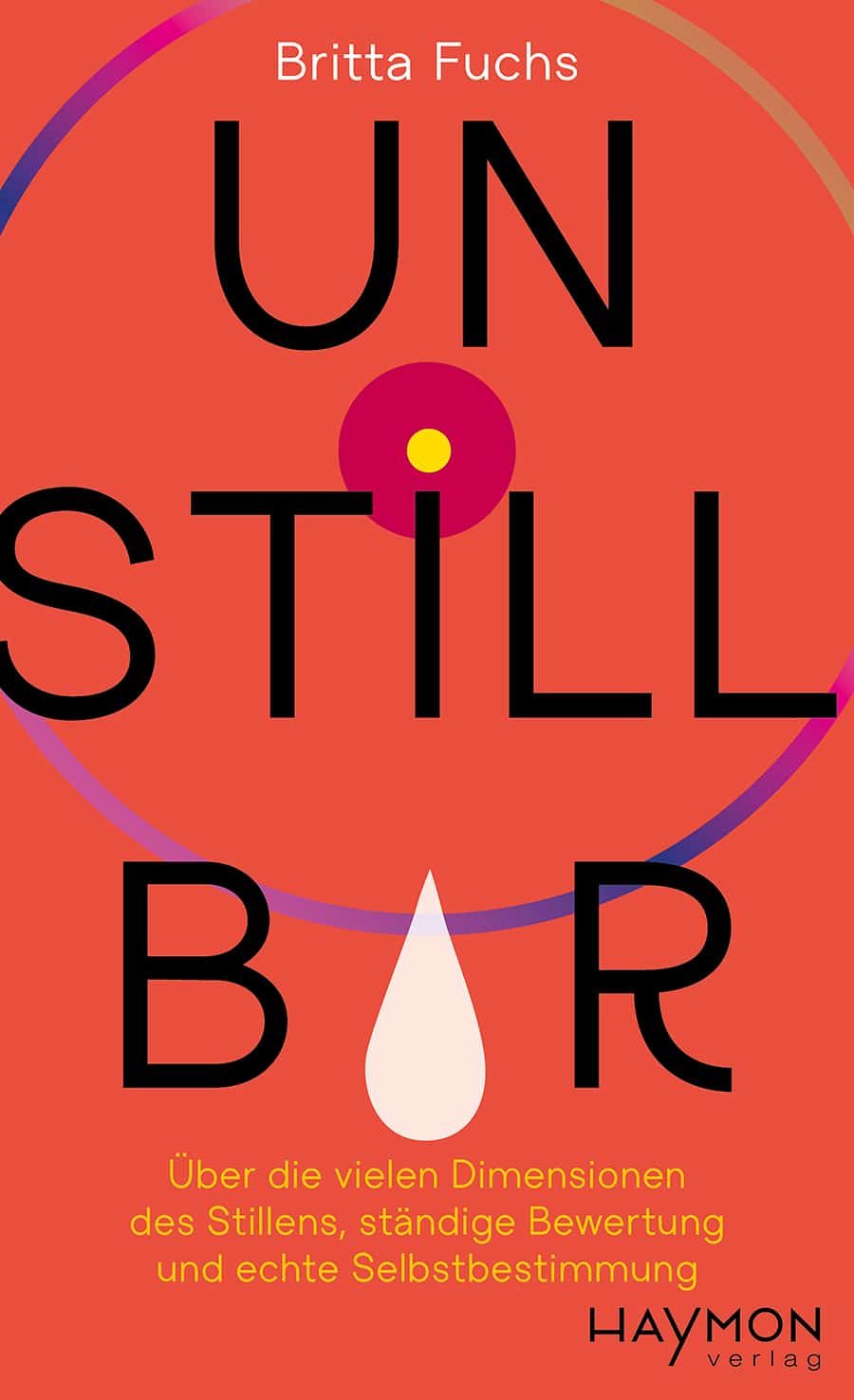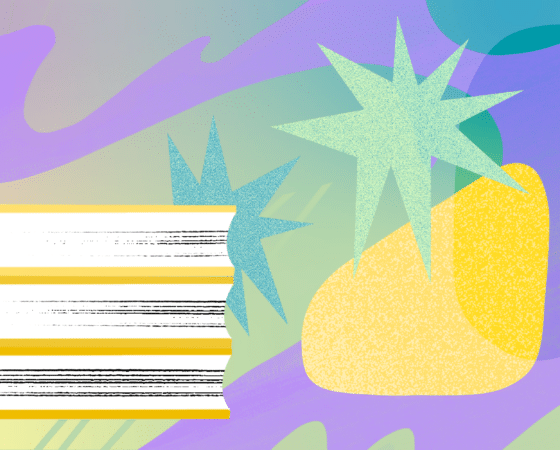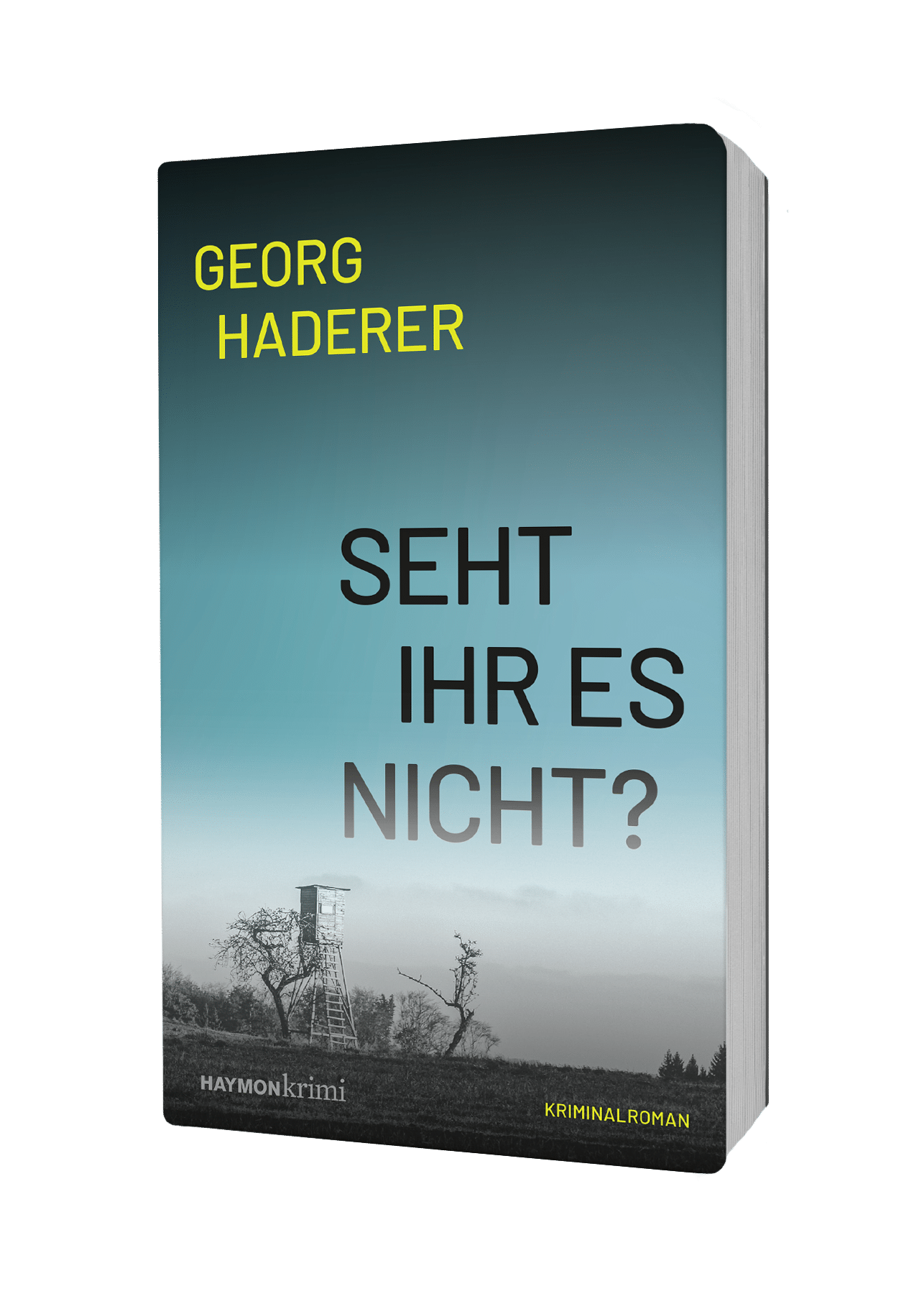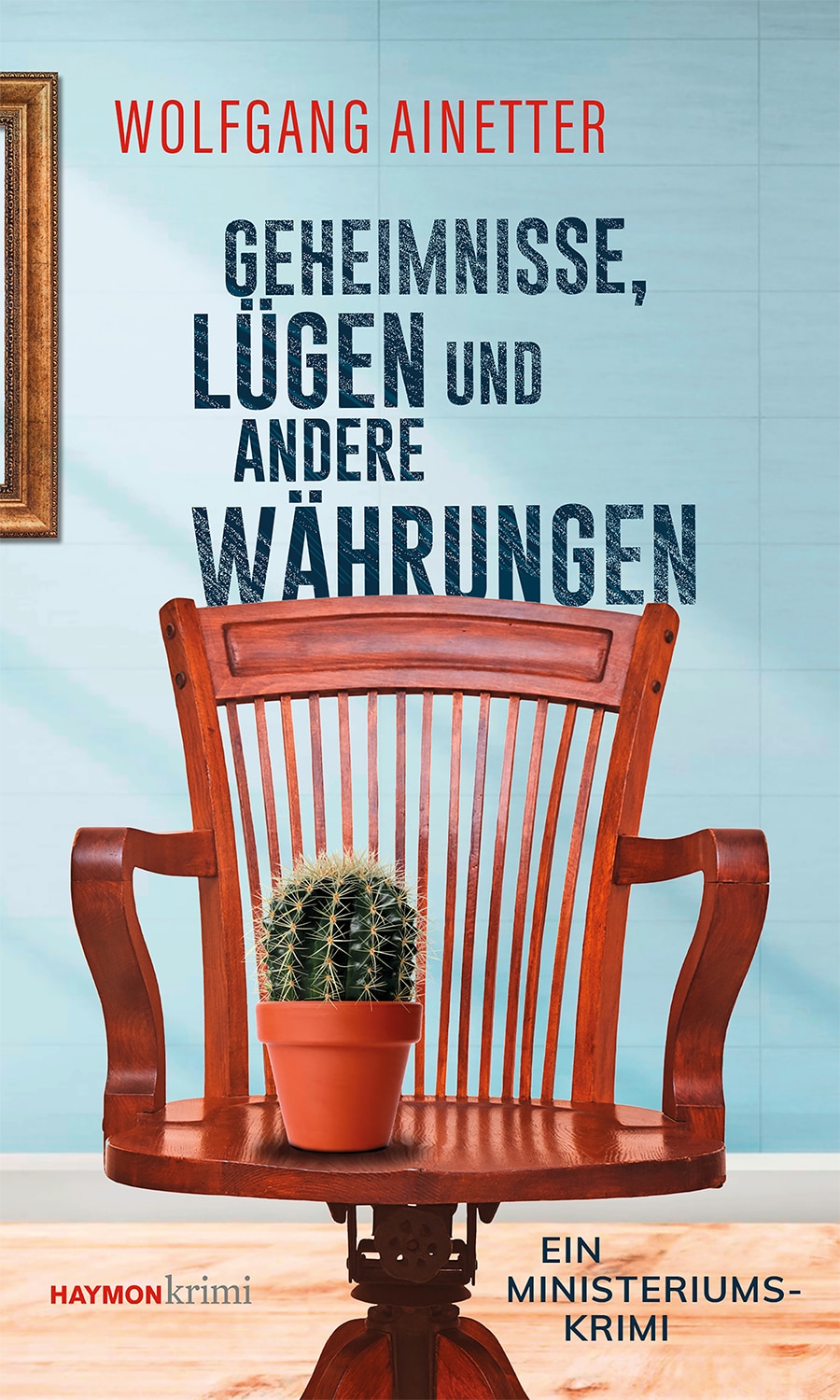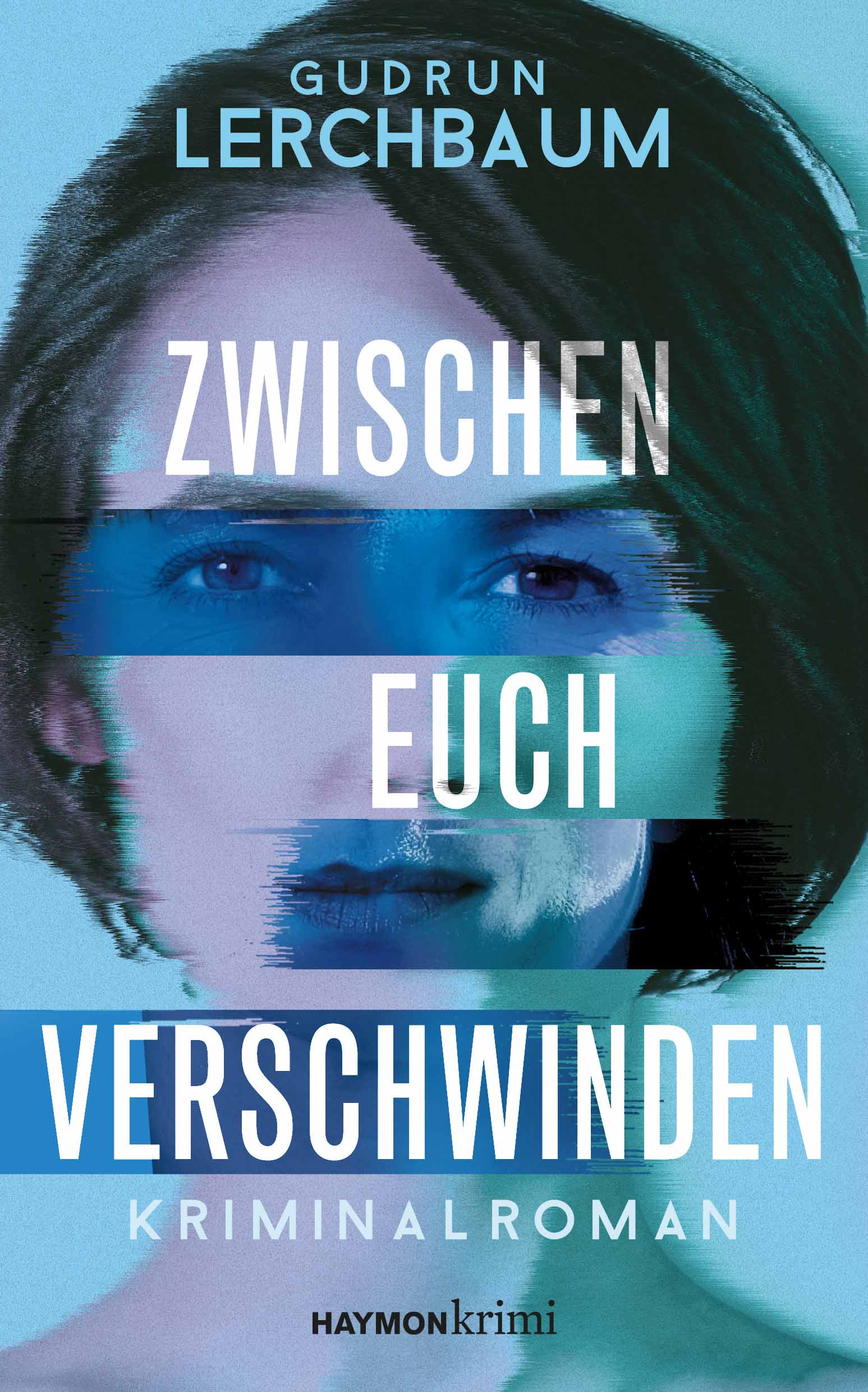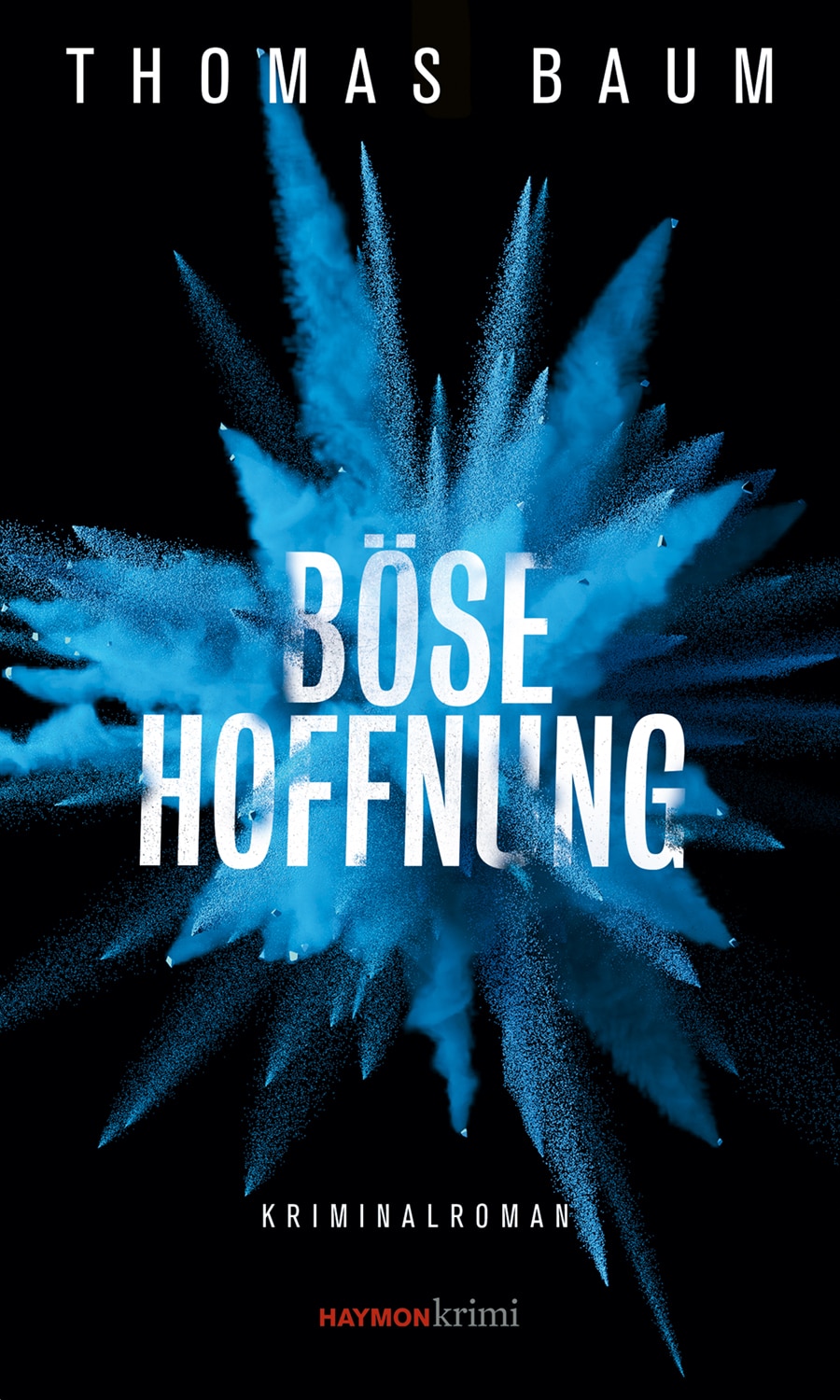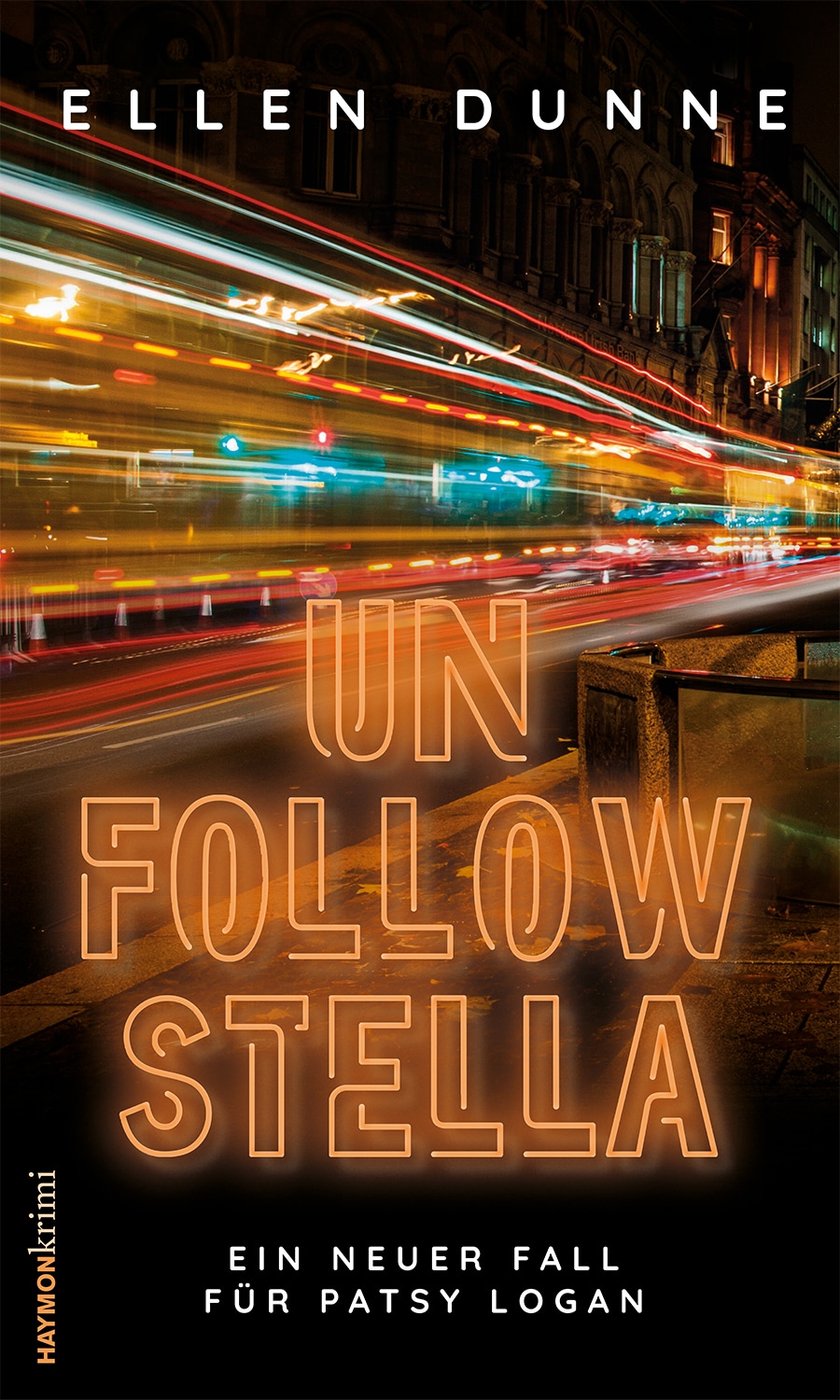„Würde darf keine Option sein, sondern muss zum Standard werden“ – ein Interview mit Johanna Maria Brix und Bianca-Karla Itariu
Faul, schwach, undiszipliniert – das sind nur einige der gängigen Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen. Fettfeindlichkeit gehört zu ihrem Alltag und macht auch vor der Medizin nicht halt. Dicke Patient*innen werden stigmatisiert, ihre Beschwerden vorschnell aufs Gewicht reduziert, ihre Behandlung verzögert oder verweigert.
Genau hier setzen die Ärztinnen und Autorinnen Dr. Johanna Maria Brix und Dr. Bianca-Karla Itariu an. In ihrem Buch „Das Gewicht unserer Körper“ und diesem Interview berichten sie von alltäglichen Szenen im Behandlungszimmer, von strukturellen Barrieren und von einer Medizin, die Betroffene zu oft im Stich lässt. Sie fordern: Wir müssen lernen, dicke Körper nicht als Defizit, sondern als Teil menschlicher Vielfalt zu begreifen – und endlich eine Gesundheitsversorgung schaffen, die evidenzbasiert, respektvoll und diskriminierungsfrei ist.
Ihr beide seid Ärztinnen und habt auch beide schon viele wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Wie war es für euch, das Genre zu wechseln und ein Sachbuch zu schreiben? Wie lief der Entstehungsprozess ab?
Bianca-Karla: Mein erstes Sachbuch war „Schlank auf Rezept: Die Abnehmrevolution” (mit Dr. Siegfried Meryn, erschienen bei edition a, 2023). Die Arbeit daran war so bereichernd, dass ich Lust auf mehr bekam. Als die Verlagsleitung des Haymon Verlags, Katharina Schaller, mich fragte, ob ich ein weiteres Buch schreiben möchte, war mir klar: Wie in der Wissenschaft wollte ich eine Partnerin. Ich bat Johanna, Co-Autorin zu sein. Der Prozess dauerte länger als geplant. Zwischendurch hatten wir Phasen der Hoffnungslosigkeit, da wir in der Versorgung täglich miterleben, wie Patient*innen enttäuscht und verletzt werden. Es war fordernd, das auszuhalten und trotzdem an einem empathischen, lösungsorientierten Buch zu arbeiten. Getragen hat uns der Glaube an Menschlichkeit und die Kraft von Wissen, Sprache und Strukturveränderung.
Johanna: Für mich war es weniger ein Bruch als eine Erweiterung. In Papers schreibe ich für Kolleg*innen, im Buch hingegen für Betroffene, Behandelnde und die Öffentlichkeit. Das heißt: präzise, evidenzbasiert, aber dennoch zugänglich. Viele Kapitel begannen als klinische Beobachtungen und entwickelten sich zu Brücken aus Evidenz, Geschichte und konkreten Forderungen. Das hat meiner „inneren Logistikerin“ gefallen: Am Ende muss alles da sein – nachvollziehbar, geordnet und nützlich. Während des Entstehens gab es aber auch viele Teile, die im Lektorat wieder rausgenommen werden mussten, weil sie zu weit führen würden für dieses Buch. Mir ist aber beim Schreiben daran klar geworden, wie wichtig mir noch viele andere Punkte sind.

Dr. Bianca-Karla Itariu, PhD hat ihre Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin, Zusatzfach Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, an der Medizinischen Universität Wien absolviert. Bis März 2023 leitete sie die internistische Adipositas Ambulanz am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen zum Thema Adipositas und ist Vize-Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft.

Priv.-Doz. Dr. Johanna Maria Brix ist Fachärztin für Innere Medizin und arbeitet als Oberärztin an der ersten Medizinischen Abteilung mit Endokrinologie, Diabetologie und Nephrologie der Klinik Landstraße. Sie war bis 2023 Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft, Leiterin der Adipositas-Akademie und hat eine Lehrtätigkeit an der Medizinischen Universität in Wien.
Ihr habt euch unter anderem auf Adipositas, Endokrinologie und Diabetologie spezialisiert. Was hat euch an diesen Fachbereichen besonders interessiert, und welchen Einfluss hatten eure Erfahrungen mit Körpernormen darauf?
Bianca-Karla: Meine geliebte Großmutter war sehr dick. Als Kind habe ich durch ihre gelebte Erfahrung mitbekommen, welche Einschränkungen durch Körpergewicht entstehen können. In beiden Büchern kommt sie vor. Ob diese Erfahrung meine Entscheidung beeinflusst hat, Endokrinologin zu werden, weiß ich nicht. Während meines Studiums lernte ich allerdings, dass Fett kein träges Depot ist, sondern ein hochaktives Organ, was ich unglaublich faszinierend fand. Fettzellen produzieren Hormone und Zytokine und stehen in Kommunikation mit Gehirn, Gefäßen, Leber und Pankreas. Das verändert auch den Blick auf Körpernormen. Wenn Fettgewebe das Stoffwechselgeschehen maßgeblich steuert, ist das moralische Urteilen über Körperformen nicht nur verletzend, sondern auch unwissenschaftlich. Schon als Schülerin fand ich die Endokrinologie faszinierend, da eine Freundin meiner Mutter Endokrinologin war. In diesem Fachgebiet treffen Biologie, Gesellschaft und individuelle Lebenswege aufeinander – fernab von Schuldzuweisungen.
Johanna: Eigentlich hat mich die Diabetologie durch Zufall gefunden: Es war eine ausgeschriebene Stelle, für die ich erst zweite Wahl war. Ich wollte aber immer Innere Medizin machen, weil mich bis heute sehr fasziniert, wie fein wir an Schrauben drehen und im Körper damit Prozesse ändern bzw. im besten Fall verbessern können. Daher bin ich heute sehr dankbar dafür. Gerade Adipositas zeigt, wie wenig einfache Parolen wie „weniger essen, mehr bewegen” bewirken. Wenn es so simpel wäre, hätten wir die Trendwende längst geschafft. So wie beinahe überall gilt: Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme, und die Erkrankung Adipositas ist viel komplexer als die meisten Menschen glauben. Im Alltag erlebe ich immer wieder, wie stark Körpernormen Diagnosen verzerren. Knie- oder Migränebeschwerden werden beispielsweise vorschnell aufs Gewicht geschoben. Dabei verdienen Patient*innen es, dass ihre Probleme ernst genommen werden – und zwar unabhängig von der Zahl auf der Waage. Genau das ist für mich der Kern dieses Fachs: den Menschen hinter den Normen sehen und gemeinsam realistische, individuelle Therapiewege finden.
Euer neues Buch „Das Gewicht unserer Körper“ befasst sich mit Bodyshaming in der Medizin – es soll bewusst kein Abnehmbuch sein. Wieso braucht es genau so ein Buch?
Beide: Weil Stigmatisierung unwürdig ist und krank macht. Es verhindert Diagnosen, erschwert den Zugang zu Therapien und mindert die Lebensqualität. Zudem legitimiert es strukturelle Lücken: Es gibt keine Pfade, keine Erstattung und keinen Rechtsschutz. Wir bündeln drei Ebenen: Adipositas als chronische, multifaktorielle Erkrankung, Analyse von Diskriminierung und konkrete Hebel für eine würdige Versorgung.
Gab es berufliche oder persönliche Schlüsselmomente, in denen die strukturelle Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen für euch besonders deutlich wurde?
Bianca-Karla: Jede Interaktion mit den Chefärzt*innen ist eine Erinnerung daran. Das liegt nicht daran, dass die Kolleg*innen „böse“ wären – sie machen ihre Arbeit gründlich –, sondern daran, dass es strukturell nicht möglich ist, dass Medikamente erstattet werden, bis die Politik tätig wird und eine Gesetzesänderung bewirkt.
Johanna: Abgesehen davon, dass Bianca mich dazu überredet hat, sind es viele kleine, wiederkehrende Szenen: Die Patientin, der in der Praxis zuerst „Nehmen Sie ab“ gesagt wird, der abgelehnte Kostenantrag trotz klarer Indikation, der OP-Termin, der vom Gewicht abhängig gemacht wird, oder das Rezept, das in der Apotheke kommentiert wird. Oder uninformierte Kommentare bei Fachtagungen. Im Längsschnitt ergibt sich daraus ein Systembild: Es geht nicht um individuelles Versagen, sondern um institutionalisierte Barrieren. Diese Summe war der Auslöser. Und vielleicht auch der Austausch mit Bianca, um den Frust, den diese Geschichten in einem auslösen, abzubauen. Bianca hatte dann die Idee, das aufzuarbeiten.
Euer Buch ist auch eine feministische Streitschrift: Beim Lesen stellen wir fest, dass Fettfeindlichkeit auch im Zusammenhang mit anderen Faktoren betrachtet werden muss. Wie hängen Fettfeindlichkeit und Diskriminierung im Gesundheitssystem mit anderen Diskriminierungsformen wie Misogynie, Rassismus und Klassismus zusammen?
Bianca-Karla: Diese Dinge haben wir selber beim Schreiben des Buches festgestellt, nachdem wir uns vertieft mit Fettfeindlichkeit beschäftigt haben. Fettfeindlichkeit ist ein Intersektionalitätsproblem. Frauenkörper werden stärker normiert und moralisiert, Reproduktion, Sexualität und Erscheinungsbild sind überproportional vom Patriarchat reguliert.
Johanna: Historische und aktuelle Stereotype koppeln „Dicksein“ an „Unkontrolliertheit“ und „Wertlosigkeit“ – mit realen Folgen für Diagnostik und Therapie. Rassismus spielt hier auch eine große Rolle, hinzu kommt Klassismus. Wer weniger Zeit, Geld, Wohnraum und Pausen hat, hat schlechtere Voraussetzungen für Gesundheit und weniger Zugang zu Versorgung, und wer mehrere dieser Merkmale „mitbringt“, erlebt bei gleicher medizinischer Ausgangslage häufiger eine schlechtere Behandlung. Und allein bei der Beantwortung dieser Frage ist es schwer, kurz und prägnant zu bleiben. Die öffentliche Kritik beziehungsweise Häme an der Körperform unserer Gesundheitsministerin hat mich zum Beispiel wirklich schockiert.
Wie können wir verlernen, Gewicht unmittelbar mit Bewertung oder einer unterstellten Idee von Gesundheit (die zudem moralisch konnotiert ist) zu verbinden?
Bianca-Karla: Das ist schwer. Denn wir bekommen es so „eingetrichtert“ und hinterfragen es kaum. Wir haben die Chance, Kindern beizubringen, dass das Menschsein in verschiedenen Körperformen erlebt wird und, dass das an sich etwas Schönes ist.
Johanna: Ich glaube, prinzipiell zu bewerten, ist zutiefst menschlich, das passiert sehr rasch und fast immer unterbewusst. Aber wir sollten uns dann zur Ordnung rufen und das korrekt einordnen, und hier spielen unsere Sprache, aber auch Aufklärung und Bildung eine große Rolle. Es geht nicht darum, „politically correct“ zu sein, viel eher bestimmt Sprache unser Denken, und das Wort „dick“ soll nicht mit moralischer Wertung zusammenhängen. Außerdem sagt uns die Wissenschaft, dass Adipositas als neuro-metabolische Erkrankung zu begreifen ist; die Diagnose ist keine „Blickdiagnose“ mehr. Wir sollten an Evidenz glauben und nicht an irgendwelche Social Media Mythen.
Bianca: Je mehr wir die Evidenz zu Stigmafolgen kennen, können wir verstehen, dass der Fehler im gesellschaftlichen Umgang Spuren bei Betroffenen hinterlässt.
Was muss sich ganz konkret in den Strukturen im Alltag und in der Medizin, in der Ausbildung, im Umgang im Gesundheitswesen ändern, damit ein Bewusstsein für die häufig lebensgefährliche Diskriminierung von Mehrgewichtigen entsteht und mehrgewichtige Menschen respektiert und ernstgenommen werden?
Bianca-Karla: Wer A sagt muss auch B sagen, wer Verhaltensprävention einfordert, muss auch Verhältnisprävention ermöglichen. Wir brauchen strukturelle Veränderungen statt moralischer Appelle. Das beginnt eben bei der Verhältnisprävention: Es braucht verbindliche Standards für die Verpflegung in Schulen und Kindergärten, eine klare Lebensmittelkennzeichnung und eine Beschränkung von Werbung für Kinder. Ziel ist es, den gesunden Weg zum einfachsten zu machen. Gleichzeitig muss Adipositas endlich als chronische Erkrankung anerkannt werden, wie es in Großbritannien bereits der Fall ist, damit Therapieprogramme und deren Erstattung selbstverständlich werden. Es ist unhaltbar, dass Betroffene die Therapiekosten selbst tragen müssen, während andere chronische Krankheiten vollständig abgedeckt sind.
Johanna: In der Klinik sehe ich täglich, wie sehr Strukturen Menschen ausschließen. Blutdruckmanschetten, Betten und Stühle sind für den „Durchschnittskörper“ konzipiert – nicht für die Realität. Hinzu kommt die Ausbildung: In der Schule wird Wissen über gesunde Ernährung und Bewegung nicht vermittelt. Ärzt*innen lernen kaum, Adipositas evidenzbasiert und ohne Stigma zu behandeln. Wir brauchen die Aufnahme der Adipositas-Medizin in der ärztlichen Ausbildung und im Medizinstudium. Auch rechtlich muss sich etwas ändern: Eine Verankerung von Gewicht als Diskriminierungsmerkmal im Gleichbehandlungsgesetz wäre ein klares Signal. Auf Systemebene sind Disease-Management-Programme für Adipositas, interdisziplinäre Zentren, ein flächendeckender Zugang zu Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie sowie zu wirksamen Medikamenten notwendig. Ich bin auch ein großer Fan der Eigenverantwortung und der mündigen Patientin oder des mündigen Patienten, aber man muss die Menschen ebenso dazu befähigen. Das geht nur durch Steigerung der Gesundheitskompetenz und die Möglichkeit von suffizienten Therapien für Betroffene – eben nicht nur für Betroffene, die sich Therapien auch leisten können. Und wenn man jetzt als Argument die angespannte finanzielle Lage anführt, so muss man ganz klar sagen, dass es zahlreiche Studien gibt, die belegen, wie rasch sich Adipositastherapie auch für den Staat „rechnet“.
Beide: Würde darf keine Option sein, sondern muss zum Standard werden – im Alltag, in der Medizin und in der Politik. Und das nicht nur, wenn es um Themen wie assistierten Suizid geht.
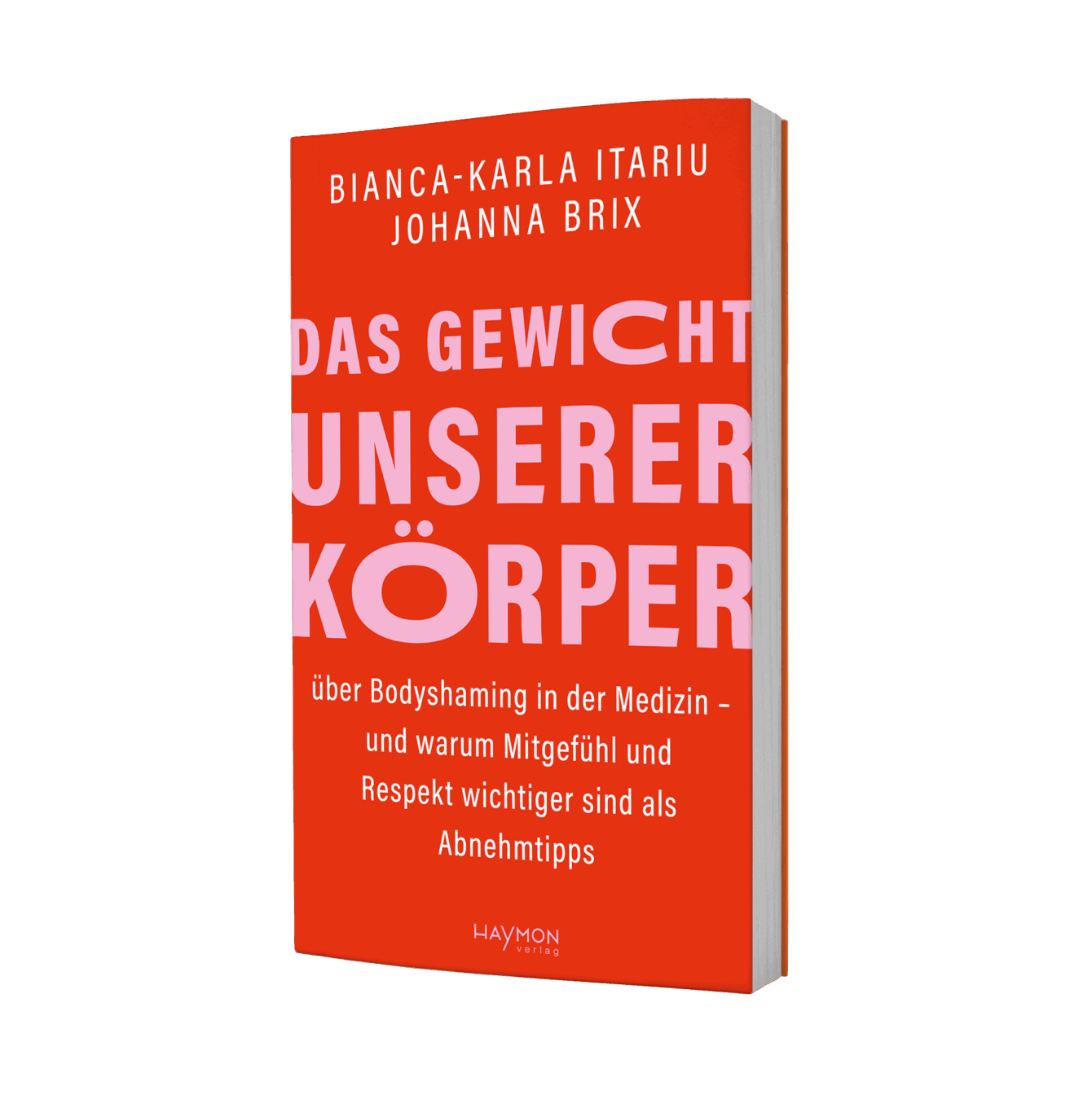
Über Bodyshaming, die historische Entwicklung von Körperidealen und eine notwendige Revolution des Gesundheitssystems
Die Autorinnen und Ärztinnen kämpfen für geeignete medizinische Behandlungen, für Anerkennung und die Zerschlagung von Fettfeindlichkeit. Für einen würdevollen Umgang, der einer humanistisch-solidarischen Gesellschaft angemessen ist. Sie beschreiben Lösungswege, Ideen zur Veränderung und Visionen, machen deutlich, warum Respekt und Mitgefühl wichtiger sind als Abnehmtipps. Denn: Ein Gesundheitssystem in Sozialstaaten darf kein Gesundheitssystem sein, in dem mehrgewichtige Personen, Frauen oder auch arme Menschen ausgeschlossen werden. Dieses Buch ist eine feministische Streitschrift, die besagt: Schluss mit der Tabuzone Fett!
Erhältlich online und überall, wo es Bücher gibt.