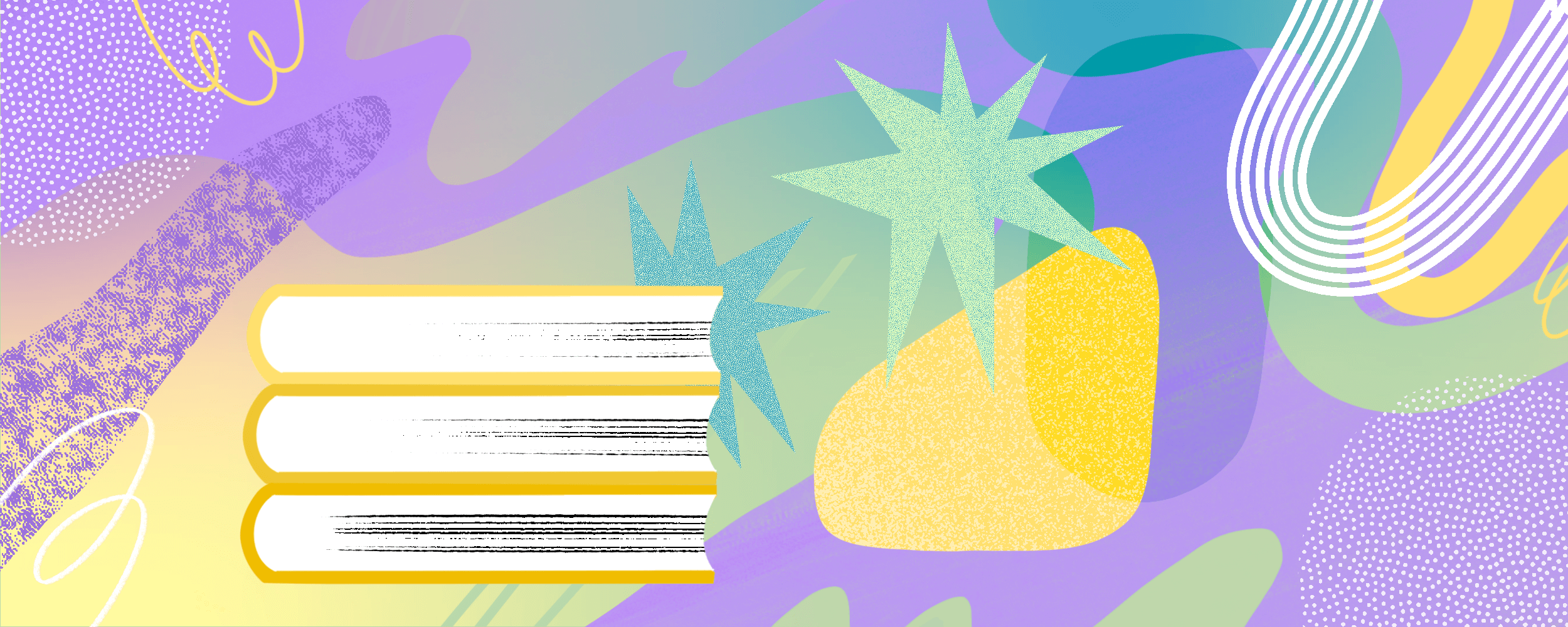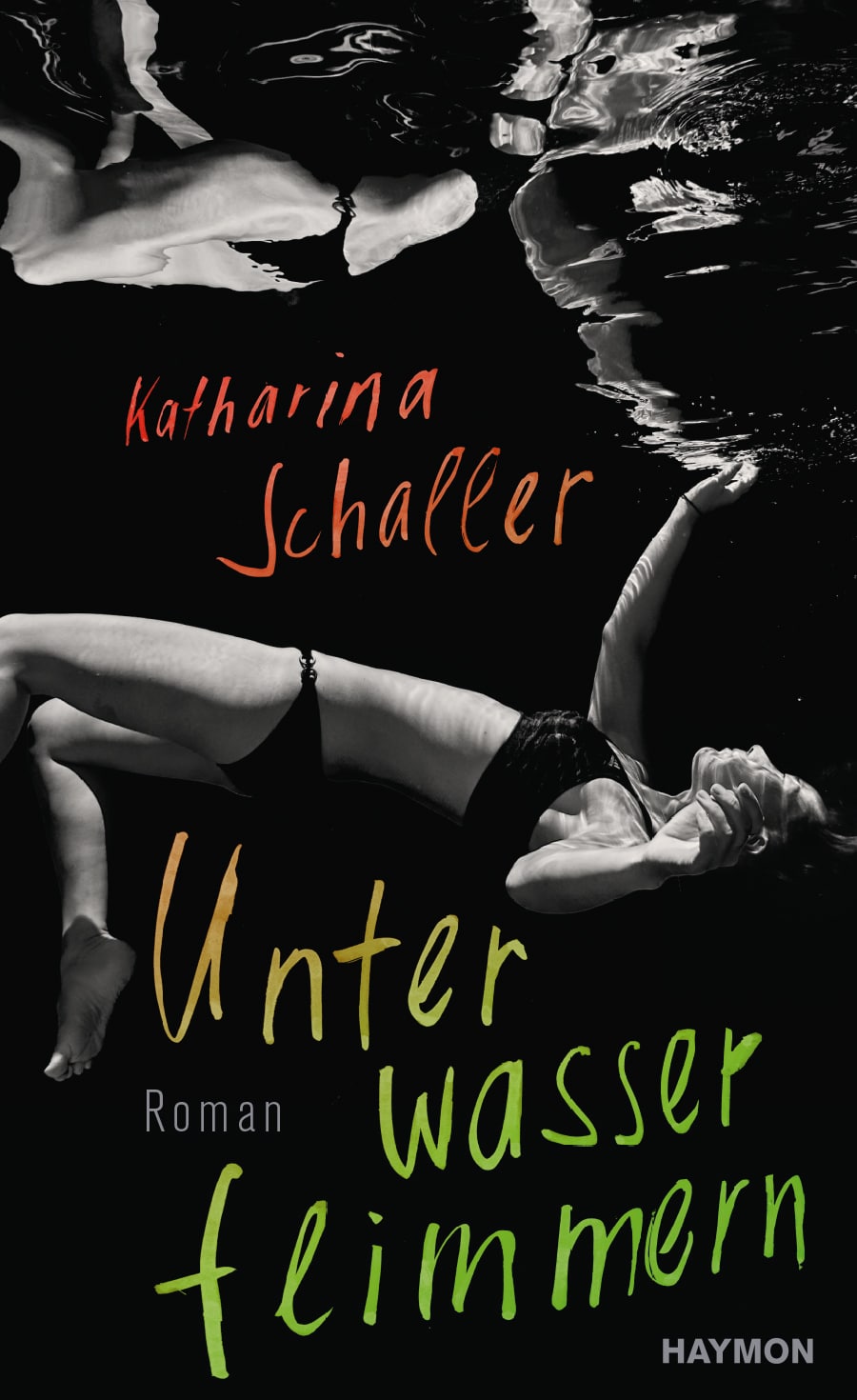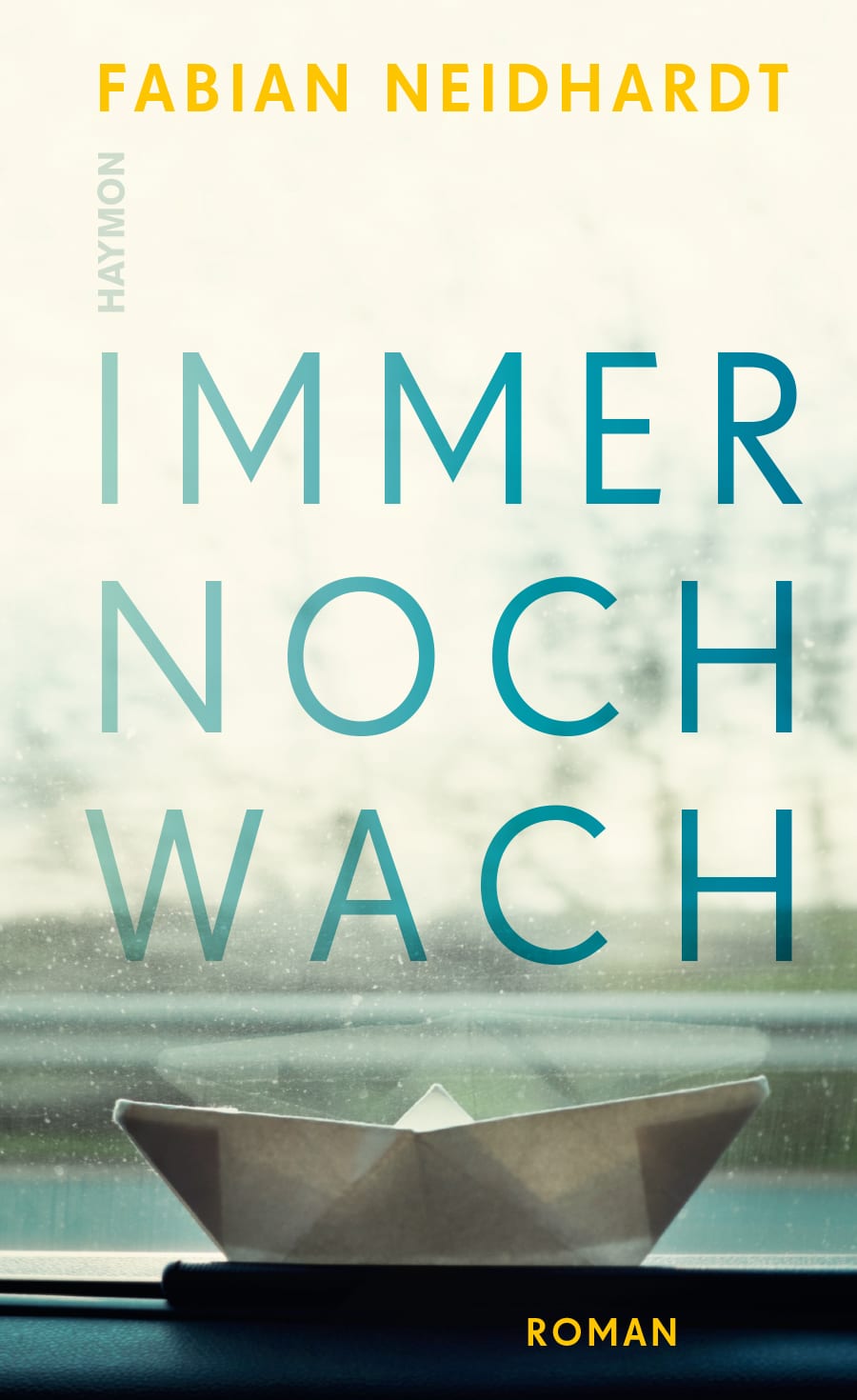Coming of Age in Österreich: Drei Haymon-Autor*innen im Interview
Ach, Kindheitserinnerungen: Mit dem Postbus ewig in die Schule brauchen, Jollyeis im Freibad im Sommer genießen, Skifahren lernen (bevor man überhaupt Lesen und Schreiben kann) … Viele Erinnerungen teilen wir mit anderen, viele sind ganz unterschiedlich: Es gibt unzählige verschiedene Lebenswelten in diesem Land, so viele einzigartige Kindheiten und Coming-of-Age-Erlebnisse in Österreich. Vieles, was fast schon als kollektives Kindheitsgedächtnis zählt, ist nur eine Seite, eine Perspektive. Jede*r hat schöne, aber auch schwere Erinnerungen. Vielleicht auch welche, an die man nicht so gern zurückdenkt oder auch erst als Erwachsene*r richtig einordnen kann. Was hat sich seitdem geändert, was ist genau gleichgeblieben? Was vermisst man – und was gar nicht? Im Interview erzählen Nada Chekh, Herbert Dutzler und Precious Chiebonam Nnebedum vom Eiskunstlaufen und Comiclesen, von den Süßigkeiten, die unsere uns Eltern niemals erlaubt hätten (hätten sie davon gewusst) und von den Lektionen, die sie erst heute verstehen gelernt haben …

Nada Chekh ist kritisch, laut und ehrlich. In den 1990ern und 2000ern wuchs sie im Wiener Gemeindebau auf. Heute schreibt sie als Journalistin darüber, was die multiethnische Community in Österreich bewegt.
Foto: © Zoe Opratko
Was ist deine prägendste oder präsenteste Kindheitserinnerung?
Nada Chekh: Es gibt viele Erinnerungen aus meiner Kindheit, die mir – je nach Gefühlslage – in den Kopf kommen. Als ich zwölf Jahre alt war, wollte ich unbedingt Eiskunstläuferin werden. Mich in einem Verein anzumelden, konnten sich meine Eltern damals nicht leisten, aber dafür hat mein Vater mich mehrmals die Woche zu einem Eislaufplatz gebracht, wo ich nach der Schule abends zwei Stunden lang üben konnte. Einmal hatte ich den ganzen Platz im Außenbereich für mich alleine, und es schneite gerade so richtig dicke Flocken, und der Himmel war ganz erleuchtet davon, obwohl die Sonne bereits vor Stunden untergegangen war. Ich drehte ganz glückselig ein paar einfache Pirouetten vor mich hin und spürte so eine Ruhe in mir, wie selten zuvor. Lustigerweise erinnert mich der Song „Blue Dress“ von Depeche Mode an diesen Moment, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob dieses Lied damals über die Anlage gespielt wurde.
Herbert Dutzler: Wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern, fallen mir fast nur Szenen im Freien ein, wo ich mit anderen Kindern zusammen war. Meist beim Radfahren, Fußball spielen oder einfach nur im riesigen Haselnussbusch herumhängen. Ein besonderer Nachmittag sticht aber heraus: Ich war in Bad Aussee bei einem Schulfreund zu Besuch, der eine riesige Sammlung von Micky-Maus-Heften hatte. Ich bin den ganzen Nachmittag auf der Veranda gesessen, der Regen rauschte durch die Bäume im Garten, und ich war völlig in die Comics vertieft.
Precious Chiebonam Nnebedum: Die präsenteste Erinnerung, die ich an meine Kindheit habe, muss mein siebter Geburtstag sein. Das war das Jahr, in dem ich jeden einzelnen Tag genossen habe, und es scheint wirklich sehr, sehr bedeutsam in meiner Erinnerung zu sein. Um ehrlich zu sein, habe ich an dem Tag nicht viel gemacht, aber eine Sache, die ich sehr lebhaft erinnere, ist, dass ich zu Hause einen kleinen Kuchen mit meinen Cous*inen gegessen habe, die zu Besuch gekommen waren. Danach habe ich ein bisschen Geld von der Familie bekommen, und es war nicht einmal viel, aber für eine Siebenjährige war ich reich. Ich bin damit mit meinen Cous*inen zum Laden an der Ecke gegangen und habe Süßigkeiten und Milchpulver gekauft, denn das war für uns damals eine Delikatesse, R.I.P. an unsere Zähne.
Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ich habe auch eine Geburtstagskarte bekommen. Es muss eine rosa und blau glitzernde Geburtstagskarte gewesen sein, ich habe vergessen, von wem. Und ich war einfach glücklich. Es ist nicht viel passiert, aber aus irgendeinem Grund wusste ich, dass dieses Alter der Höhepunkt war. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh Mann, Erwachsensein ist eine Abzocke, erinnere ich mich an mein siebtes Jahr zurück. Denn damals war ich einfach am glücklichsten.

Herbert Dutzler ist in den 1960er Jahren in Altaussee im Salzkammergut großgeworden, heute schreibt er Bestseller.
Foto: © Haymon Verlag / Fotowerk Aichner
Was waren die größten Kämpfe, die du als junge*r Erwachsene*r ausfechten musstest?
Precious Chiebonam Nnebedum: Ich bin sehr dankbar und erkenne an, dass ich zu den wenigen POC in Österreich gehöre, die das Privileg hatten, in sehr jungen Jahren die Möglichkeit geboten zu bekommen, einflussreich zu werden und eine beeindruckende Liste von Erfolgen anzuhäufen. So sehr ich weiß, dass dies eine lobenswerte Tatsache ist, ging es auch mit vielen Unsicherheiten, Zweifeln und Fragen einher. Eine der größten hatte definitiv damit zu tun, ob ich überhaupt das Recht hatte, in bestimmten Räumen zu sein, in die ich hineinging. Ich betrat politische Räume, ich betrat leitende, autoritäre Räume und Rollen, und jedes Mal hinterfragte ich die Tatsache, ob es einer jungen Schwarzen Frau erlaubt war, dort zu sein, ob sie dort sein sollte und ob sie überhaupt etwas Wertvolles beizutragen hatte oder ob sie einfach nur eine Beobachterin sein durfte. Ich denke, das Schwierige daran war, dass mir klar wurde, dass das nur in meinem Kopf war, aber aus irgendeinem Grund war es dennoch sehr schwer, diese Hürde zu überwinden und einfach zu handeln.
Ich muss wirklich Anerkennung zollen, wo Anerkennung gebührt, und offenlegen, dass es nur durch die Gnade Gottes war, dass ich in den meisten Fällen tatsächlich gehandelt und gesprochen habe. Ich habe eine Einstellung entwickelt, die besagt: „Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht ich, wer dann?“ Ich könnte nie sagen, dass es allein meine Leistung war. Ich verdanke das dem Support und Rückhalt von den Menschen um mich herum – meinen Geschwistern, meiner Familie, meinem Partner, meiner Community. Menschen, die Dinge in meinem Leben gesehen und über mich gesprochen haben, so oft, dass ich einfach daran glauben musste. Ich musste daran glauben, um weiterzukommen, und letztendlich habe ich das getan.
Herbert Dutzler: Da ging es vor allem um Kleidung und Haare. Meine Eltern hatten wenig Verständnis dafür, dass es unbedingt Jeans sein mussten, und noch dazu welche einer bestimmten Marke (Levis). Später mussten Jeans her, die einen V-Cut am Knie hatten, der irgendwann in den Siebzigern ein modisches Must-have war. Und unten mussten sie so weit ausgestellt sein, dass man die Schuhspitzen drinnen verstecken konnte. Die Haare waren auch ein ständiges Thema. Sie mussten zumindest so lang sein, dass man sie unterhalb der Ohren zusammenführen konnte, sonst war man komplett und völlig out. „So stellt sich der Bub nicht unter den Christbaum!“, hieß es, wenn die Frisur für die Feiertage dem Vater unpassend erschien.
Nada Chekh: Ich glaube, dass im Allgemeinen der Kampf um meine Privatsphäre der schwierigste in meiner Jugend war. Also nicht nur räumlich – es gab in unserer Wohnung nur drei Schlafzimmer für fünf Kinder und meine Eltern – sondern auch persönlich. Solange man finanziell und strukturell von seiner Familie abhängig ist, gelten auch deren Regeln unter dem Dach. Je erwachsener ich wurde, desto mehr spürte ich gewisse Rollenbilder, die mir als Frau auferlegt wurden. Dazu gehörte nicht nur, keinen Kontakt zum anderen Geschlecht zu haben, sondern auch eine Unfreiheit über meinen eigenen Körper. Als Jugendliche reagierte ich sehr empfindlich und frustriert auf diese Kontrolle, das hat mich ziemlich geprägt. Ich habe mich zudem nie mit meiner Religion wirklich identifiziert, was mich eine Stufe weiter von meiner Familie, meiner Muttersprache und den Sitten entfremdet hat.

Precious Chiebonam Nnebedum wuchs in Nigeria und Österreich auf. Nachdem sie zahlreiche Poetry-Slam-Bühnen gestürmt hat, lebt die Lyrikerin und Musikerin heute in Wien.
Foto: © Ella Börner
Gibt es etwas, das dir deine Eltern früher vermittelt haben, das für dich heute noch sehr wichtig ist? Oder gibt es vielleicht Haltungen, Werte, die dir deine Eltern mitgegeben haben, die du irgendwann beim Älterwerden verworfen hast?
Herbert Dutzler: Meine Mutter hat mich ab der ersten Klasse Volksschule wöchentlich in die Bibliothek mitgenommen, wofür ich ihr heute noch dankbar bin. Das Regal mit den Büchern für Leseanfänger war für mich die reinste Wunderkammer, und ich hatte alle Bücher darin noch vor dem Ende der ersten Klasse durch. Die politische Einstellung meiner Eltern und ihre Haltung fremden Menschen gegenüber ist ein Wert, den ich mit etwa 16 endgültig verworfen habe. Ihre Haltung war von distanzloser Verherrlichung einer schrecklichen Vergangenheit geprägt, was später auch zu gröberen Auseinandersetzungen geführt hat, als mein politisches Interesse erwachte und in eine völlig andere Richtung ging.
Nada Chekh: Heute finde ich es sehr schade, dass ich mich in meiner zweiten Muttersprache Arabisch niemals wohlgefühlt habe, obwohl meine Eltern mehrere Offensiven dazu gestartet haben, dass ich richtig lesen und schreiben lerne. Leider hat es mit Diktaten von Koransuren und Gebeten beim Sprachunterricht kaum funktioniert, weil ich nicht religiös war. Das ist so eine Sache, die ich meinen Eltern beim Aufwachsen vorgeworfen habe – dass sie mir die arabische Sprache vor allem über die islamische Religion näherbringen wollten, obwohl ich mich sehr heftig dagegen gesträubt habe. Auch über die Tatsache, dass die Bekannten meiner Eltern sich ohne Weiteres über meinen deutschen Akzent lustig machen konnten, habe ich mich lange geärgert. Mittlerweile sehe ich das gelassener, womöglich weil ich stattdessen Russisch gelernt habe und zuhause mit meinem Mann eine quasi „neue Muttersprache“ spreche, die ich an meine Kinder weitergeben würde, sollte ich eines Tages welche haben.
Precious Chiebonam Nnebedum: Eine der vielen Haltungen, die ich von meinen Eltern übernommen habe, ist die „offene-Haustür-Regel“. Unser Zuhause war immer offen, für jeden, seien es Cous*inen, die kamen und übernachteten. Wir hatten Tanten, Onkel, wir hatten Freund*innen, die kamen und übernachteten. Es wurde nie wirklich in Frage gestellt, ob wir genug zu bieten und teilen hatten, es war einfach die Tatsache klar, dass Menschen Bedarf hatten und wir immer bereit waren, zu helfen. Das ist etwas, dem ich auch heute noch folge. Immer wenn Freund*innen oder Familie oder wer auch immer in meiner Nähe sind, ist meine erste Aussage: „Hast du einen Platz zum Schlafen? Möchtest du bei mir bleiben?“ „Möchtest du abhängen? Ich kann für dich kochen. Du kannst kommen und so lange bleiben, wie du möchtest.“ Das ist mir zuallererst von meinen Eltern eingeprägt worden, bevor es später von Freund*innen und meiner Community verstärkt wurde.
Es gibt jedoch auch bestimmte Dinge, die ich von meinen Eltern gelernt habe und von denen ich mich nun langsam distanziere. Eines davon wäre die Vorstellung, dass Kreativität oder der Wunsch, kreativ zu arbeiten und eine Karriere daraus zu machen, definitiv in einer Sackgasse enden wird. Mir wurde tausendmal gesagt: „Ja, du kannst schreiben, du kannst auftreten, du kannst singen, du kannst all das tun. Aber du brauchst einen richtigen Job. Du brauchst einen richtigen Abschluss.“ Ehrlich gesagt sehe ich die Wahrheit in dieser Angst. Aber ich weiß trotzdem, dass es so viel Potenzial gibt, wenn man die Disziplin und die Arbeit und den Aufwand investiert, um eine Karriere im kreativen Bereich zu starten und aufrechtzuerhalten. Etwas, das ich immer noch anstrebe.
Welcher Sache – das kann ein Lied, eine Fernsehsendung, eine Süßigkeit etc. sein –, die es nicht mehr gibt, träumst du heute noch hinterher?
Nada Chekh: Ui, da gibt es mehrere Sachen. Es gab in Wien ein supertolles Café namens Berfin, das ich als junge Studentin mit meiner Mutter und meinen Geschwistern gerne besucht habe. Es hatte ein wunderbares orientalisches Flair, ohne kitschig zu sein. Wir waren früher manchmal sogar mehrmals die Woche dort, haben Shisha geraucht und miteinander getratscht, da habe ich sehr schöne Erinnerungen daran. Und das erste (und letzte) Mal, als ich in Ägypten war, war mit sechs Jahren. Ich kann mich gut an den Strand in Alexandria erinnern, wo es Verkäufer gab, die Freska – so eine Art Honigwaffel – verkauften. Als Kind habe ich diese Süßigkeit geliebt, aber eben nur bei diesem einen Besuch gegessen. Bis heute denke ich an diese großen, runden Waffeln und frage mich öfter, ob ich sie jemals wieder essen werde.
Herbert Dutzler: Die großen Samstagabendshows, die es heute kaum mehr gibt, waren absolute Straßenfeger, und die ganze Familie saß gebannt vor dem Fernseher. Die beliebteste von allen war „Einer wird gewinnen“ mit Hans Joachim Kulenkampff. Und den habe ich sogar einmal auf dem Balkon seines Pensionszimmers in Bad Aussee gesehen (von unserer Terrasse aus). Das war eine echte Sensation. Allerdings gibt es die meisten dieser Shows auch heute noch zu sehen – Youtube vergisst nichts!
Precious Chiebonam Nnebedum: Definitiv die Fernsehsendung: „The Grim Adventures of Billy and Mandy“ aus meiner Kindheit!