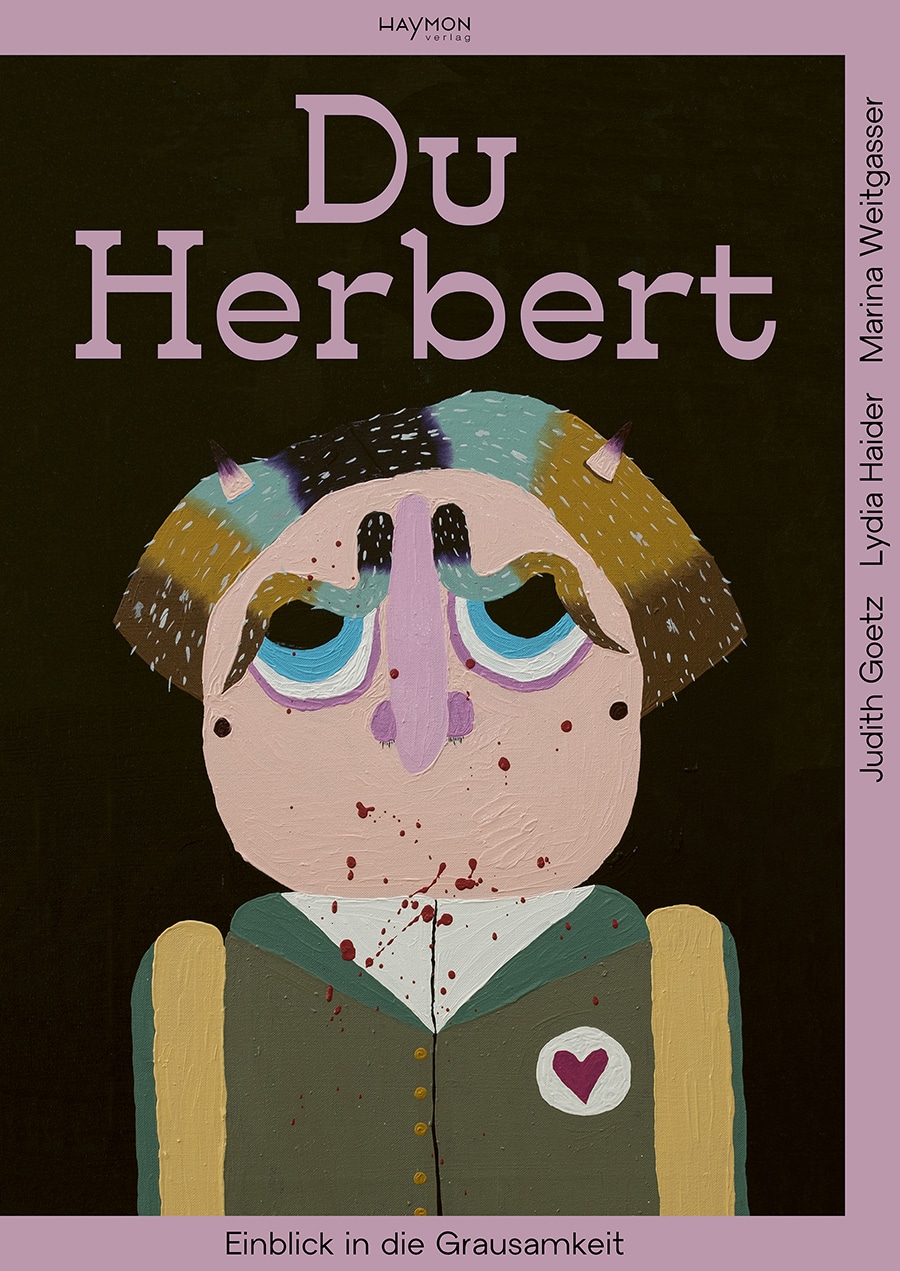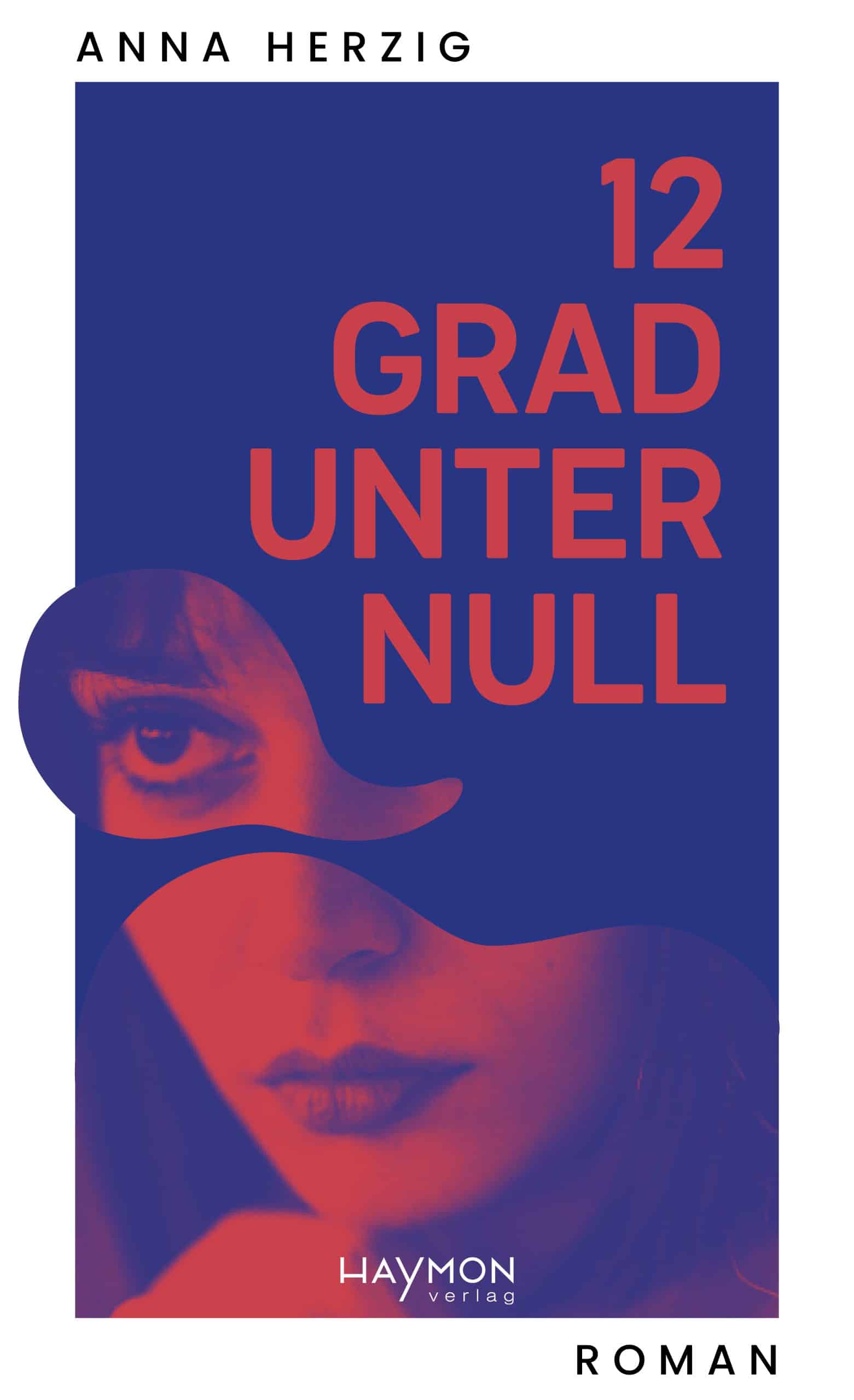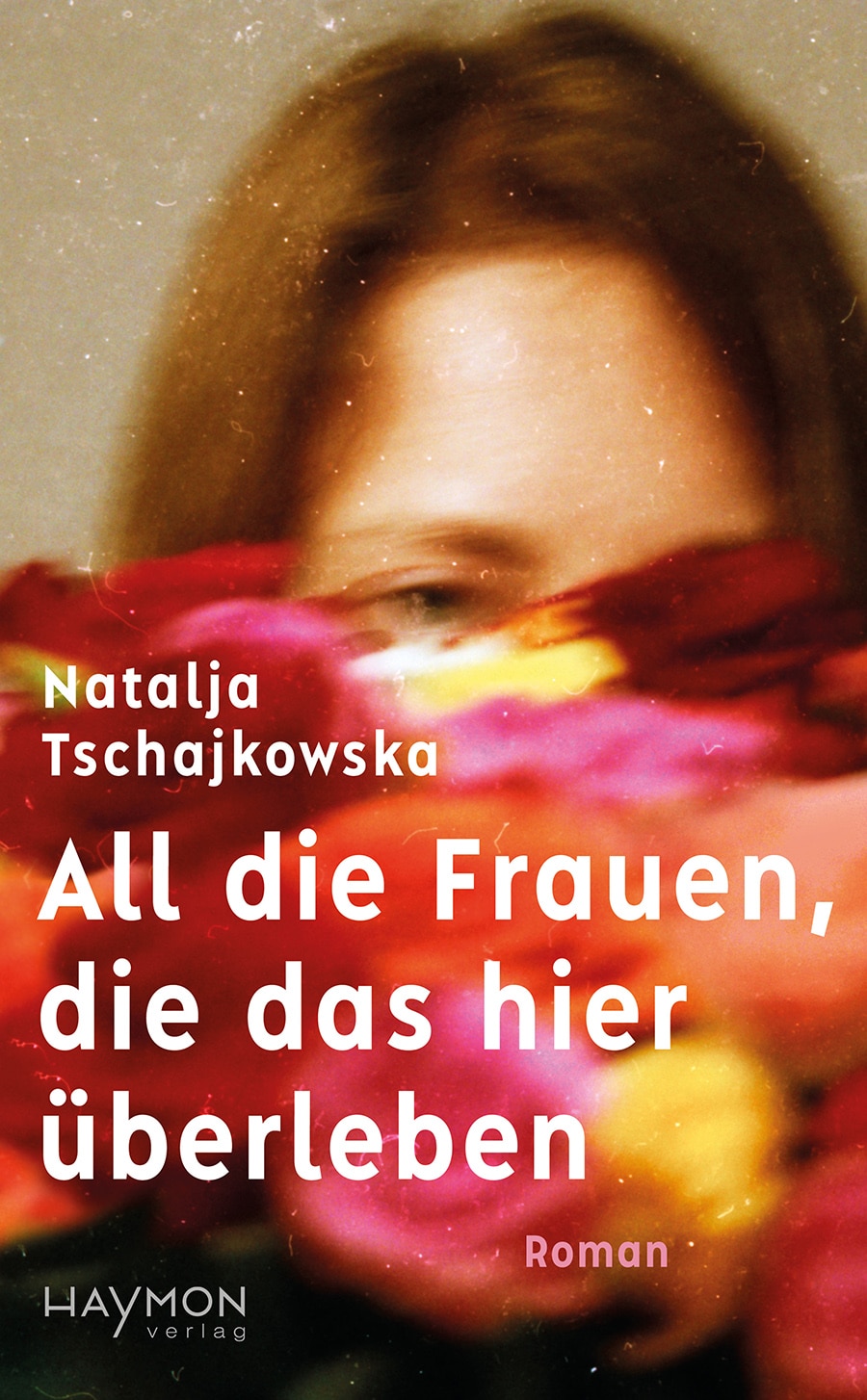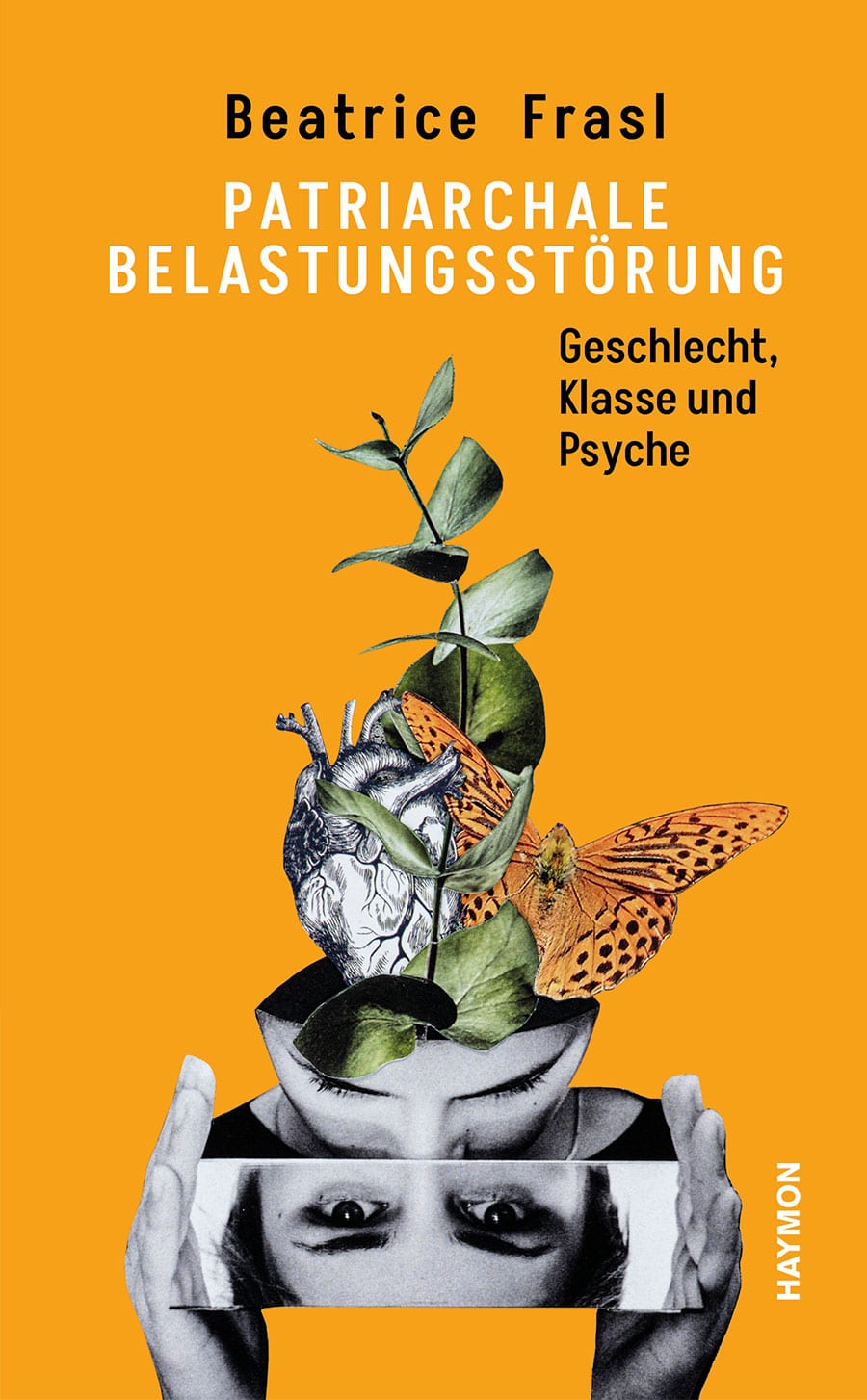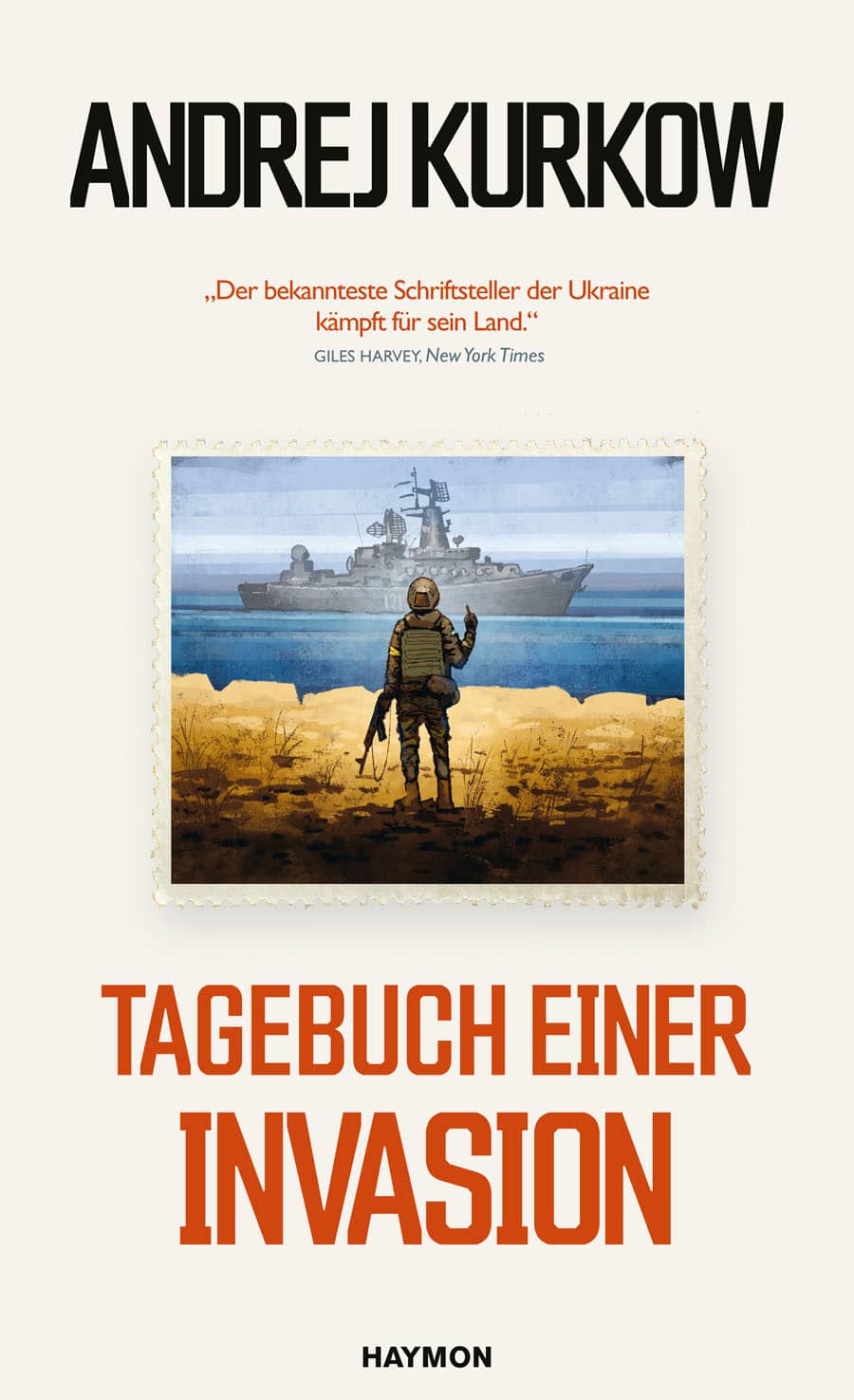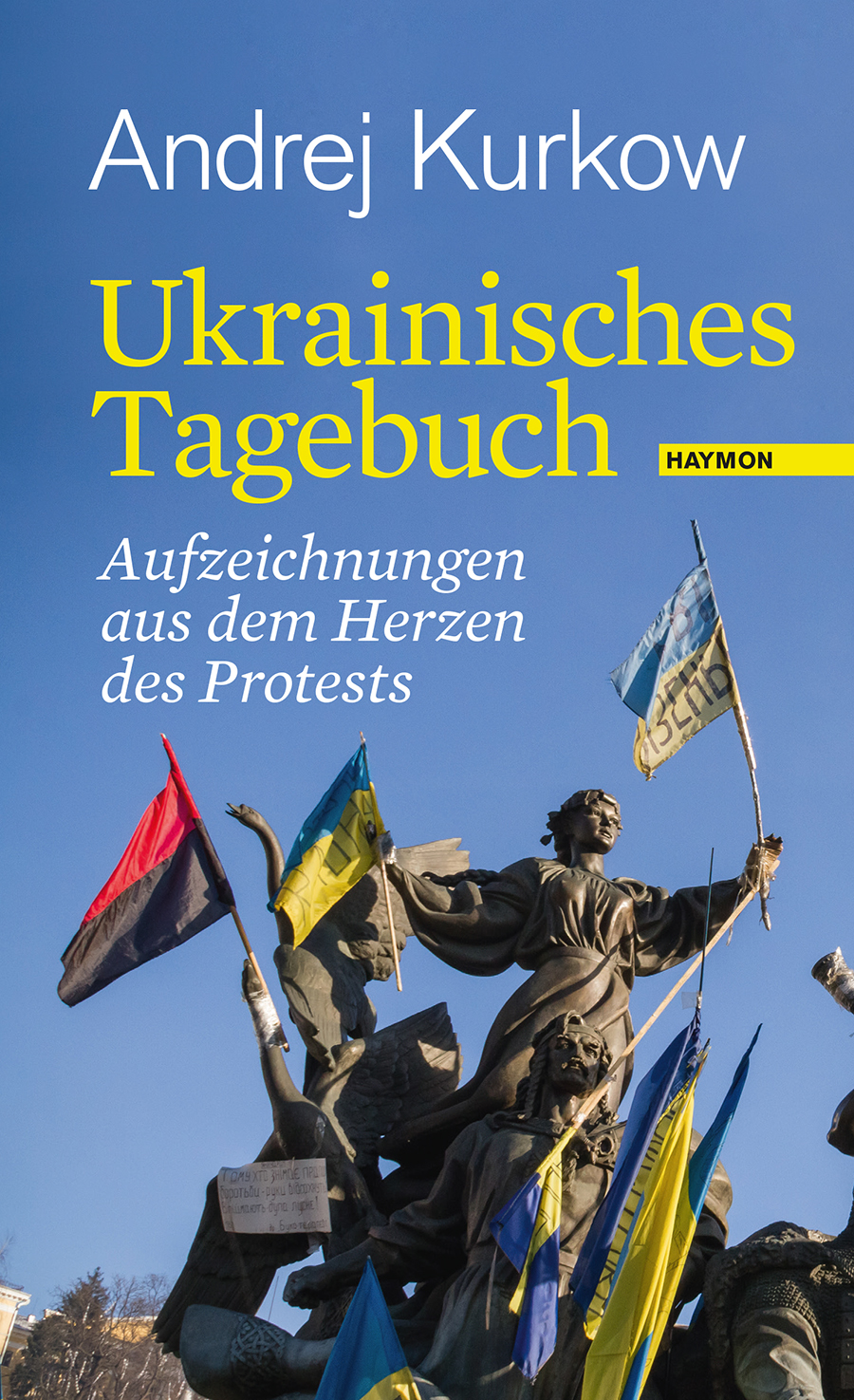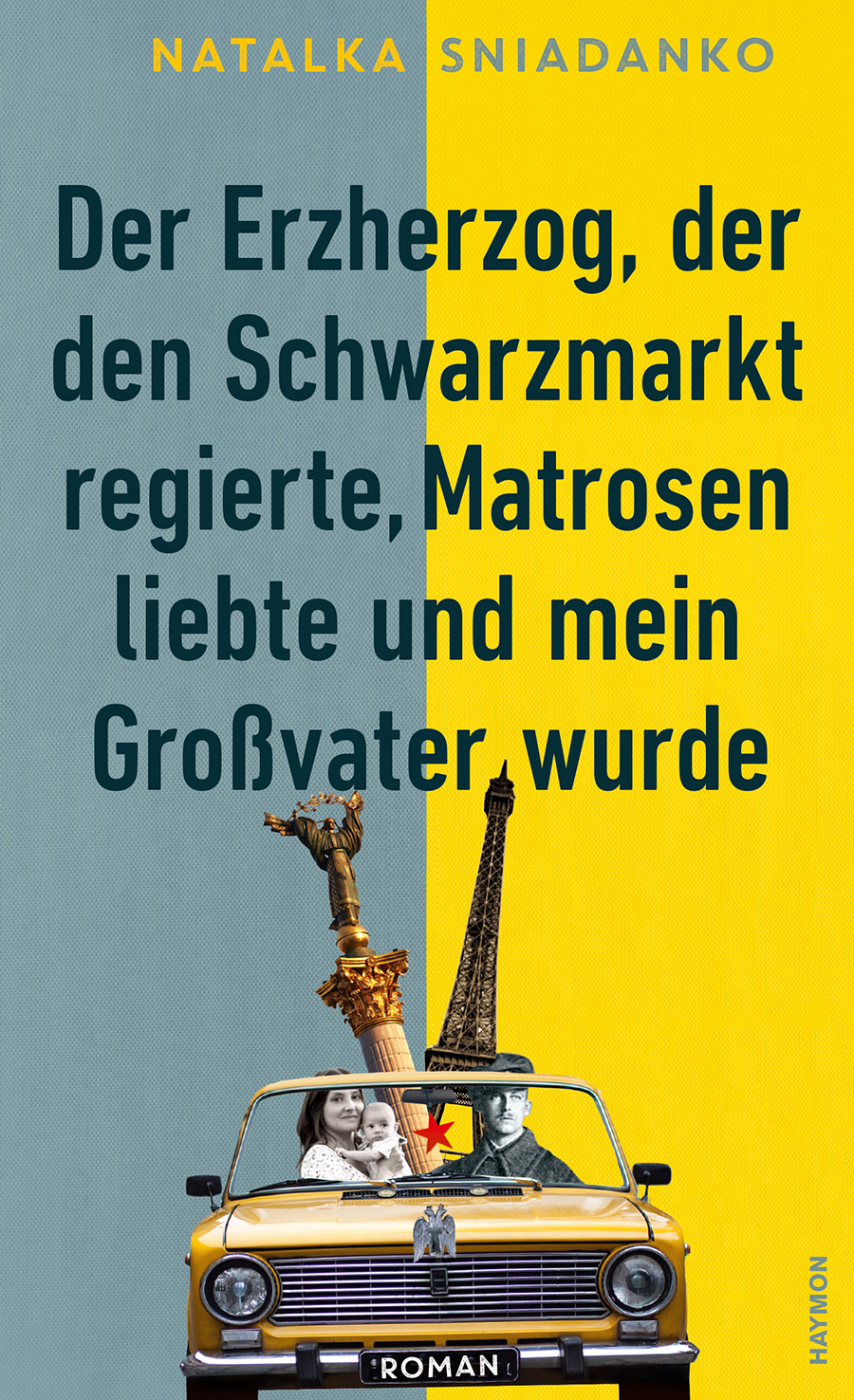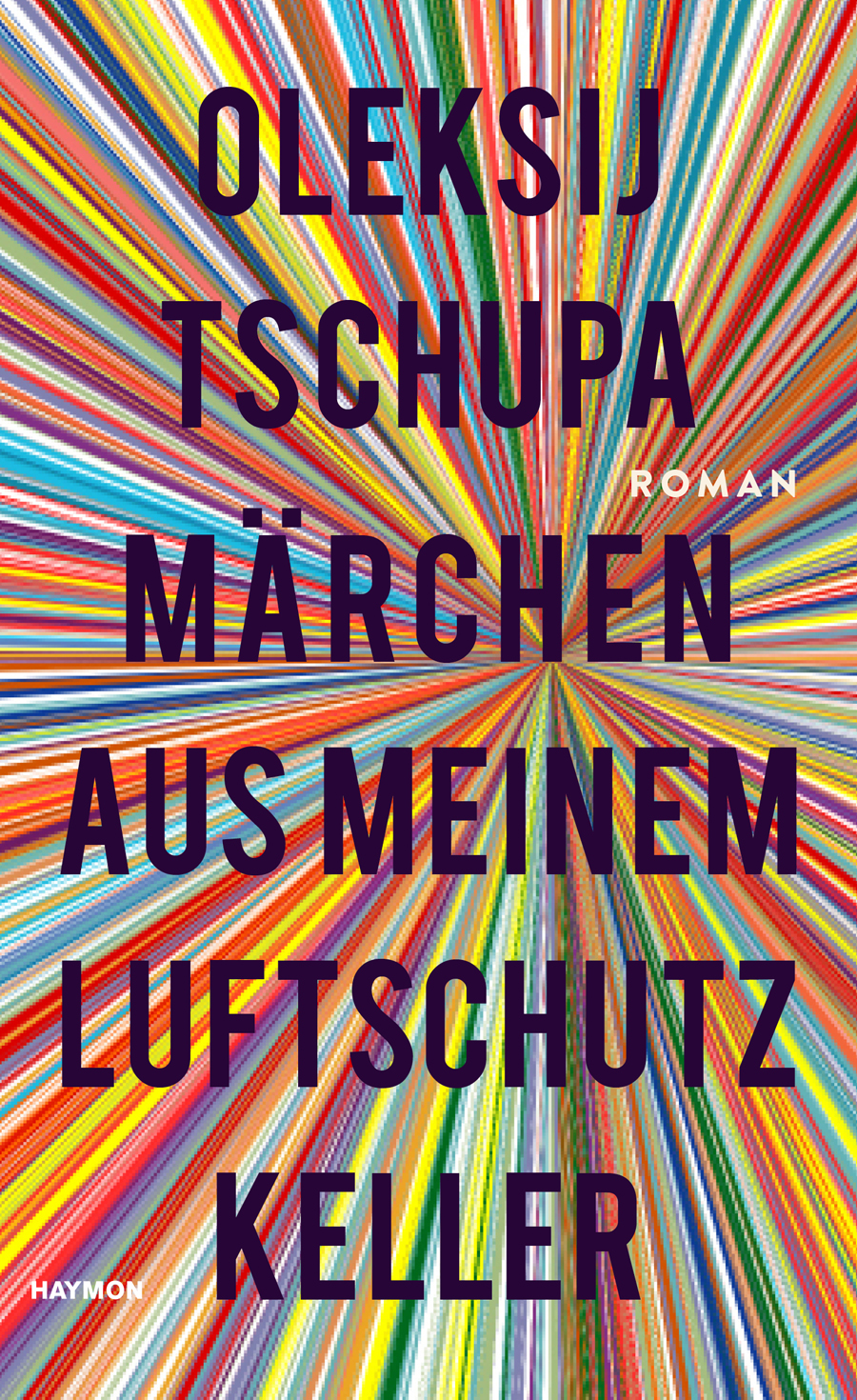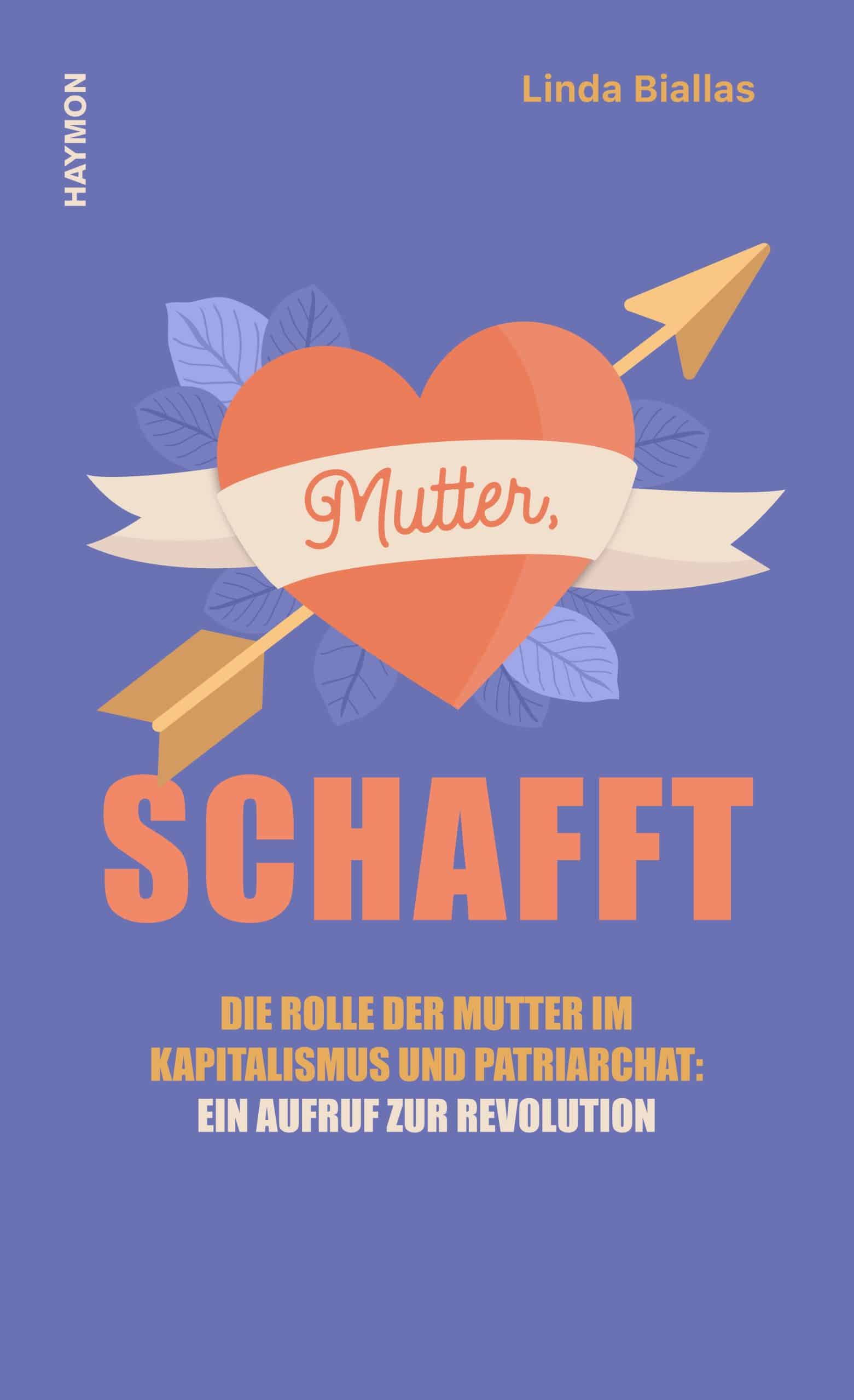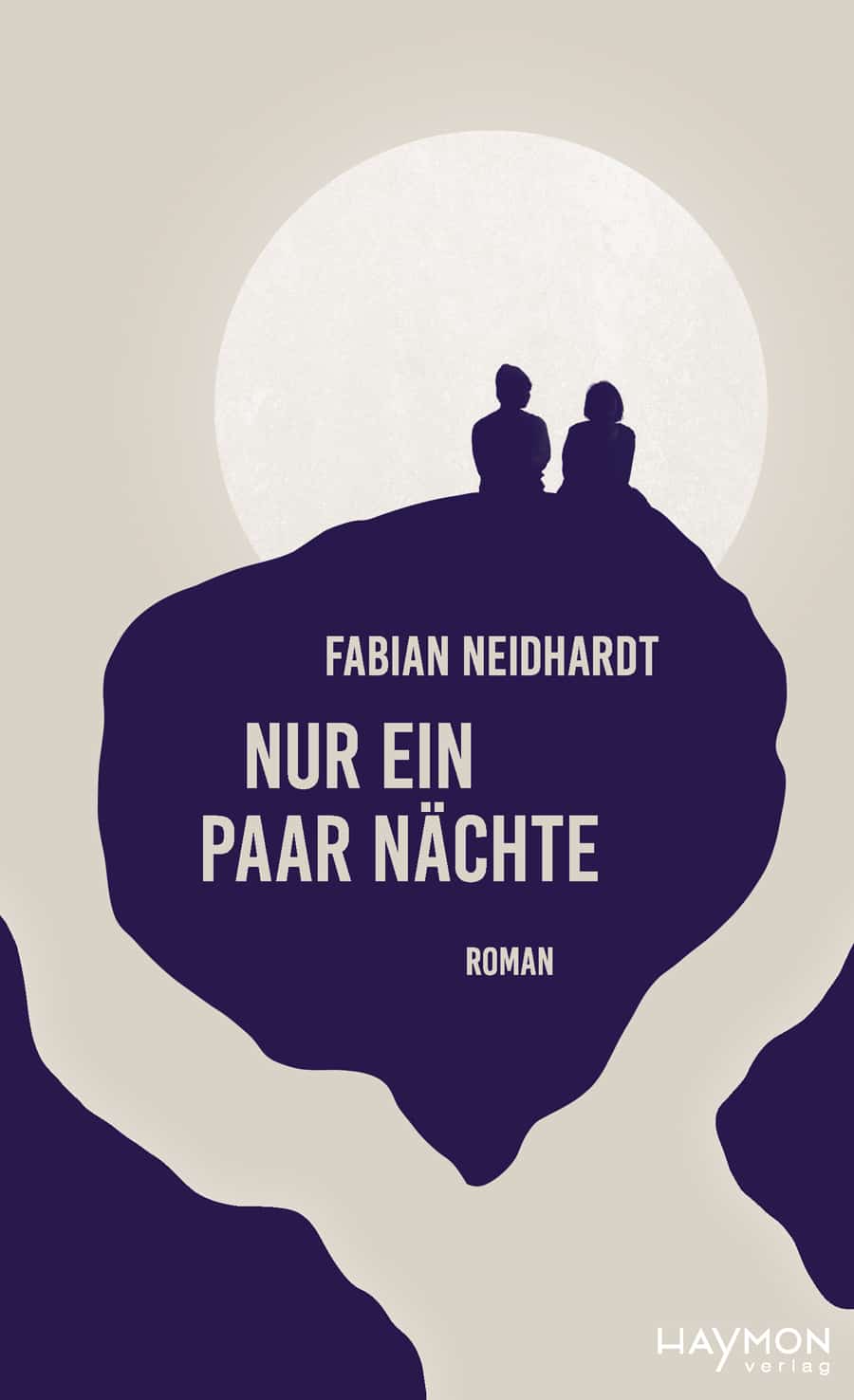Leseprobe aus „Du Herbert“ von Judith Goetz, Lydia Haider und Marina Weitgasser
Eine Komposition männlicher Gewalt: Im Jahr 2020 gab es auf orf.at über 450 Berichte über Gewalt von Männern. Die Zahl scheint hoch, doch umfasst sie längst nicht alle Taten. 450 Screenshots, die als Ausgangspunkt für „Du Herbert“ dienen – eine Auseinandersetzung mit der Grausamkeit, die den gewalttätigen Handlungen zugrunde liegt: Männlichkeit. Bereits in der Einleitung zum Buch trifft uns die grausame Realität wie ein Schlag in die Magengrube. Einmal mehr. Judith Goetz, Lydia Haider und Marina Weitgasser haben die Normalität männlicher Gewalt in Kunst verwandelt, die nicht mehr loslässt. Literatur, Wissenschaft und Beweisführung vereinen sich und machen deutlich: Die Auswirkungen von Männlichkeit sind keine Minute länger erträglich.
Anleitung zur Grausamkeit!
Männliche Gewalt ist allgegenwärtig. Ob in Beziehungen, im Berufsleben, an öffentlichen Orten oder in dunklen Ecken: Es sind in der Regel Männer, die zerstören, verletzen, rauben, morden, über andere herfallen, Macht und Kontrolle ausüben und ihre langsam bröckelnde Vorherrschaft um jeden Willen verteidigen wollen. Sie stellen eine Bedrohung für sich selbst und ihre Umwelt dar, glauben sich dennoch stets im Recht und verstehen sich als Ma stab aller Dinge. So sind diese toxischen Verhaltensweisen auch Beweis dafür, dass unzählige Männer nie gelernt haben, mit Konflikten, Streit und Zurückweisung konstruktiv umzugehen und sich selbst sowie mit männlicher Sozialisation verbundene Privilegien einer kritischen Reflexion zu unterziehen.
Ein Jahr lang – 2020 – haben wir Screenshots der orf.at-Startseite (Chronik Österreich) gesammelt, um zu dokumentieren, in welcher Fülle und Rasanz die unterschiedlichsten Taten von Männern begangen werden. Sie liefern die Grundlage für die hier abgedruckte, vielschichtige Auseinandersetzung mit der Gewaltförmigkeit unterschiedlicher Männlichkeiten, die sich aus dokumentarischen, literarischen wie auch wissenschaftlichen Elementen speist und ein hybrides Text-Bild-Format entstehen ließ. Aus den Geschichten und Themen der Berichterstattung sowie der darin erwähnten Gewalttaten von Männern schuf Lydia Haider das hier vorliegende literarische Werk, das von Judith Goetz durch die Taten erklärende Fußnoten ergänzt wurde, während Marina Weitgasser die von ihr gesammelten Screenshots aufgearbeitet und im Text platziert hat.
Die rund 450 Berichte, die wir dabei zusammengetragen haben, stellen jedoch nur einen kleinen Ausschnitt aller gewalttätigen Handlungen von Männern dar, da unsere Sammlung doppelt begrenzt wurde: einerseits dadurch, welche Taten – beispielsweise über Anzeigen, polizeiliche Meldungen oder politische Skandale – überhaupt Eingang in die öffentliche Wahrnehmung fanden, und andererseits dadurch, welche Ereignisse orf.at als so relevant eingestuft hat, dass sie es auf die Startseite schafften. Die sogenannte Dunkelziffer muss folglich noch deutlich höher eingeschätzt werden.
Die Informationen, die wir aus den Beiträgen zusammengetragen haben, sind oft selektiv und spärlich. Durch die Berichterstattung finden bereits erste Interpretationen statt, und bei vielen Einordnungen handelt es sich um Spekulationen, da ausreichende Informationen oftmals fehlen. Diese Herausforderungen haben an dieser Stelle jedoch keine Bedeutung, denn letztlich sind die konkreten Taten und Täter austauschbar, weil sich ähnliche Muster immer wieder wiederholen. Entsprechend kam es im Jahr 2020 nicht nur einmal dazu, dass Burschen oder Männer aus Langeweile mit verschiedenen Waffen aus ihren Wohnungen schossen oder im stark alkoholisierten Zustand sowie unter Drogeneinfluss (zu schnell) Auto fuhren und dadurch andere Menschen verletzten oder zumindest gefährdeten. Zigfach missbrauchten Männer in diesem Jahr Kinder, Mädchen wie Burschen und Frauen sexuell, bedrohten andere Menschen – häufig mit dem Umbringen – und/oder taten ihnen Gewalt an. 31 Mal wurden Frauen von Männern ermordet, in den allermeisten Fällen kannten sich Opfer und Täter und standen entweder in einer (Liebes-)Beziehung zueinander oder hatten sich gerade getrennt. Oft sind die den Taten zugrundeliegenden Motive (noch) unbekannt, und werden diese in der Berichterstattung genannt, stehen nicht selten verharmlosende, sexistische Deutungsmuster wie Eifersucht als Begründung der Taten im Mittelpunkt. So zeigt sich wiederholt, dass Trennungen und Scheidungen die gefährlichsten Phasen im Leben von Frauen darstellen, da zahlreiche Gewalttaten gegen Frauen – auch in diesem Jahr – genau zu ebendiesen Zeitpunkten verübt wurden.
Wenngleich die häufigsten Mittel der männlichen Gewaltanwendung 2020 (Küchen-)Messer und Schusswaffen sowie körperliche Gewalt darstellten, reichten sie von einem Fondue-Spie , einem Sparstrumpf über Schwerter, Schnitzelklopfer, Golfschläger, Pfefferspray, Schraubenzieher, Macheten bis hin zu Schuhlöffeln, Lattenroststangen oder Äxten und Hundeleinen. Ebenso unterschiedlich sind die beruflichen und sozialen Hintergründe der Täter, zu denen neben (hochrangigen) Polizisten oder (Polizei-)Ärzten u.a. auch Gastwirte, Köche, Lehrer, Bankmanager, Feuerwehrmänner, Politiker, Busfahrer oder (einfache) Jugendliche zählten. Entgegen hegemonialer Vorstellungen findet männliche Gewalt in allen Berufsgruppen statt und wird mit allen möglichen und vorhandenen Mitteln von Männern ausgeübt. Durch den Ausbruch von Covid-19 zeigte sich zudem spätestens ab Mitte März 2020, dass zahlreiche Taten in direktem Zusammenhang mit der Pandemie oder den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung standen.
Wenn wir im Folgenden Bezug auf die in Österreich von Männern verübten Gewalttaten nehmen, verzichten wir darauf, diese im Konjunktiv zu beschreiben und von Unschuldsvermutungen oder ‚mutmaßlichen‘, ,vermeintlichen‘ oder ,angeblichen‘ Tätern zu schreiben – auch wenn entsprechende strafrechtliche Verurteilungen zumeist (noch) nicht gegeben waren oder bis heute nicht sind. Wir haben diese aus mehreren Gründen nicht weiterverfolgt oder recherchiert. Weder schenken wir der Berichterstattung, die unsere zentrale Informationsquelle darstellt, kritiklos Glauben, noch vertrauen wir der Polizei und Justiz, geschlechtsbezogene Gewalt als das zu erkennen, was sie ist, und sie innerhalb des bestehenden Rechtssystems adäquat bestrafen zu können. Nicht zuletzt wissen wir, dass Bestrafungen oder auch die Androhung selbiger Täter nicht davon abhält, anderen Menschen Gewalt anzutun, und entsprechend sehen wir den Handlungsbedarf auch und vor allem an anderer Stelle. Insofern ist es für unser Projekt irrelevant, ob und wer rechtlich belangt wurde oder nicht, und so werden Verurteilungen ebenso wie Freisprüche nur dann erwähnt, wenn sie Thema der gesammelten Berichte sind. Wir setzen die beschriebenen Taten als gegeben, denn selbst wenn sich eine dieser unzähligen ungeheuerlichen Geschichten als unwahr herausgestellt hätte oder ein Täter – aus welchen Gründen auch immer – freigesprochen worden wäre, können wir uns sicher sein, dass die erwähnten Taten auf ähnliche Art und Weise in anderen Kontexten von Männern verübt wurden (und lediglich von der Berichterstattung unerwähnt blieben). Sie fungieren somit als Ausgangspunkt unseres Texts, den wir mit der Intention verfasst haben, männliche Gewalt und patriarchale Verhältnisse sichtbar zu machen und zu benennen. Es geht uns dabei weniger um die individuellen Vorfälle, als darum, die hohe Frequenz, Brutalität und Systematik, mit der die Taten vollzogen werden, aufzuzeigen.
In unserem Text verzichten wir weitgehend darauf – wie in der österreichischen Berichterstattung zumeist üblich –, die in den Reisepässen angegebenen Staatsbürgerschaften oder sogenannten, ‚ursprünglichen Herkunftsländer‘ der Täter zu erwähnen, weil wir glauben, dass diese Informationen in erster Linie dazu dienen, Rassismus zu schüren und von den eigentlichen Problemen abzulenken. Alle in unserem Text erwähnten Täter teilen sich schließlich nicht den gleichen Geburtsort, sondern weisen eine andere, ganz zentrale Gemeinsamkeit auf: ihre Männlichkeit. Auch die hinter den Taten stehenden Legitimationsmuster wie die Vorstellung männlicher Überlegenheit, Dominanzansprüche, patriarchales Besitzdenken und Kontrollstreben, Selbstüberschätzung oder heteronormative Geschlechterrollen unterscheiden sich weniger im Hinblick auf Nationalitäten als auf gelebte und angestrebte Männlichkeitsbilder. So haben selbst Dschihadisten mit autochthonen Rechtsextremen mehr gemeinsam, als ihnen lieb ist.
Da die Berichterstattung, auf die wir Bezug nehmen, von einem binären Geschlechtersystem ausgeht und nur Männer und Frauen als geschlechtliche Identitäten anerkennt, haben wir diese Logik in unserem Text übernommen, auch wenn wir wissen, dass sich abseits dieser Positionen noch viele andere geschlechtliche Lebensentwürfe finden. Diesen Widerspruch, dass wir von den Gewalttaten aus jenen Medien erfahren, die geschlechtliche Vielfalt nicht berücksichtigen und es daher verunmöglichen, die jeweiligen Selbstbezeichnungen der Betroffenen adäquat wiederzugeben, konnten wir hier folglich nicht auflösen. Dennoch ist es nicht unsere Intention, dazu beizutragen, die Lebensrealitäten und insbesondere die Gewalterfahrungen von Lesben, intergeschlechtlichen, nichtbinären und trans* Personen unsichtbar zu machen. Vielmehr wollen wir dazu auffordern, beim Lesen des Texts immer mitzudenken, dass nicht alle von Gewalt Betroffenen sich in der Geschlechterdichotomie von Mann und Frau wiederfinden – auch wenn die jeweiligen Identitäten nicht immer explizit benannt werden (können).
Nicht nur die Gewalttaten selbst, sondern auch die Art und Weise, wie darüber auf orf.at berichtet wird, macht Teil unserer Auseinandersetzung aus. Neben den bekannten irreführenden und dadurch verharmlosenden Schlagwörtern wie ‚Bluttaten‘, die 26 Mal in der Berichterstattung vorkommen oder ‚Beziehungstaten‘, die fünf Mal erwähnt werden, ist die Häufigkeit, mit der orf.at von ‚Situationen‘ (34 Mal) oder ‚Streits‘ (145 Mal, davon zehn Familien- und vier Beziehungsstreits) schreibt, die ‚eskaliert‘ (39 Mal) seien, gelinde gesagt, auffallend. Gerade die Rede von ,Situationen‘ versucht vermutlich, Bewertungen und (vorschnelle) Einordnungen zu vermeiden, um dadurch vermeintliche (journalistische) Neutralität und Äquidistanz zu transportieren, die eine Teilschuld aller Beteiligten zumindest als möglich einräumt. Genau diese Darstellung blendet aber aus, dass diese ‚Situationen‘ nicht vom Himmel fallen oder ohne das Mitwirken bestimmter Personen entstehen. Dadurch wird schlichtweg verschwiegen, wer die eigentlichen Verursacher dieser Gewalttaten und -dynamiken sind, und unsichtbar gemacht, dass kein Verhalten oder Tun der Betroffenen es rechtfertigt, auf die in den gesammelten Beispielen veranschaulichte Art und Weise mit Gewalt zu reagieren. Dasselbe gilt auch für das in der Berichterstattung häufig wiederkehrende Erklärungsmuster, dass den Taten ein ‚Streit‘ vorausgegangen sei, obgleich auch Streitigkeiten keinen hinreichenden Grund darstellen, anderen Menschen Gewalt anzutun, sie zu verletzen, zu missbrauchen, zu bedrohen, zu demütigen oder im schlimmsten Fall zu ermorden. Nicht selten werden in der Berichterstattung den Perspektiven der Täter bzw. deren Erklärung ihrer Gefühle umfassend Raum gegeben, während die Perspektiven der Betroffenen oder ihrer Angehörigen ausgespart bleiben – und dadurch auch die zumeist fatalen Konsequenzen der Taten.
Sich selbst nicht als potentielle Betroffene dieser Gewalt zu sehen oder entsprechende Taten zu leugnen, kleinzureden und runterzuspielen, ermöglicht und erleichtert es vielen Menschen, sich zu distanzieren und nicht dort hinzusehen, wo es wehtut. Die hier in diesem Buch zusammengetragene Auswahl männlicher Gewalttaten übersteigt in vielerlei Hinsicht unsere Vorstellungskraft – in Hinblick auf die Grausamkeit, die Alltäglichkeit oder auch die Häufigkeit der Taten. Aber das ist gut so, denn nur, wo sich die Abstumpfung noch nicht gänzlich ausbreiten konnte und die Normalisierung noch nicht abgeschlossen wurde, besteht die Möglichkeit, in den Wunden dieser Gesellschaft zu bohren und die Unerträglichkeit in den Blick zu rücken.
In diesem Buch wollen wir daher nicht nur die männlichen Gewalttaten benennen und sichtbar machen, sondern auch (erklärende) Verbindungslinien zeichnen und zeigen, was Taten wie Täter mit Patriarchat, Sexismus, Misogynie und Männlichkeit zu tun haben.
Mit diesem Buch wollen wir aber auch zu einem oder mehreren Arschtritten ausholen, die die Perspektive hin zum Unerträglichen verschieben und längst überfällige Veränderungen dahingehend einleiten, (gewalttätigen) Männlichkeiten ihre konstitutiven Fundamente zu entreißen.
Wien, am Valentinstag 2022
Aus „Du Herbert“ von Judith Goetz, Lydia Haider und Marina Weitgasser