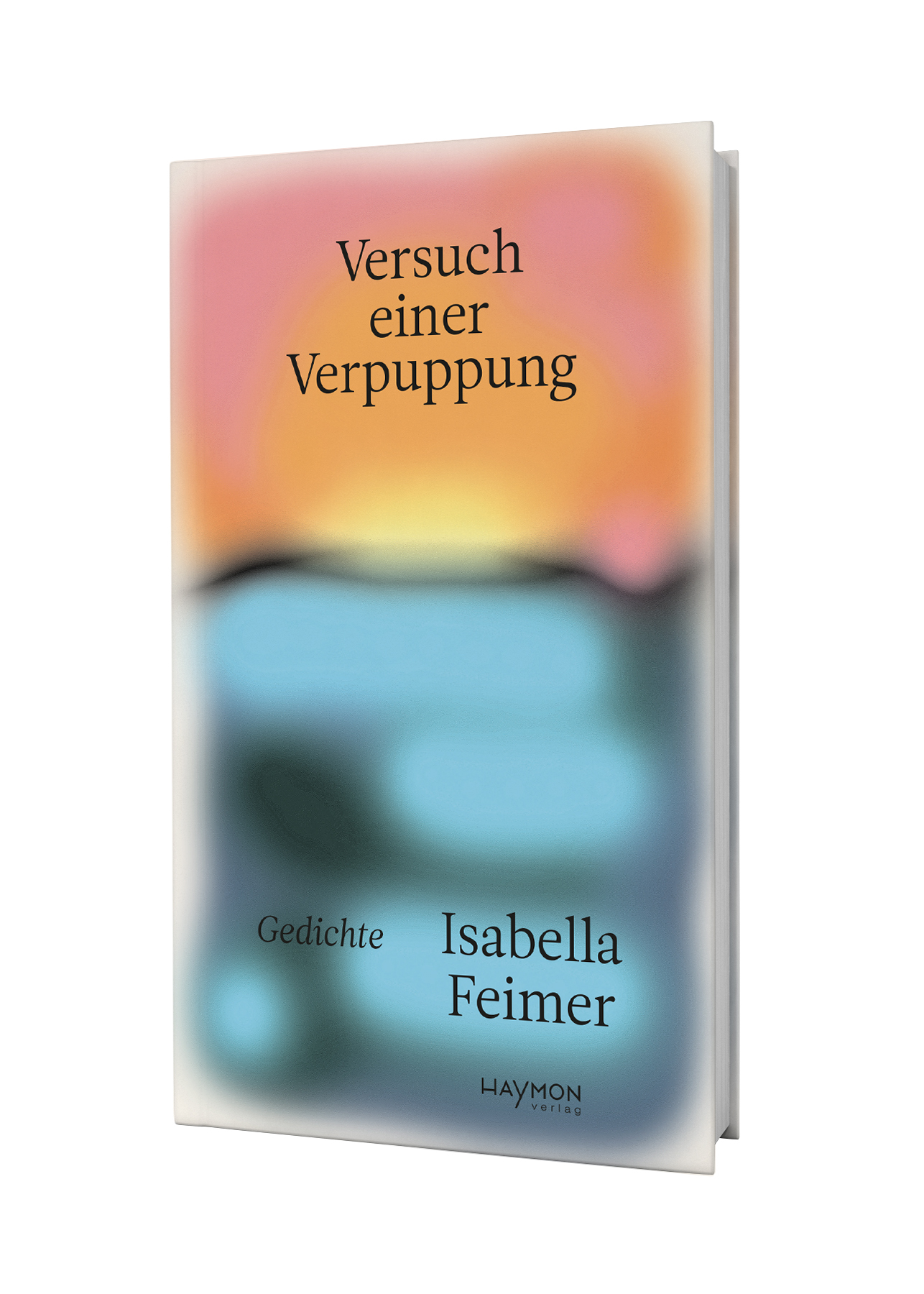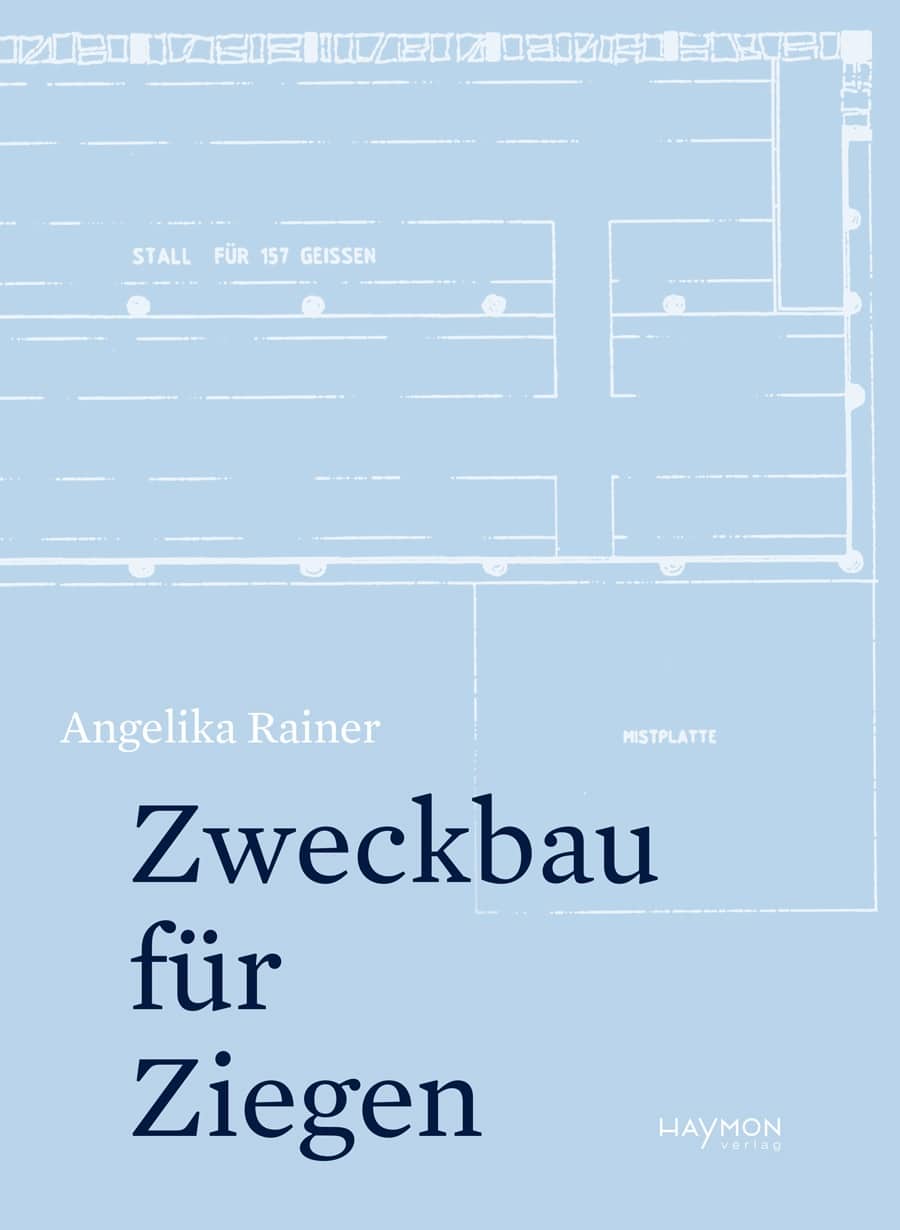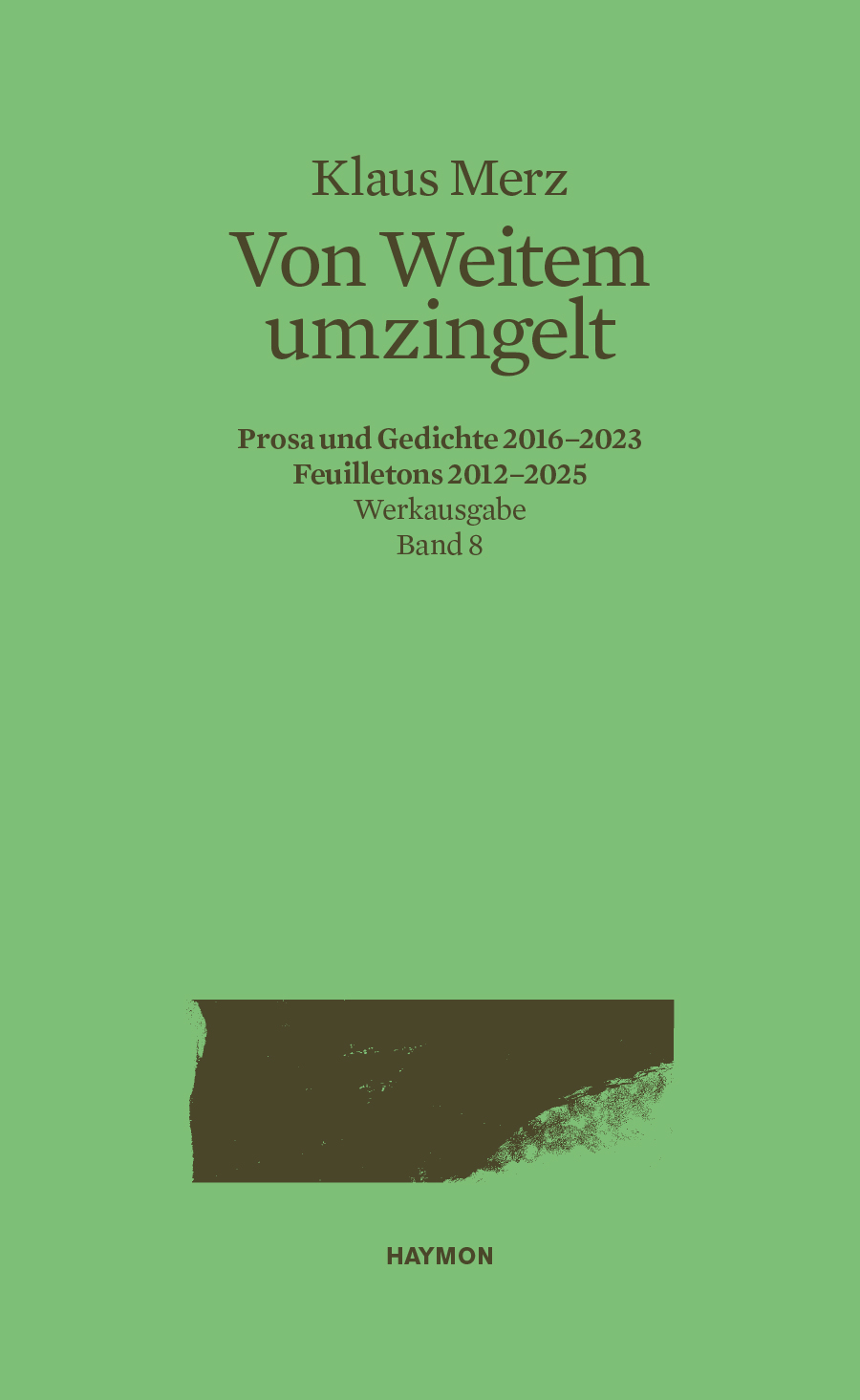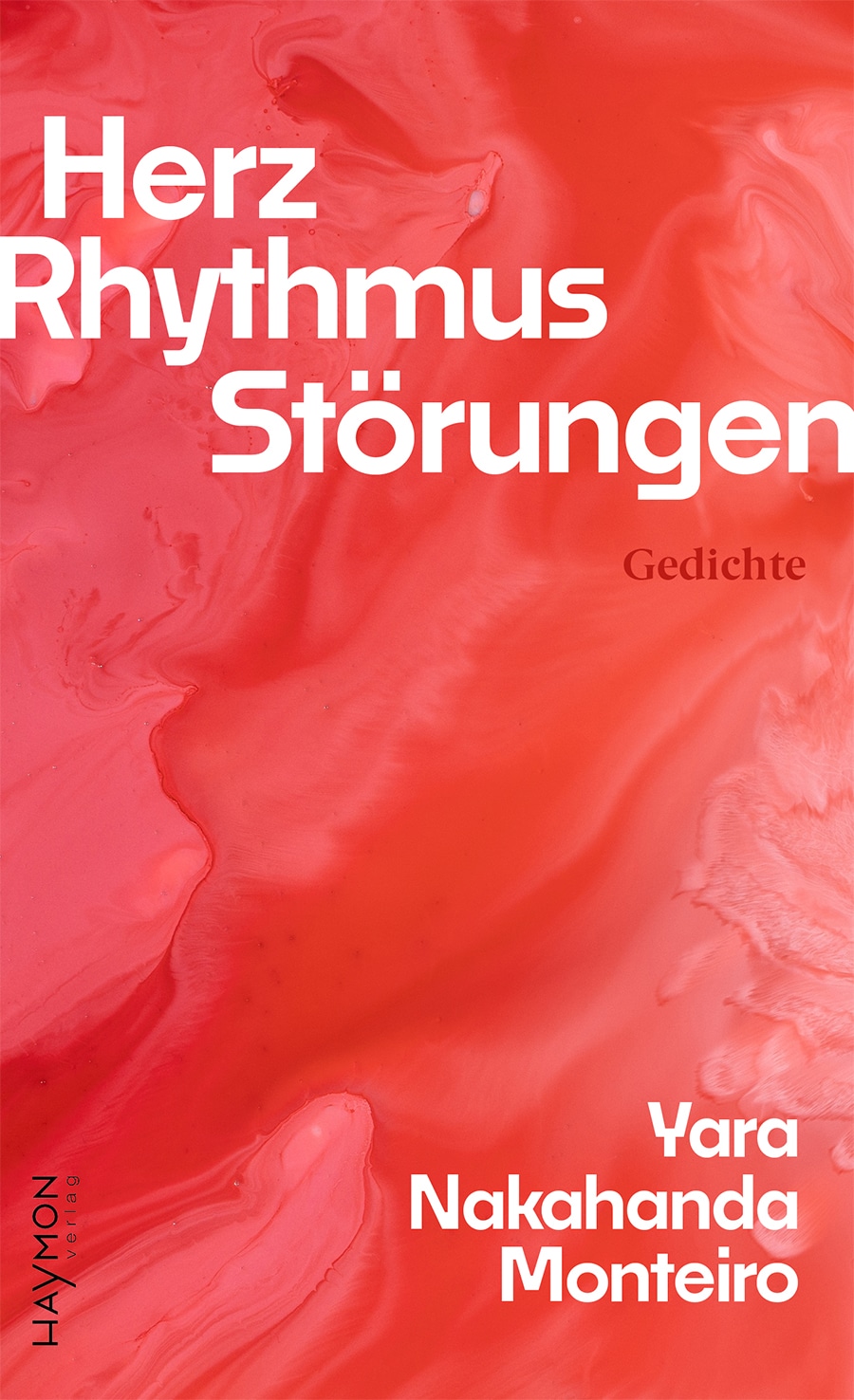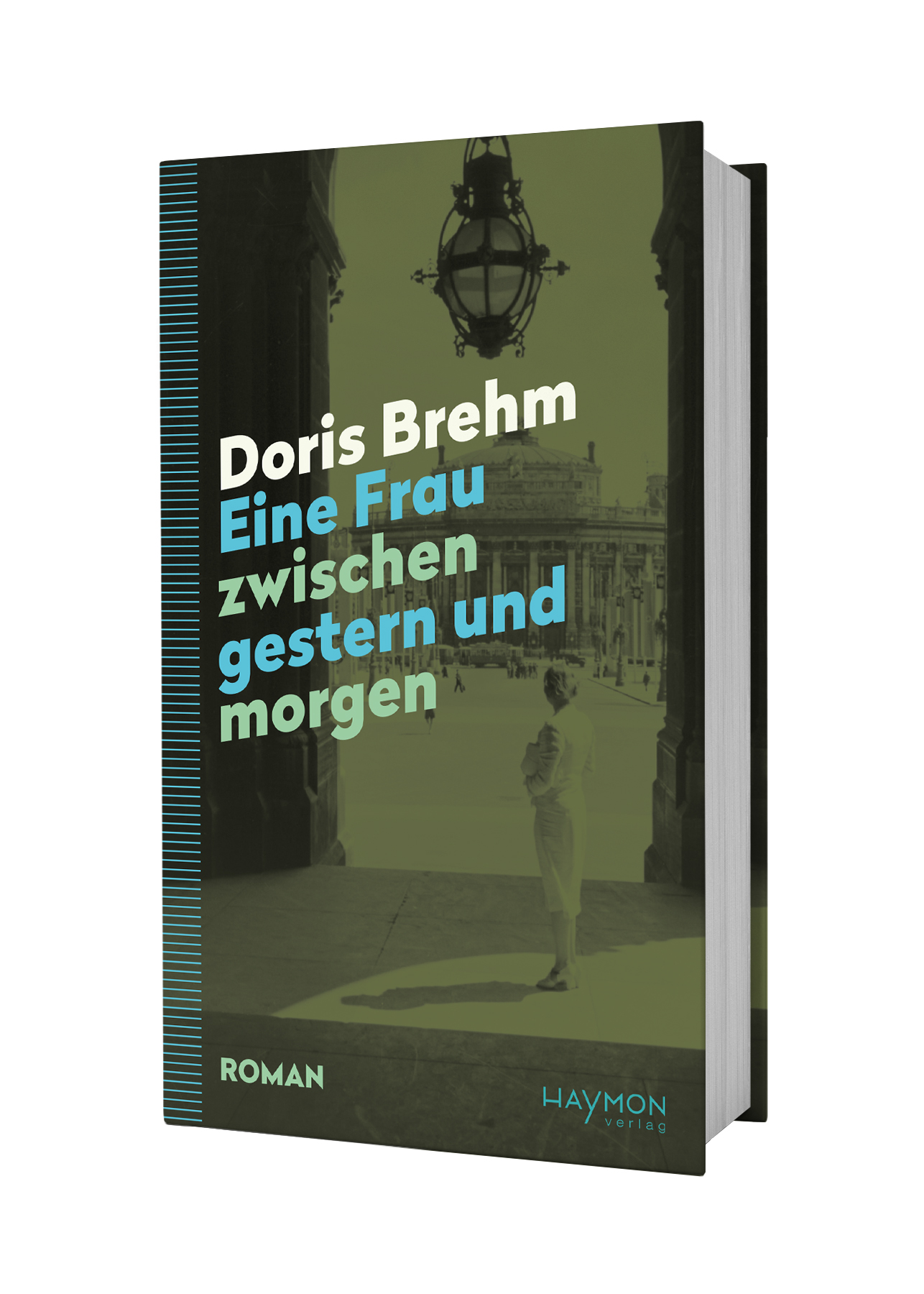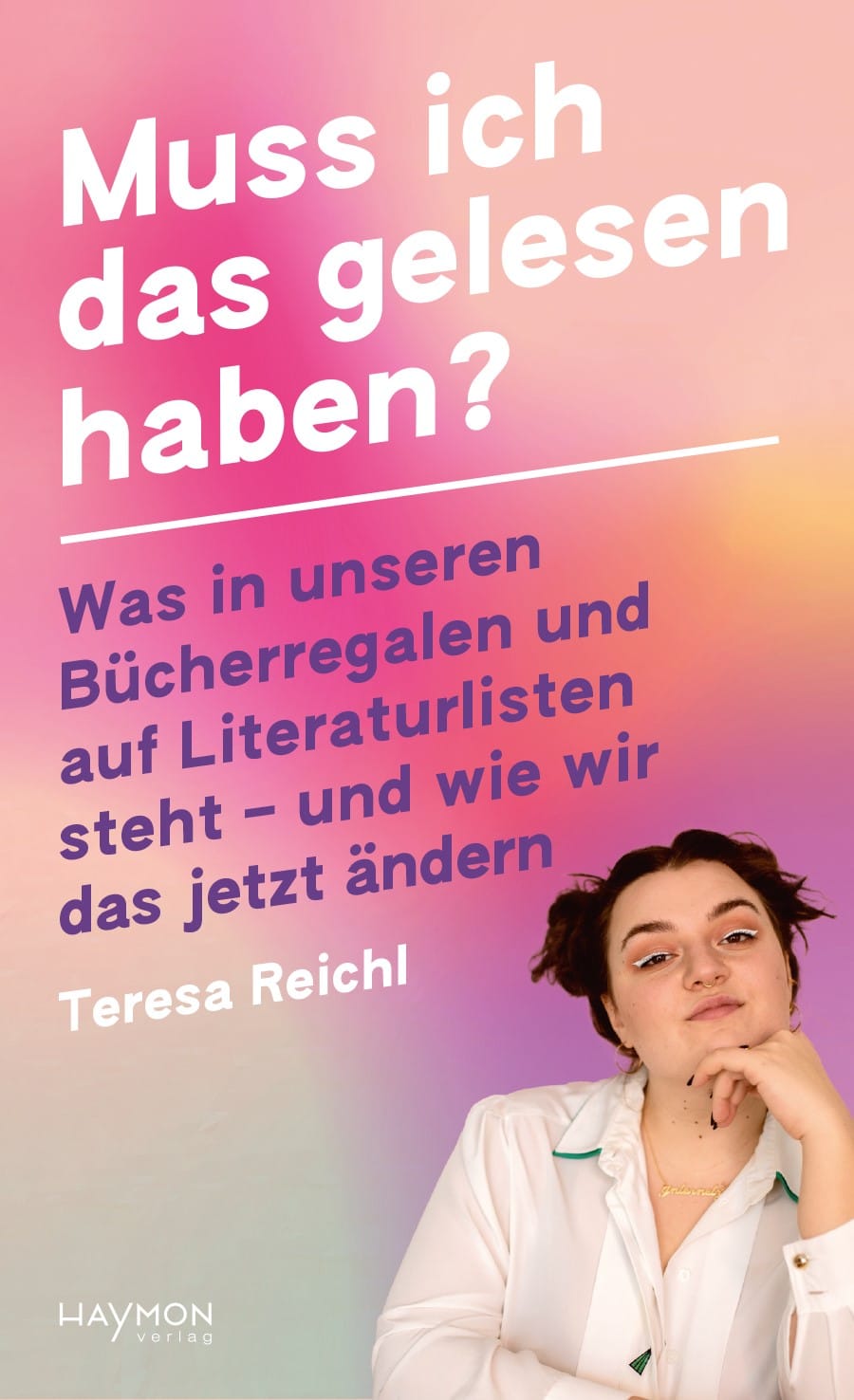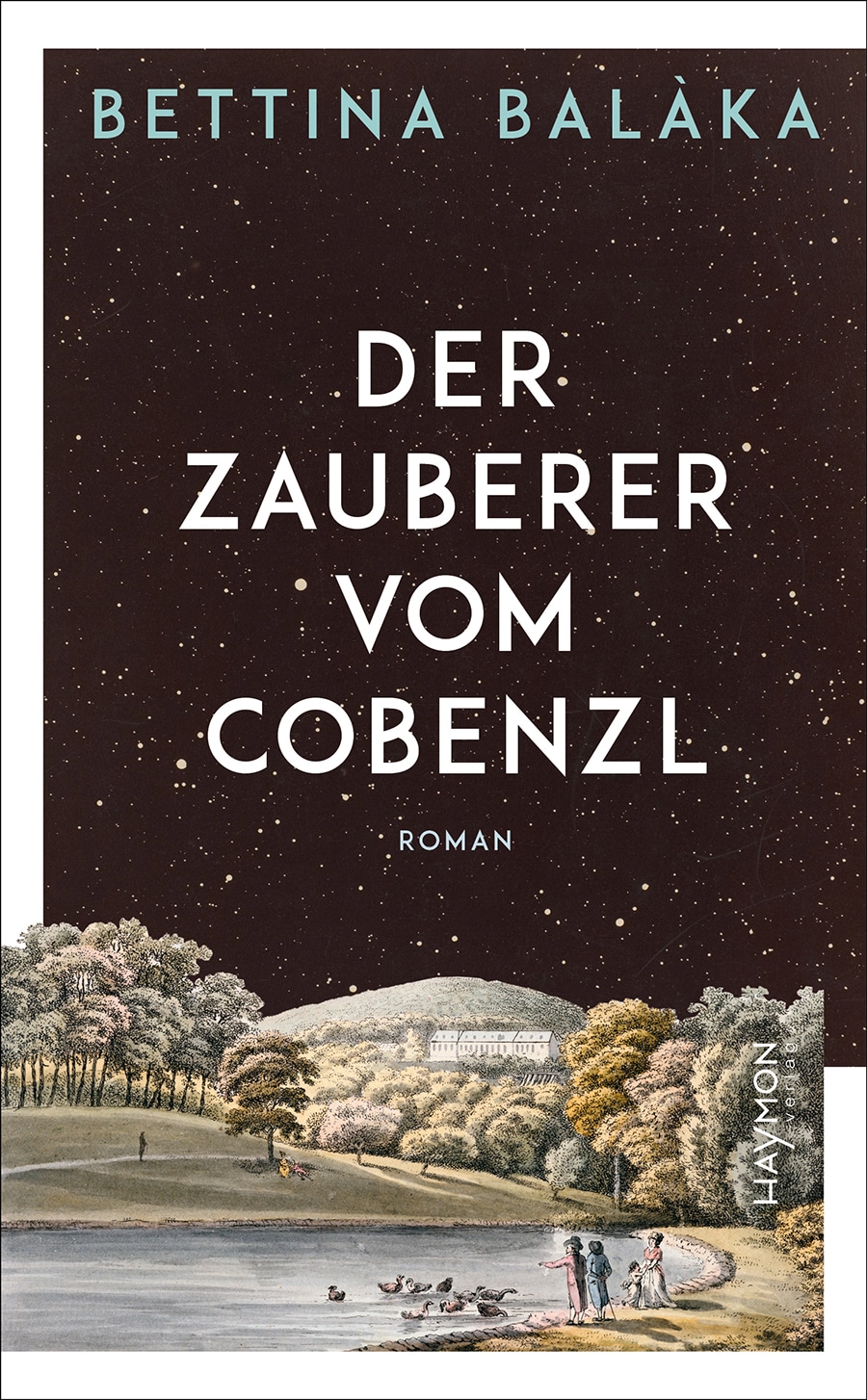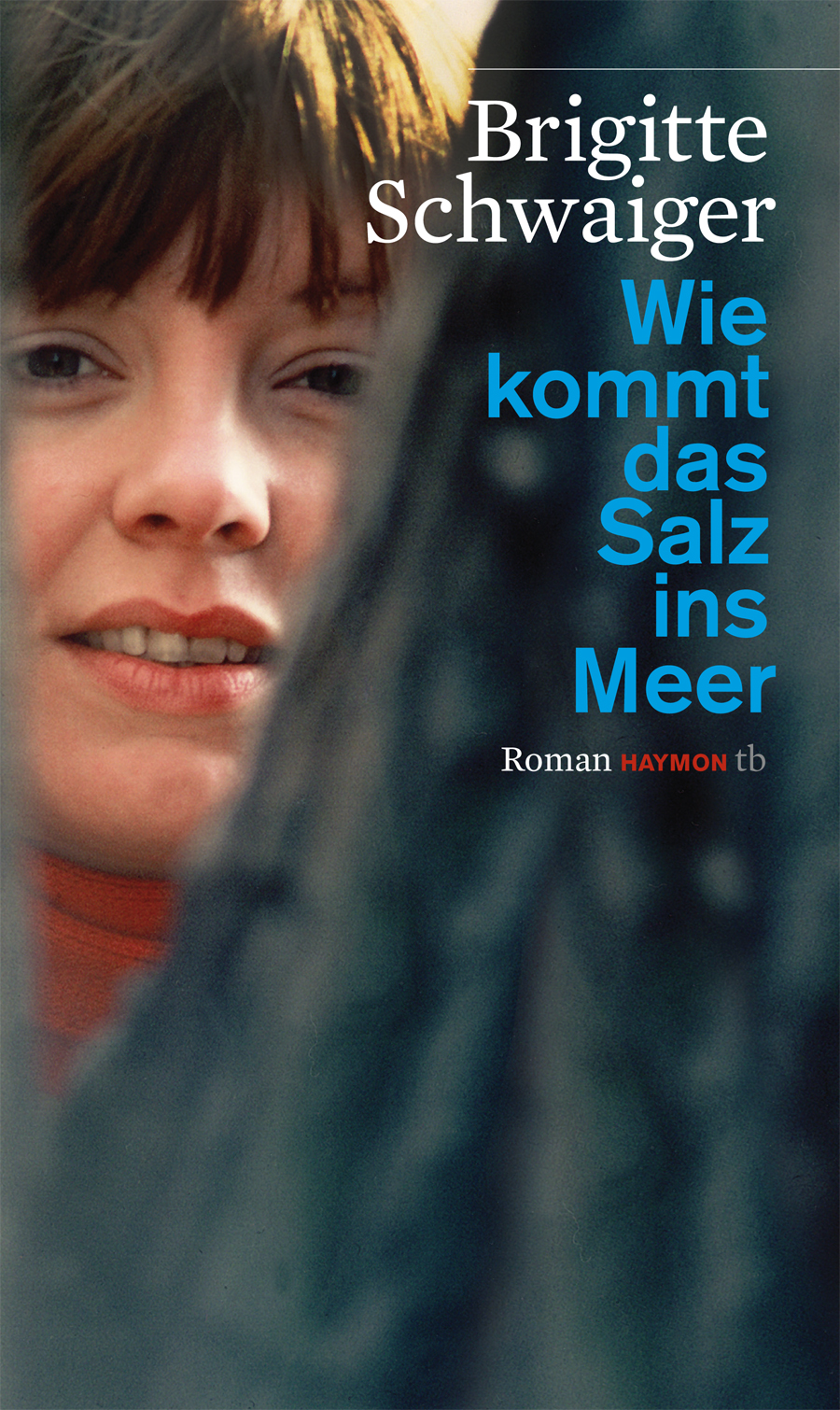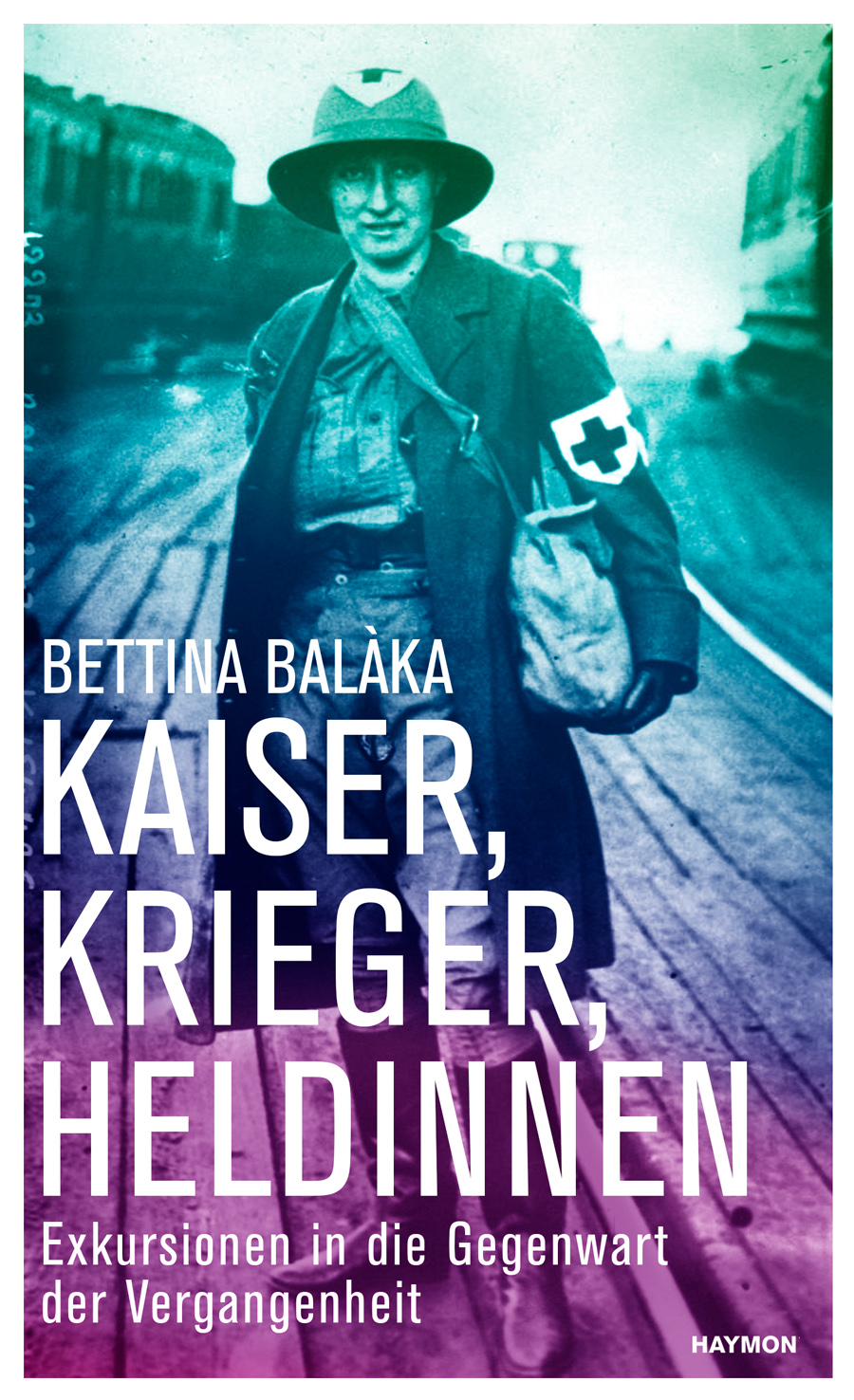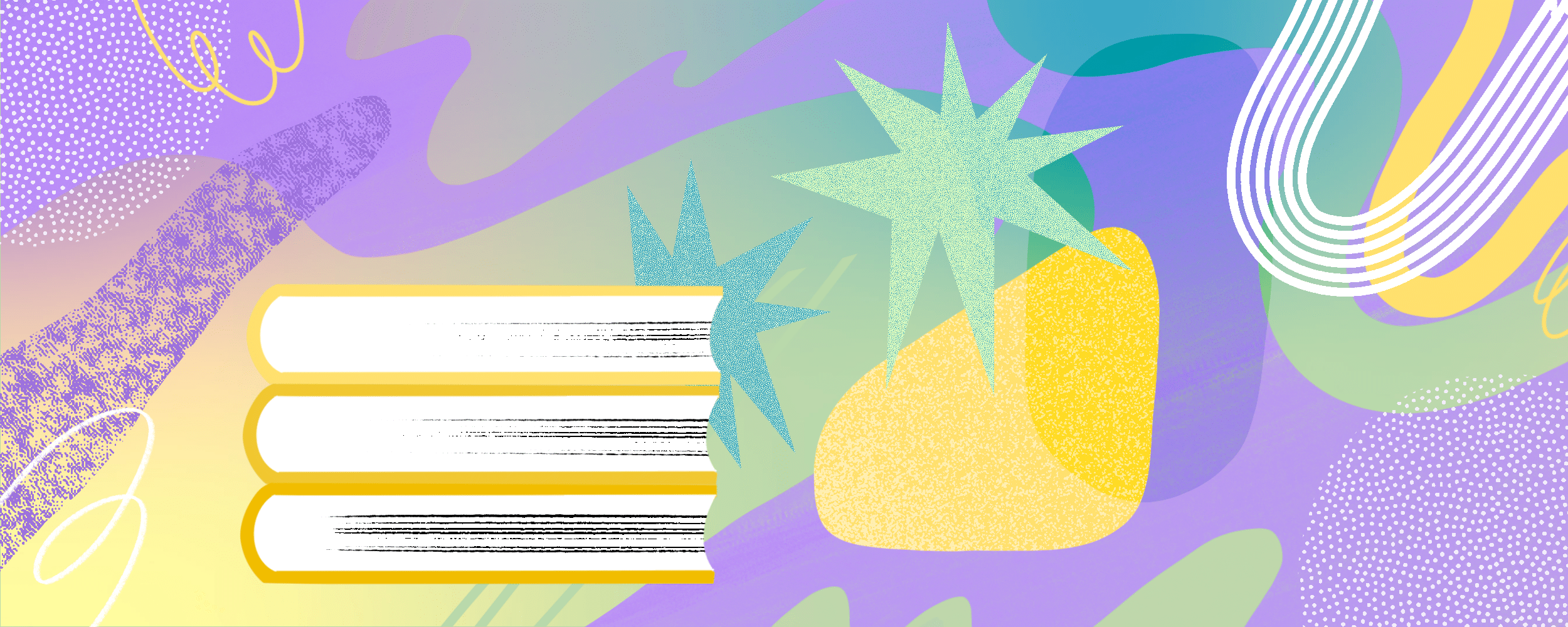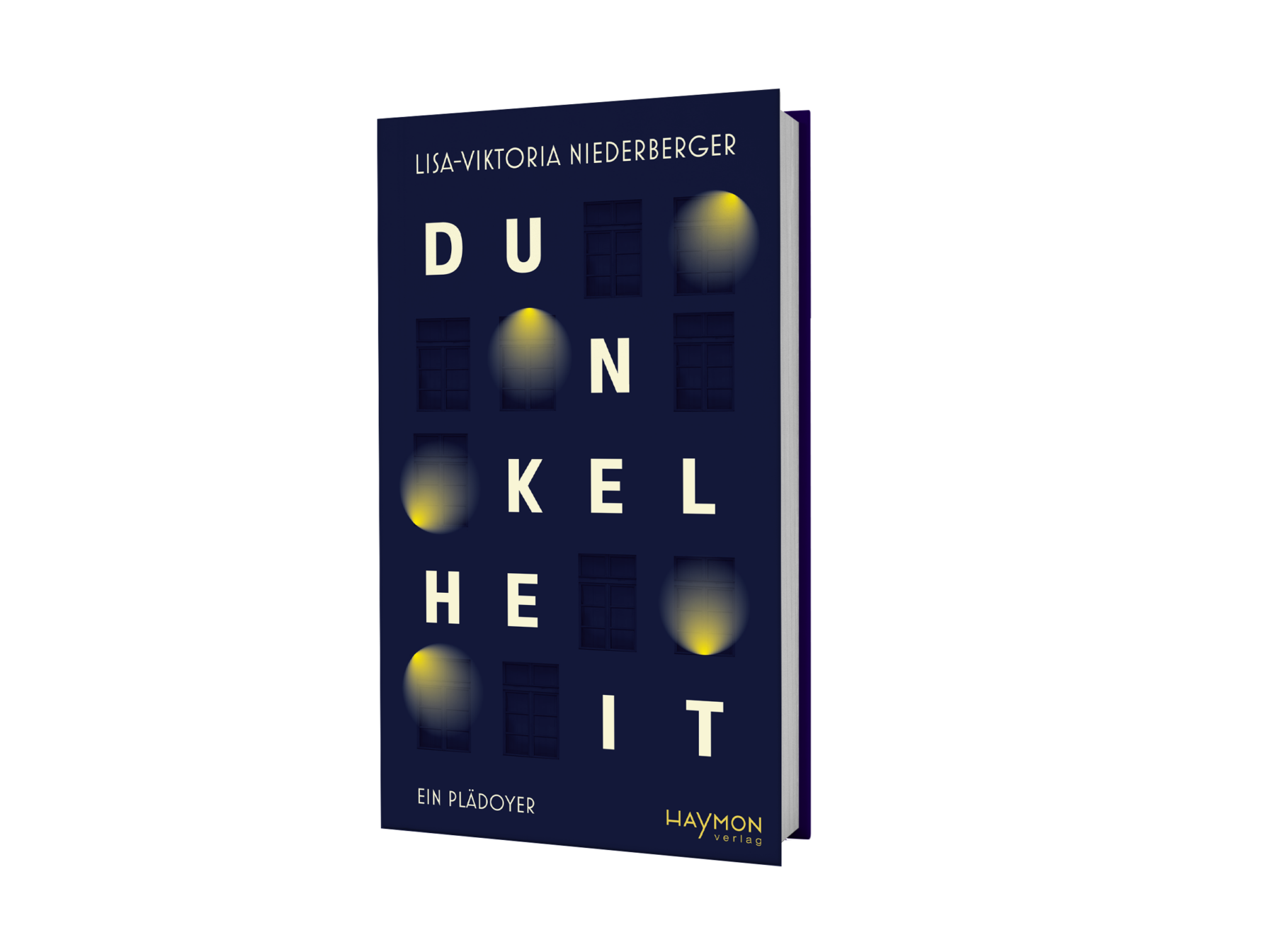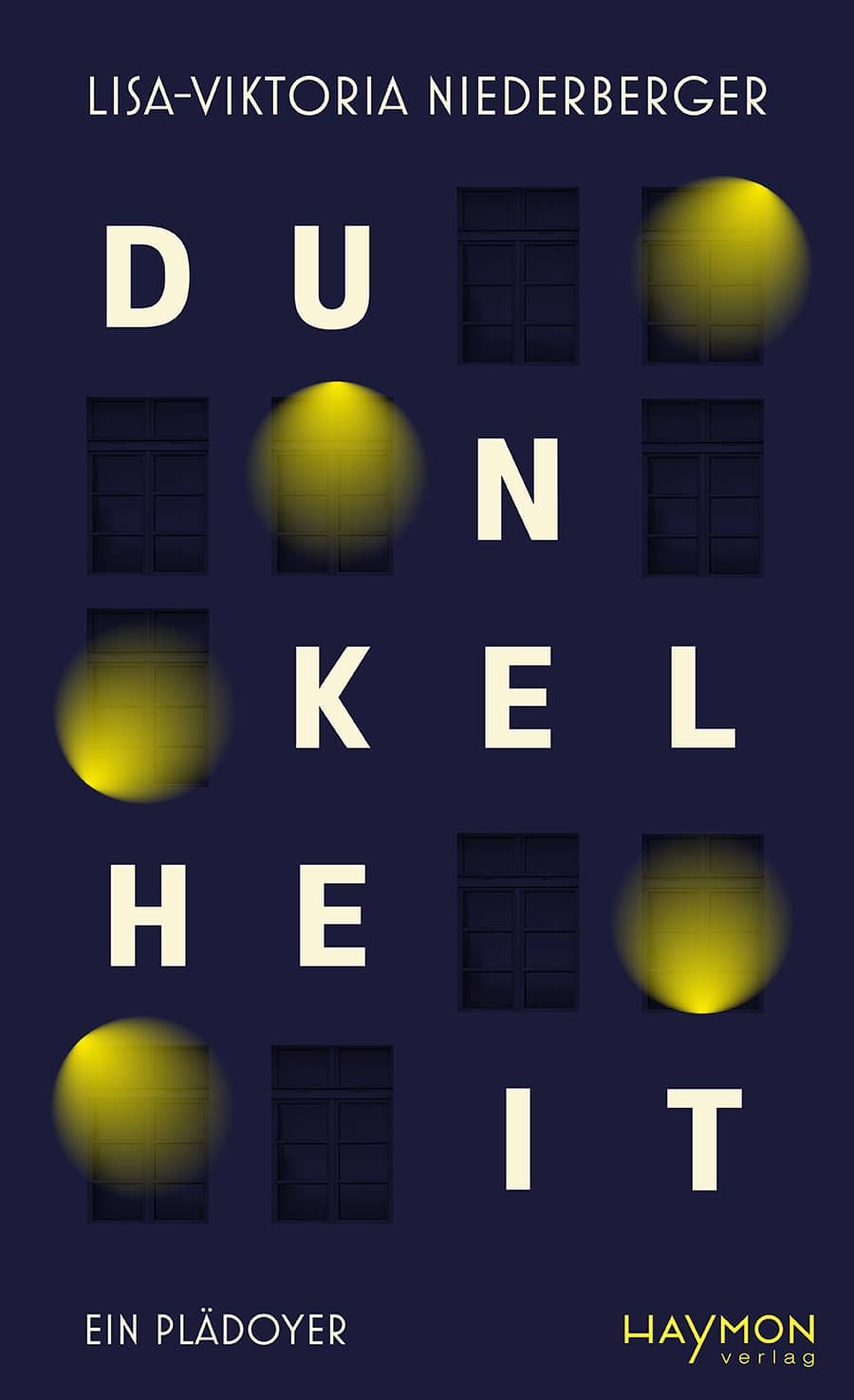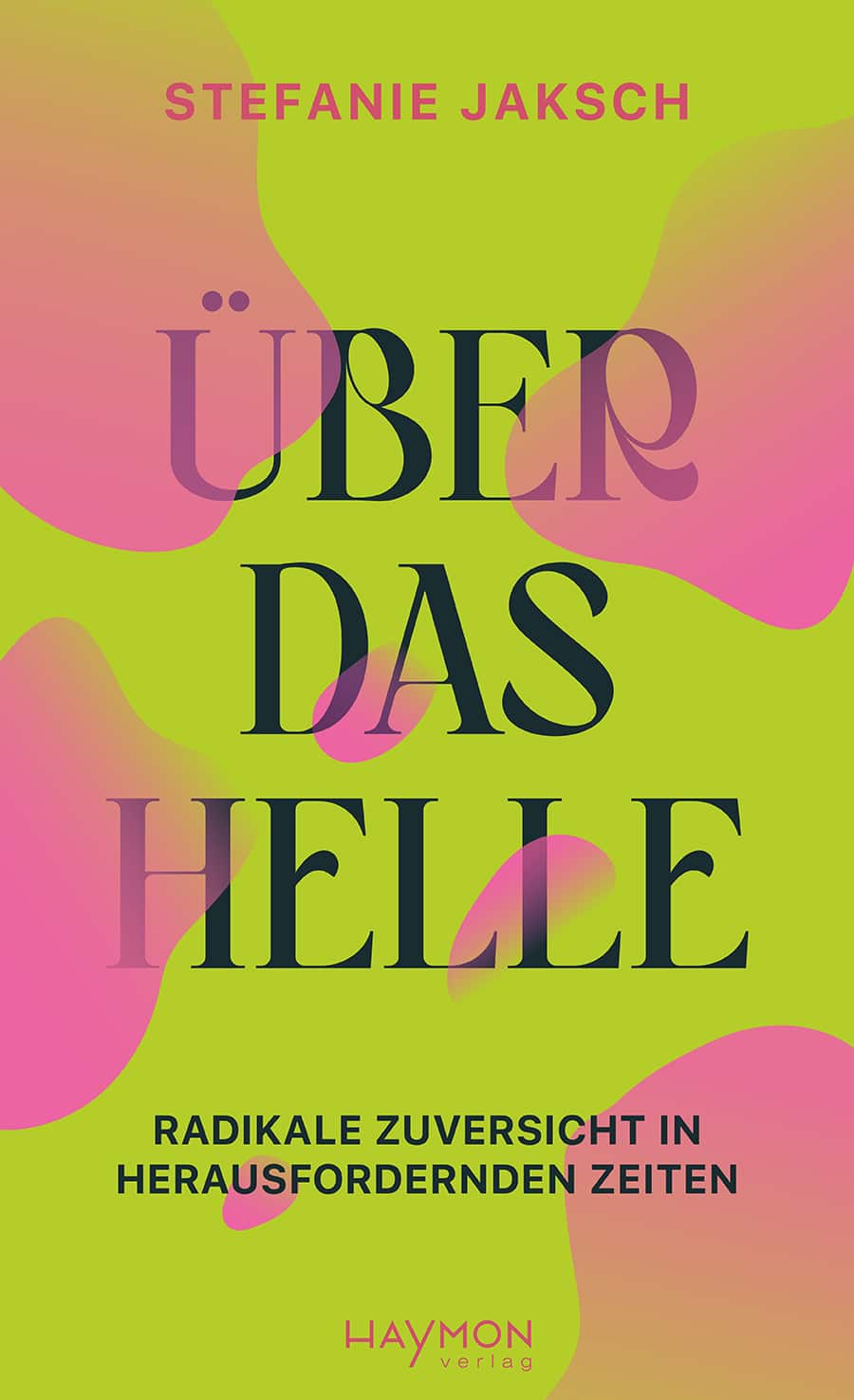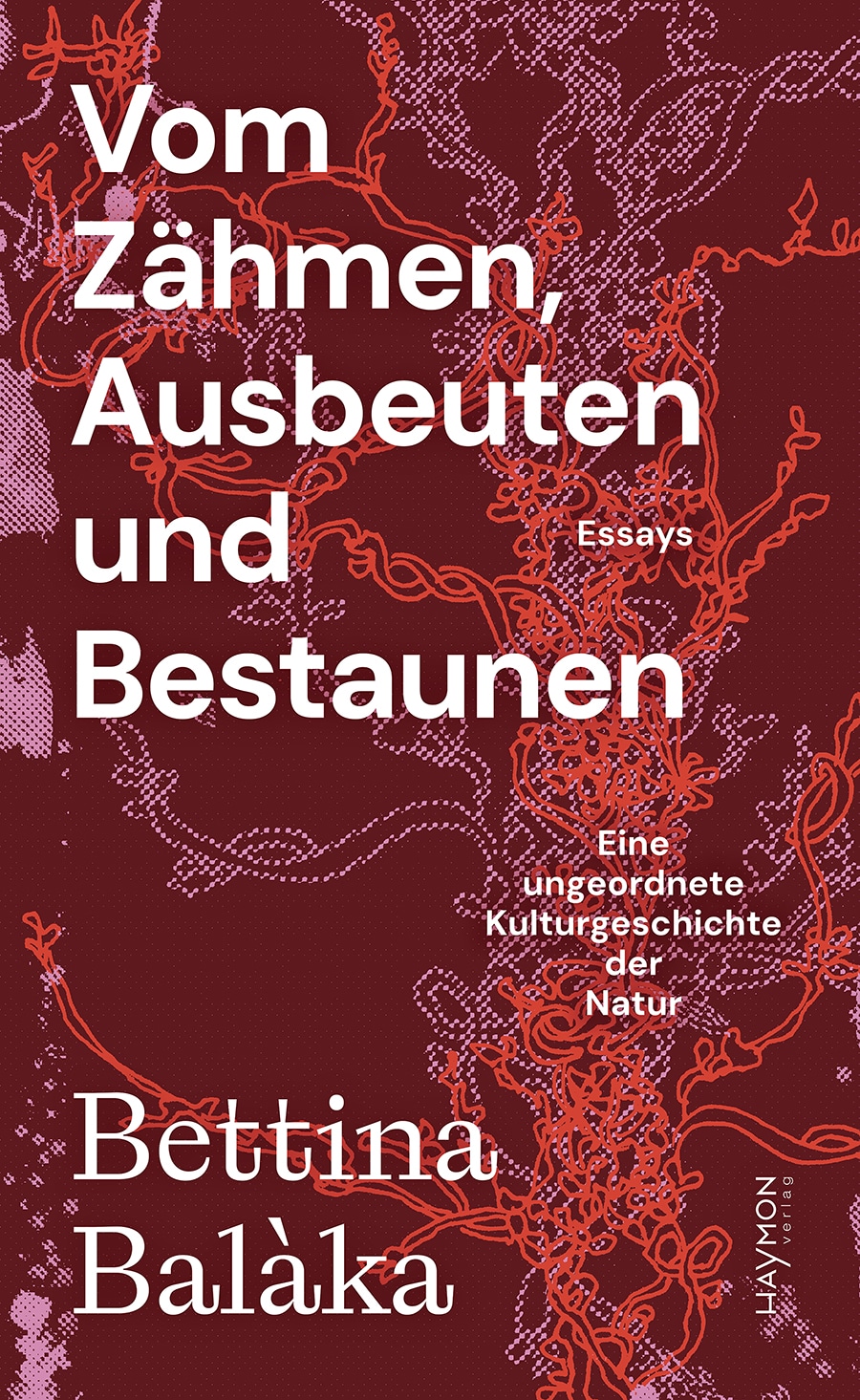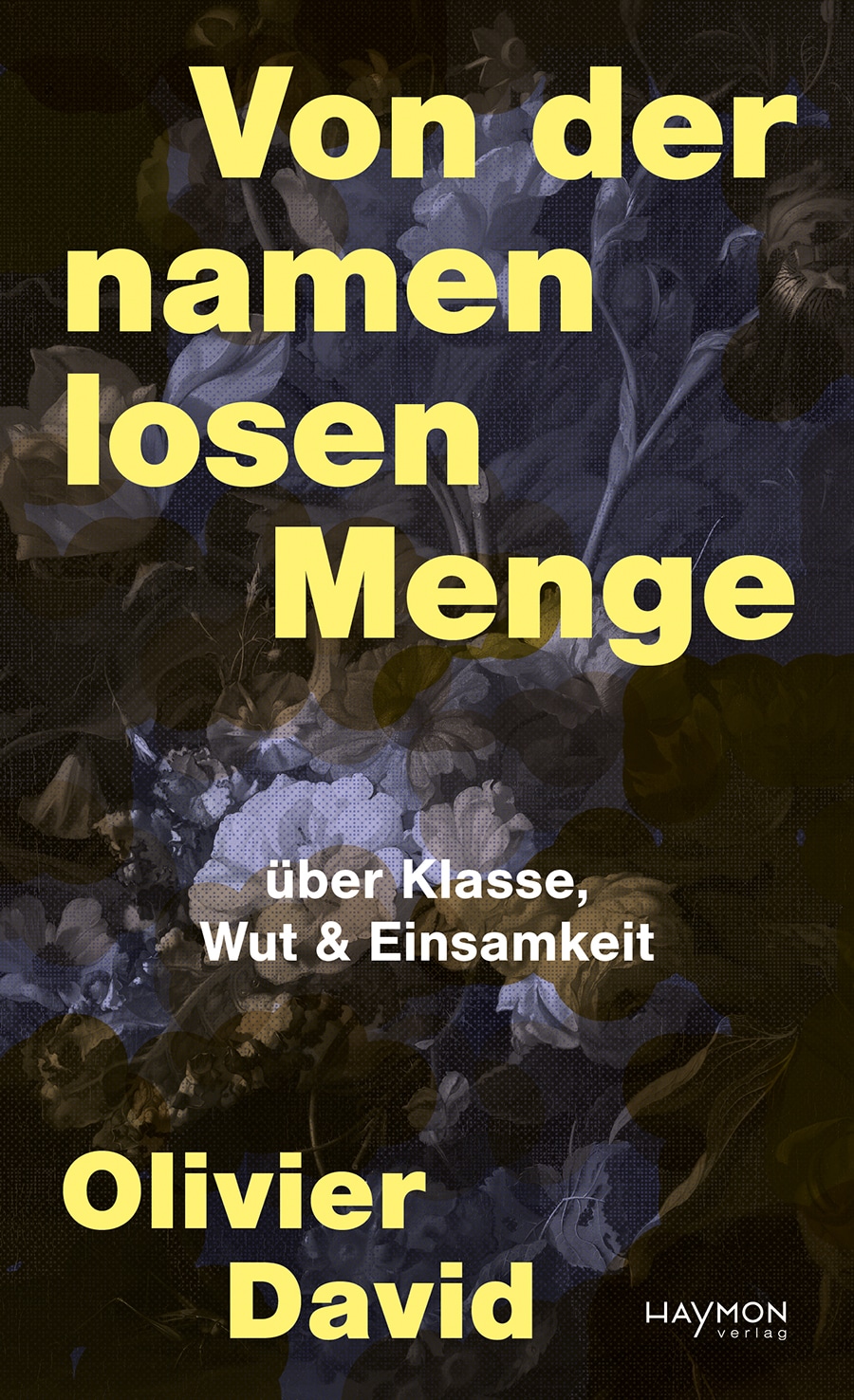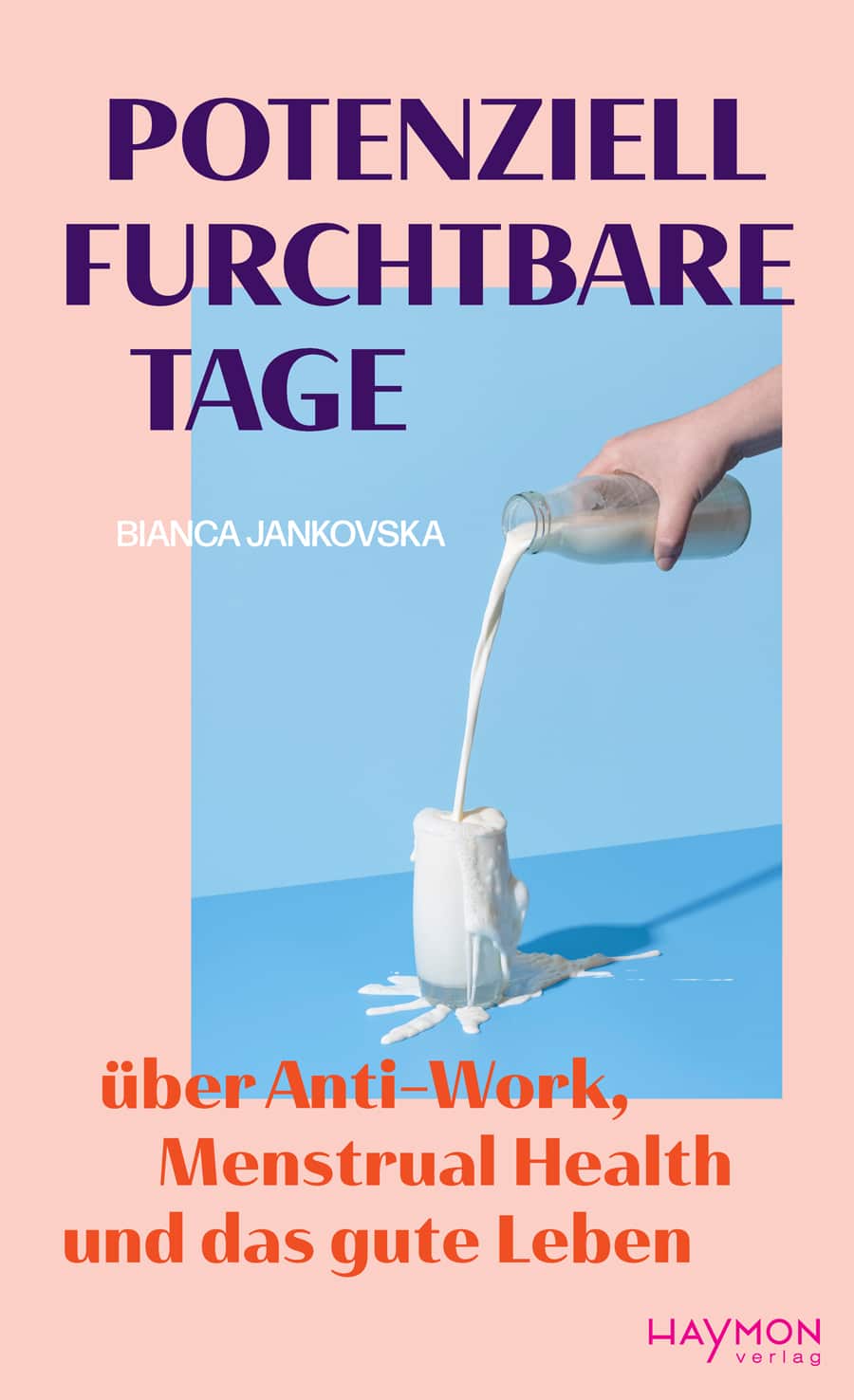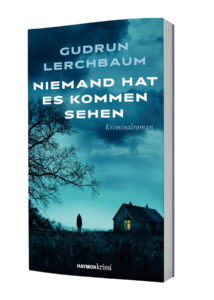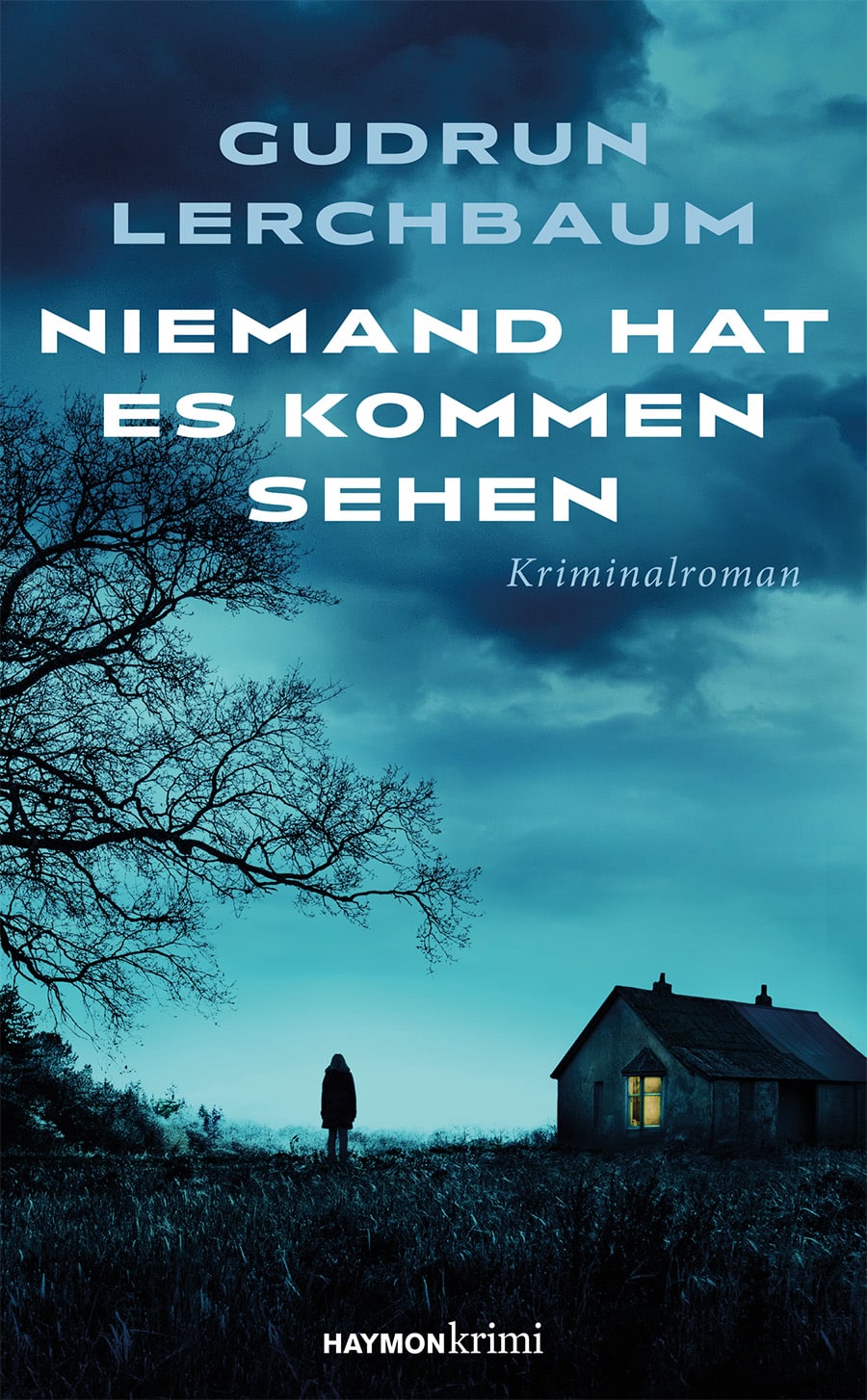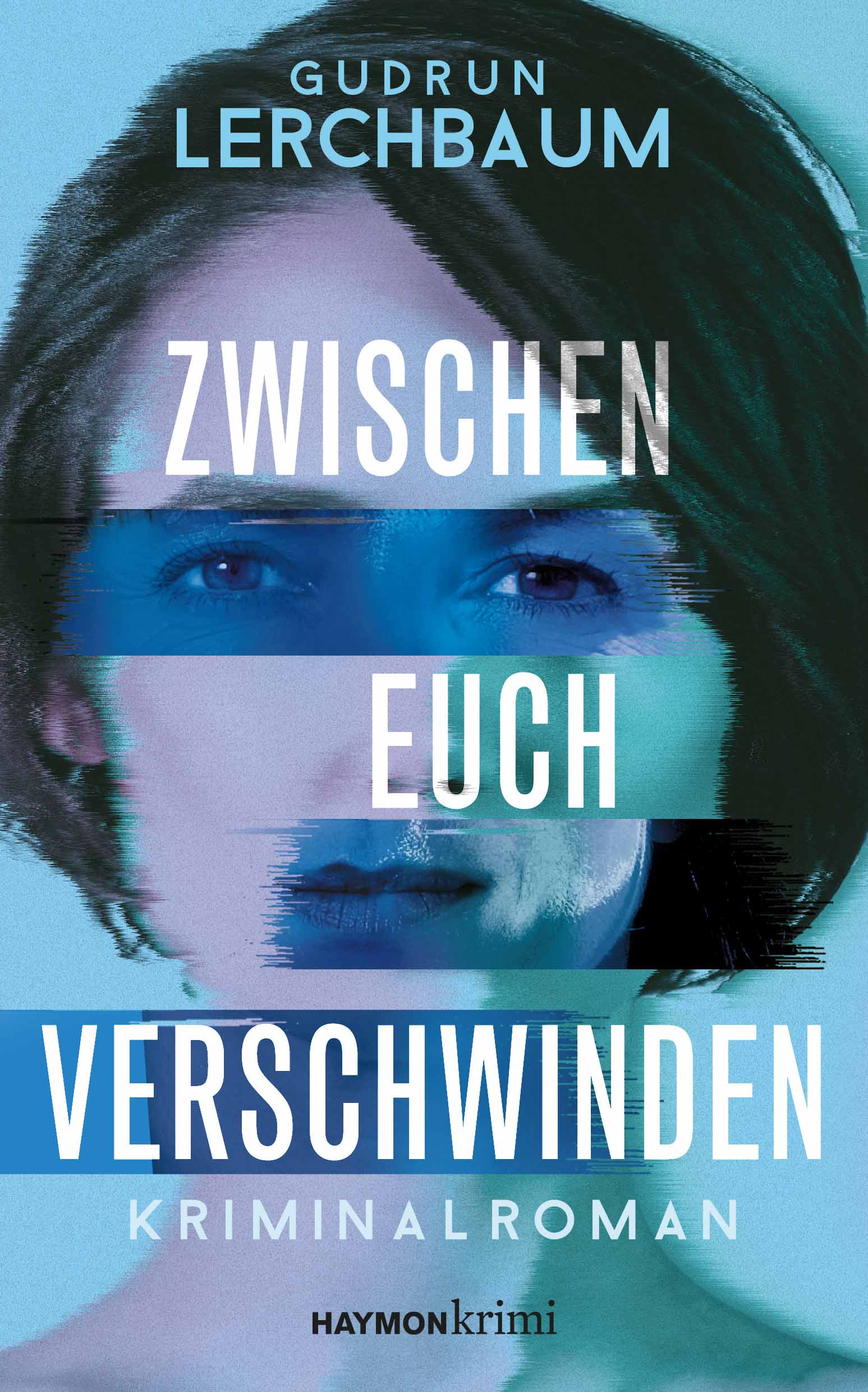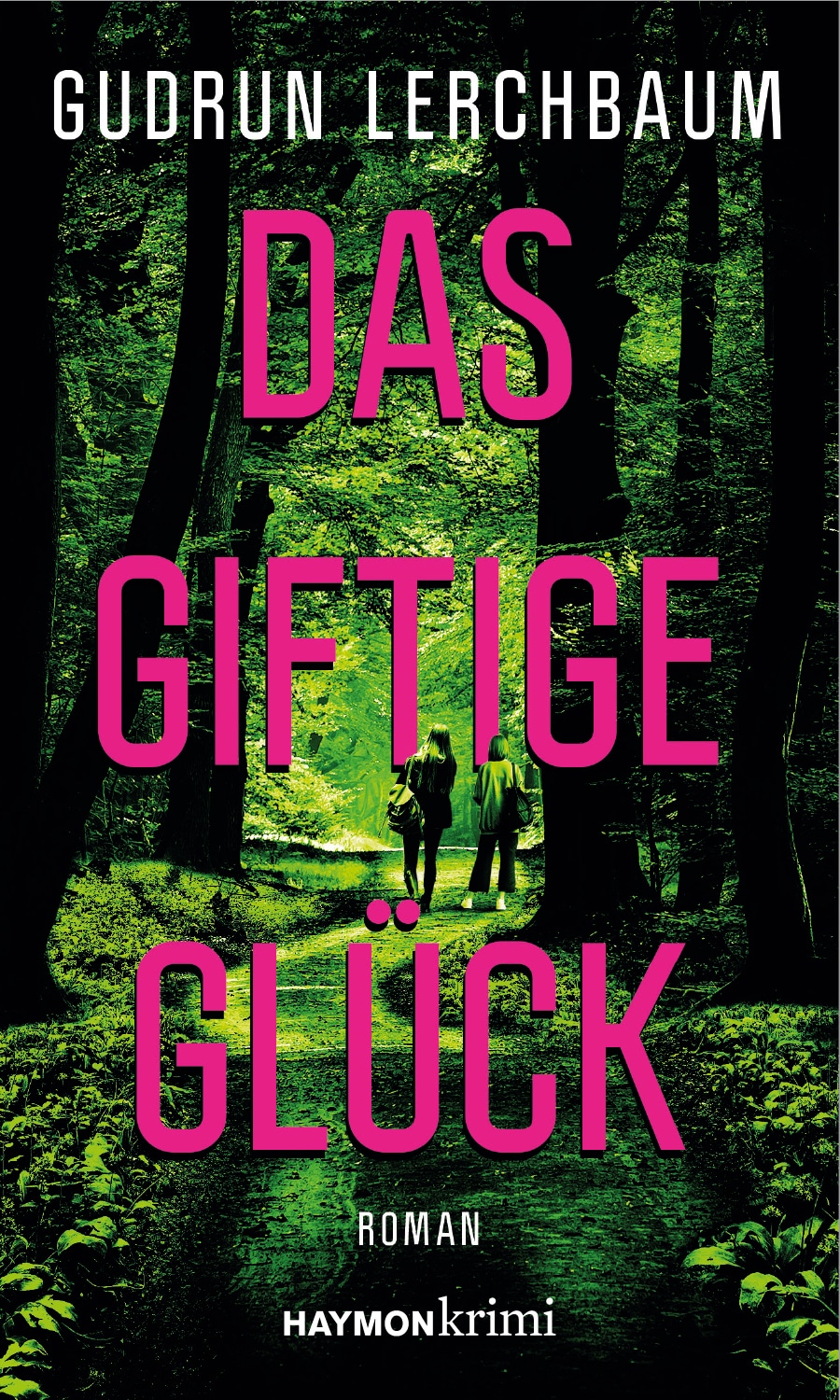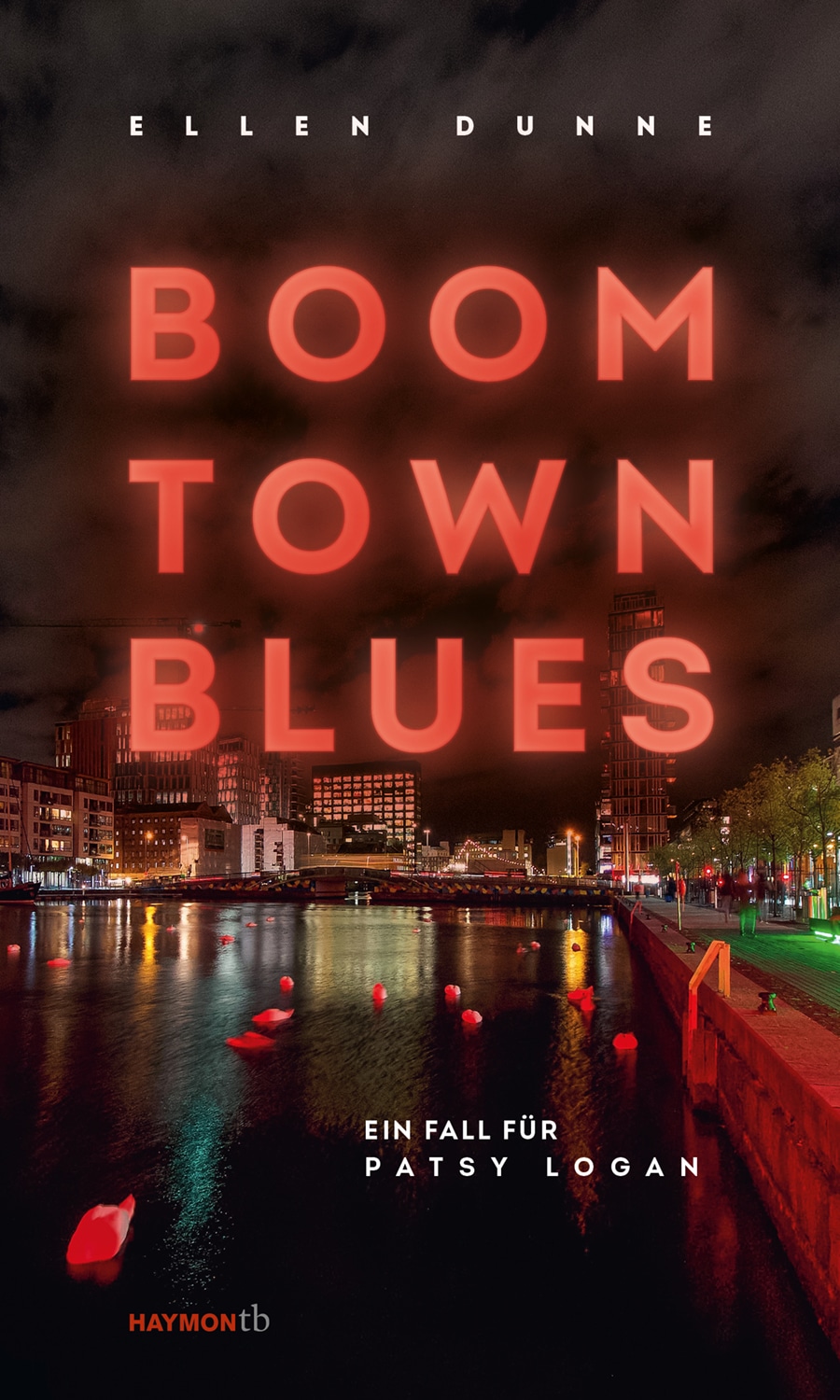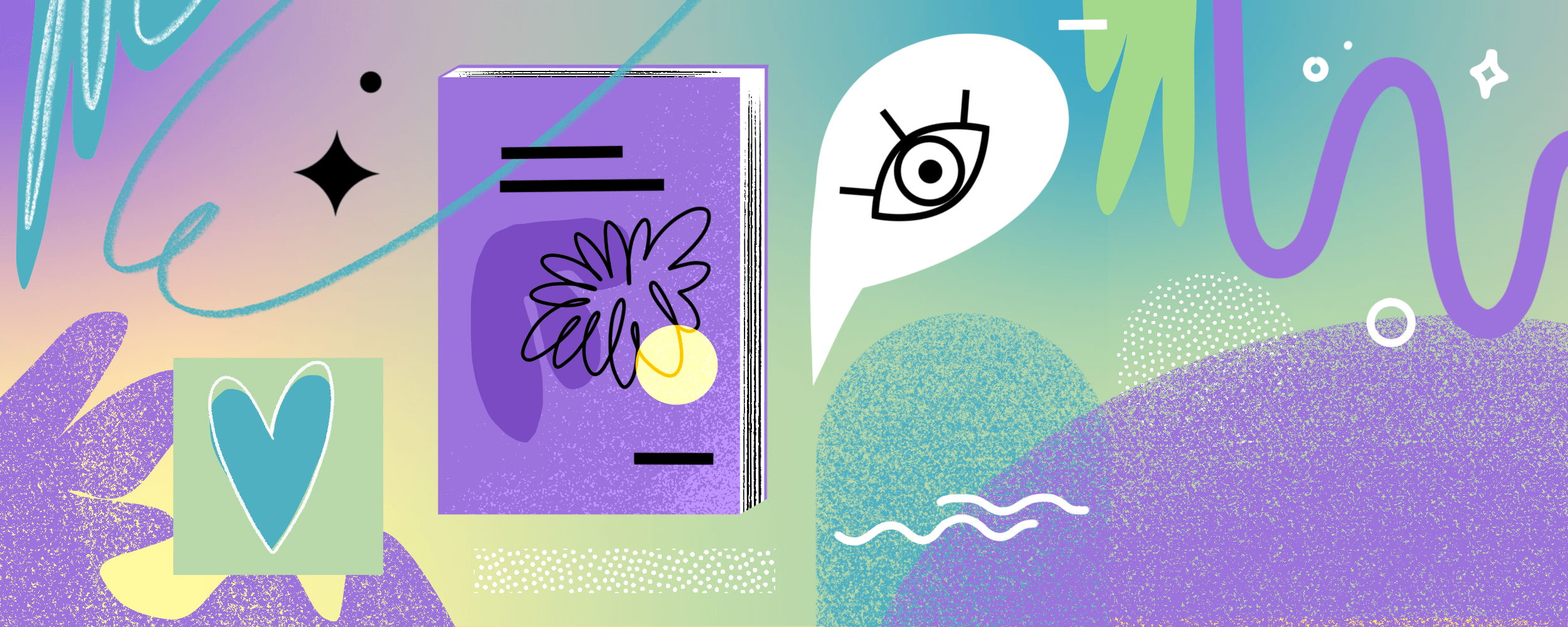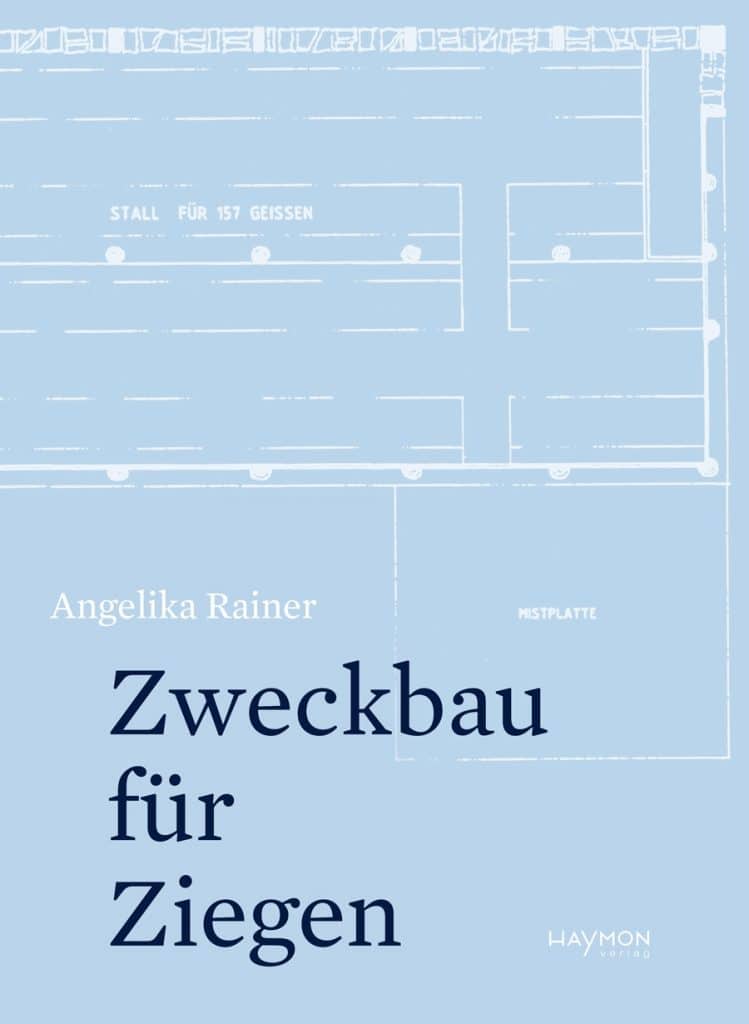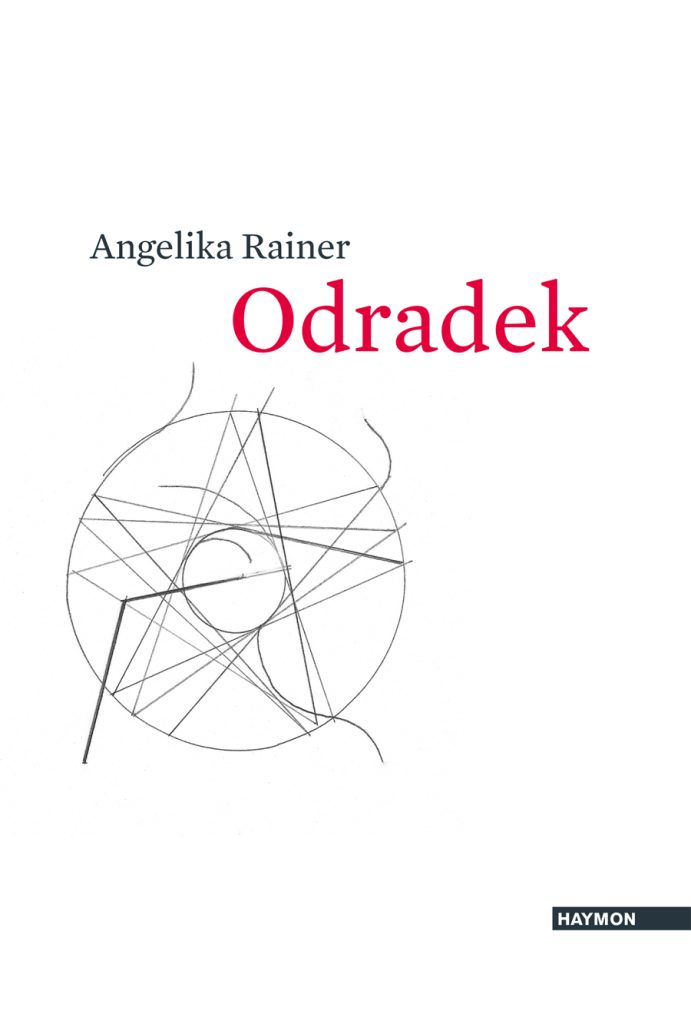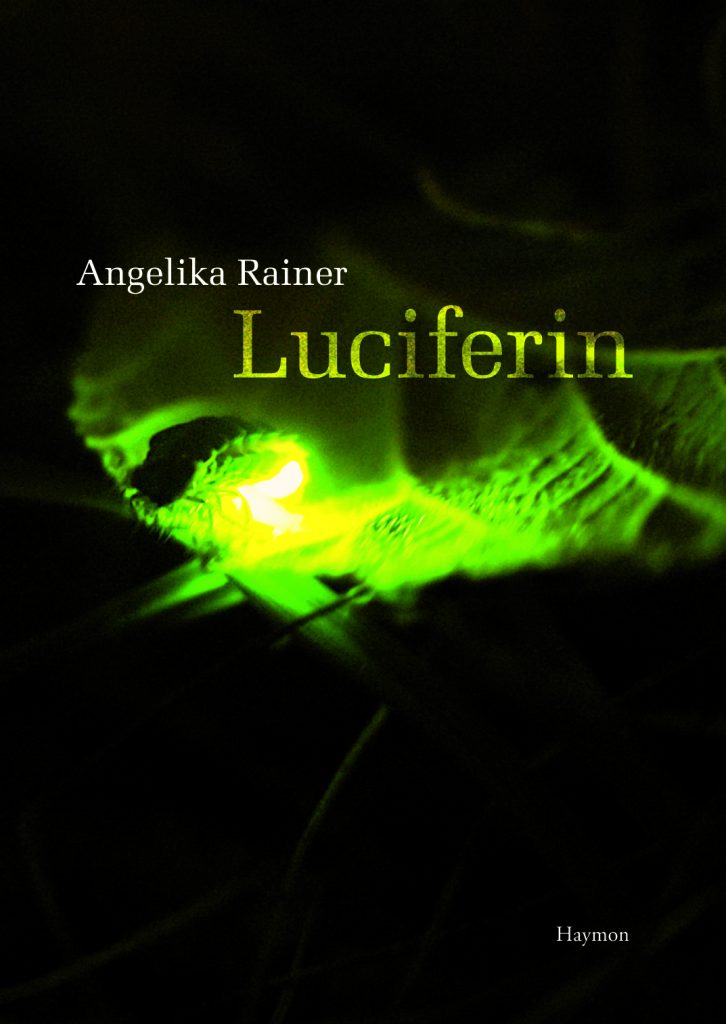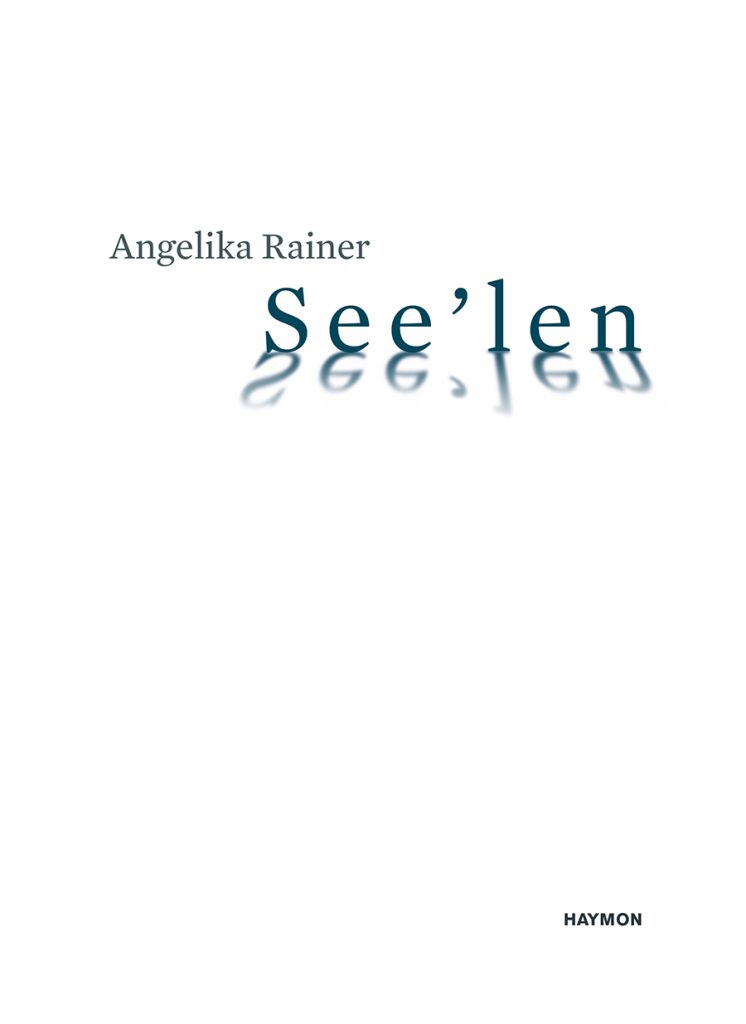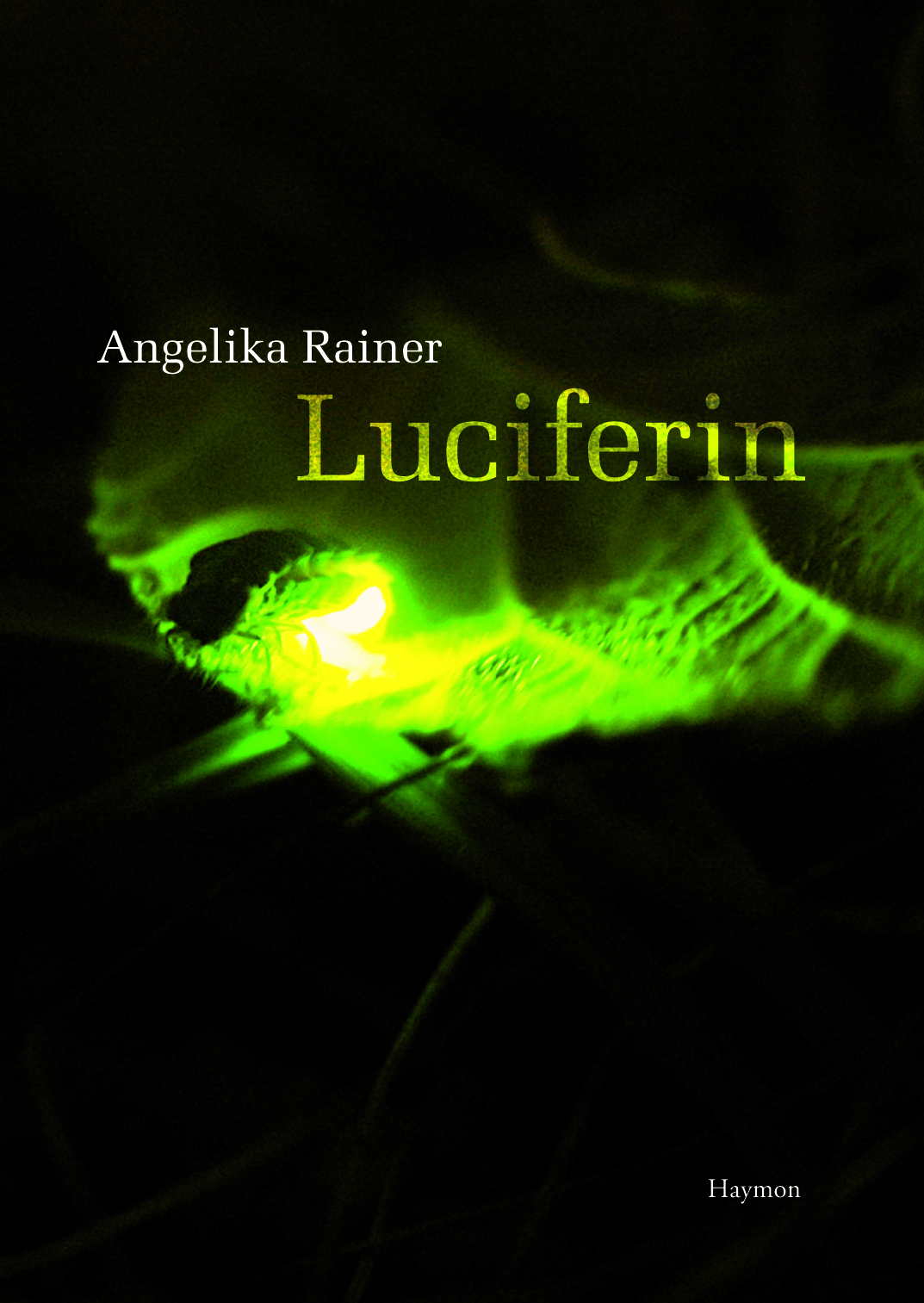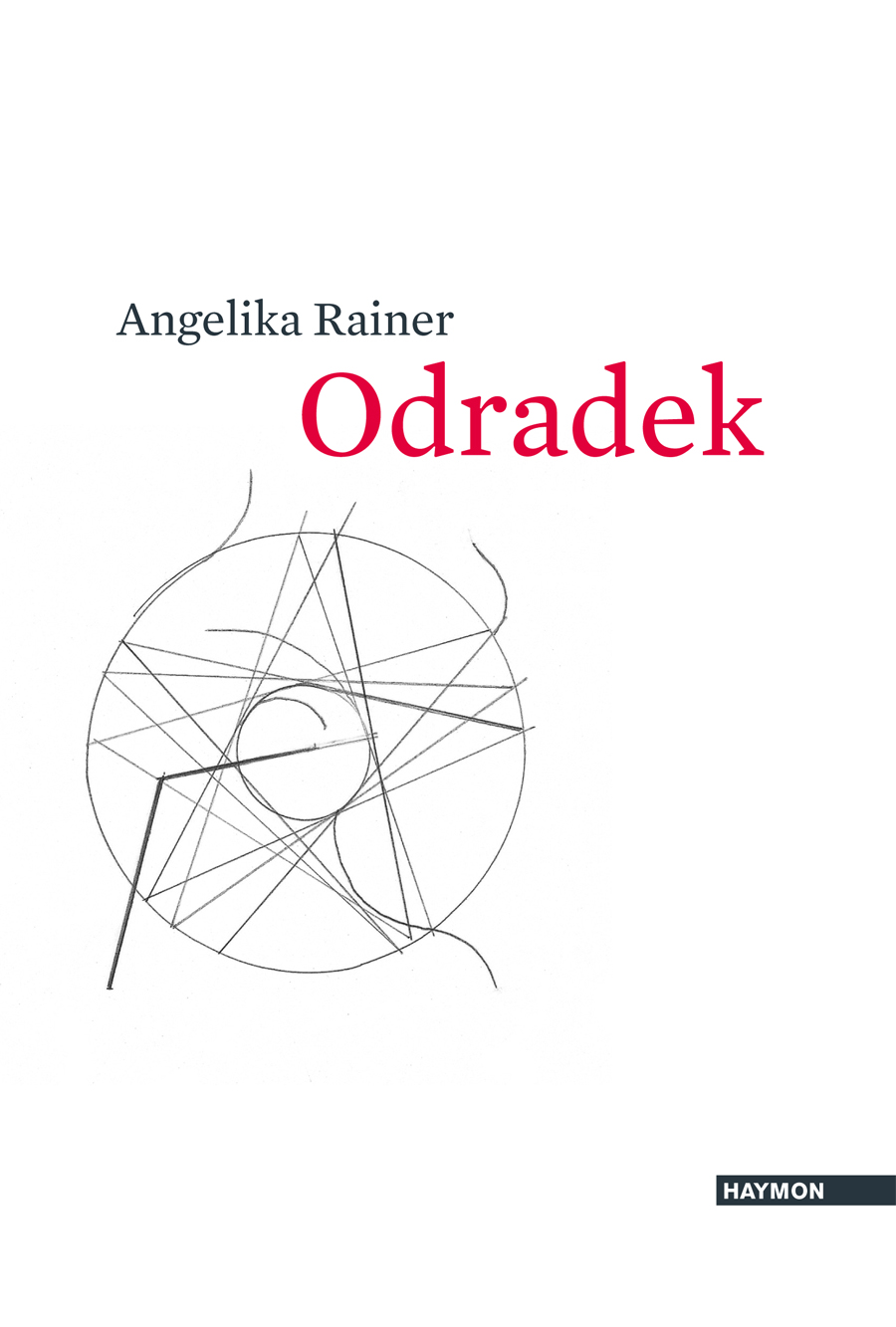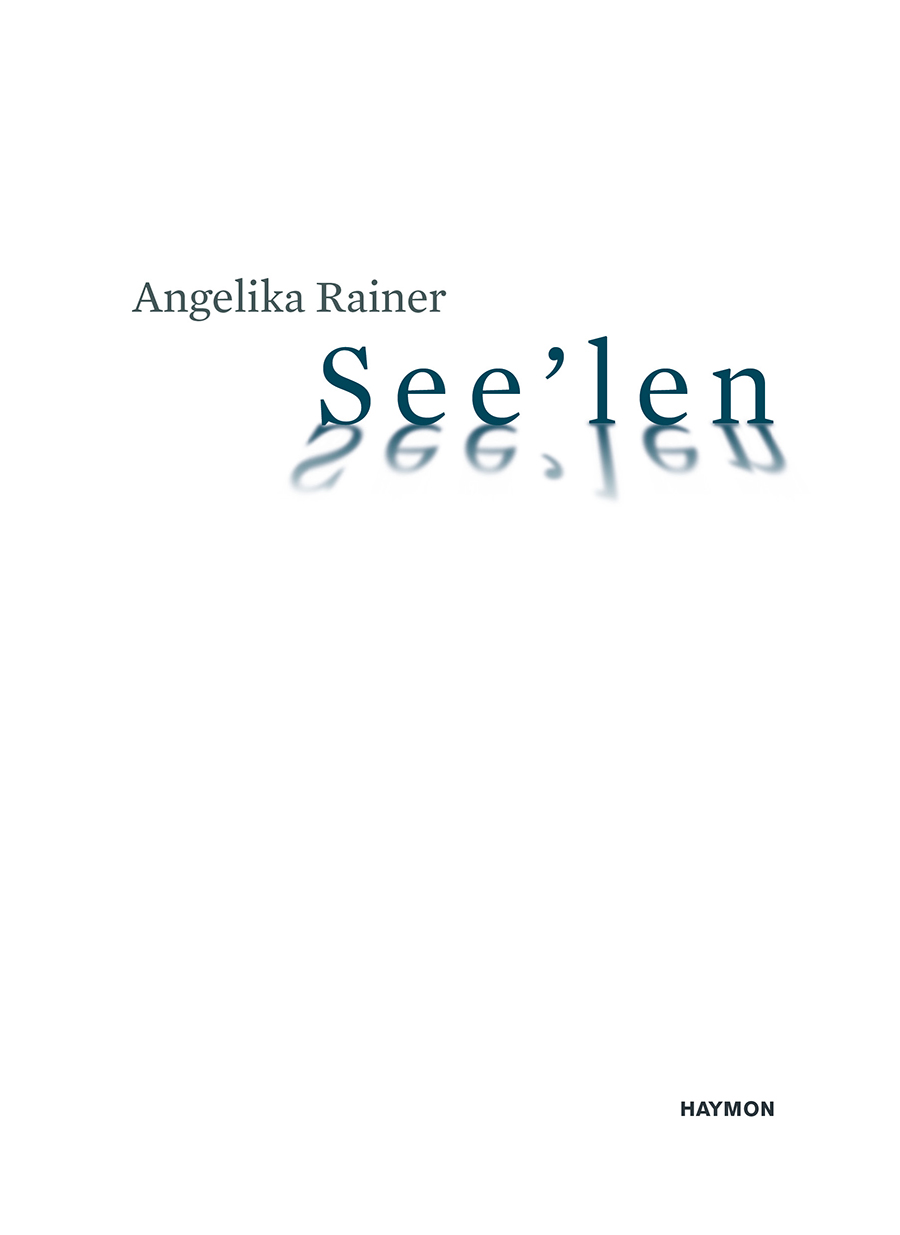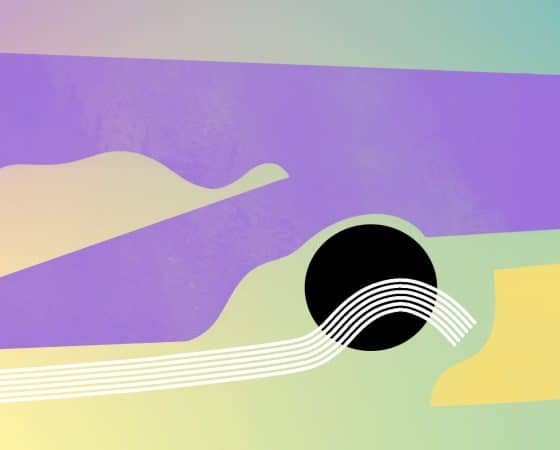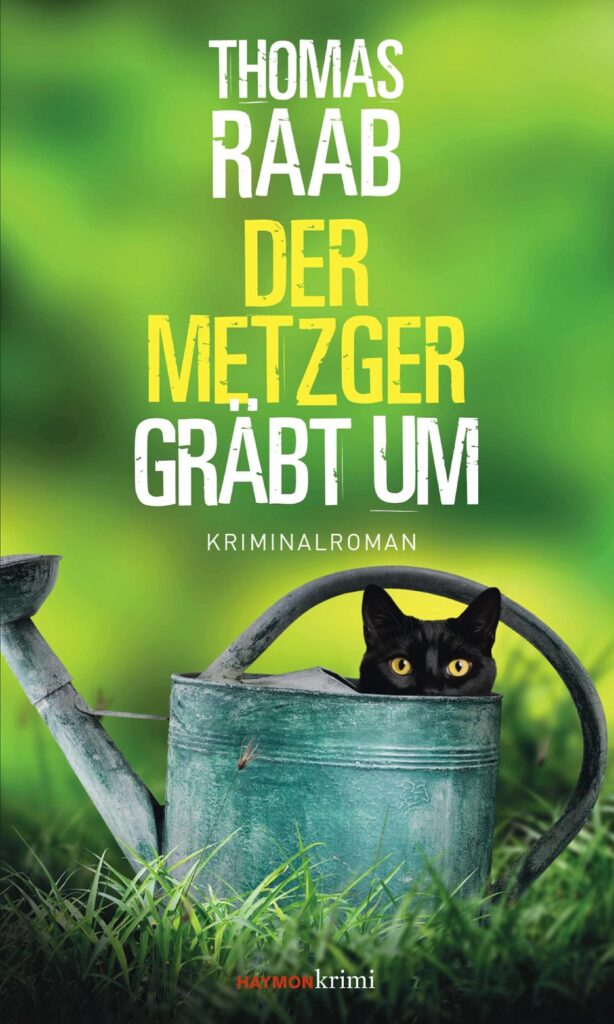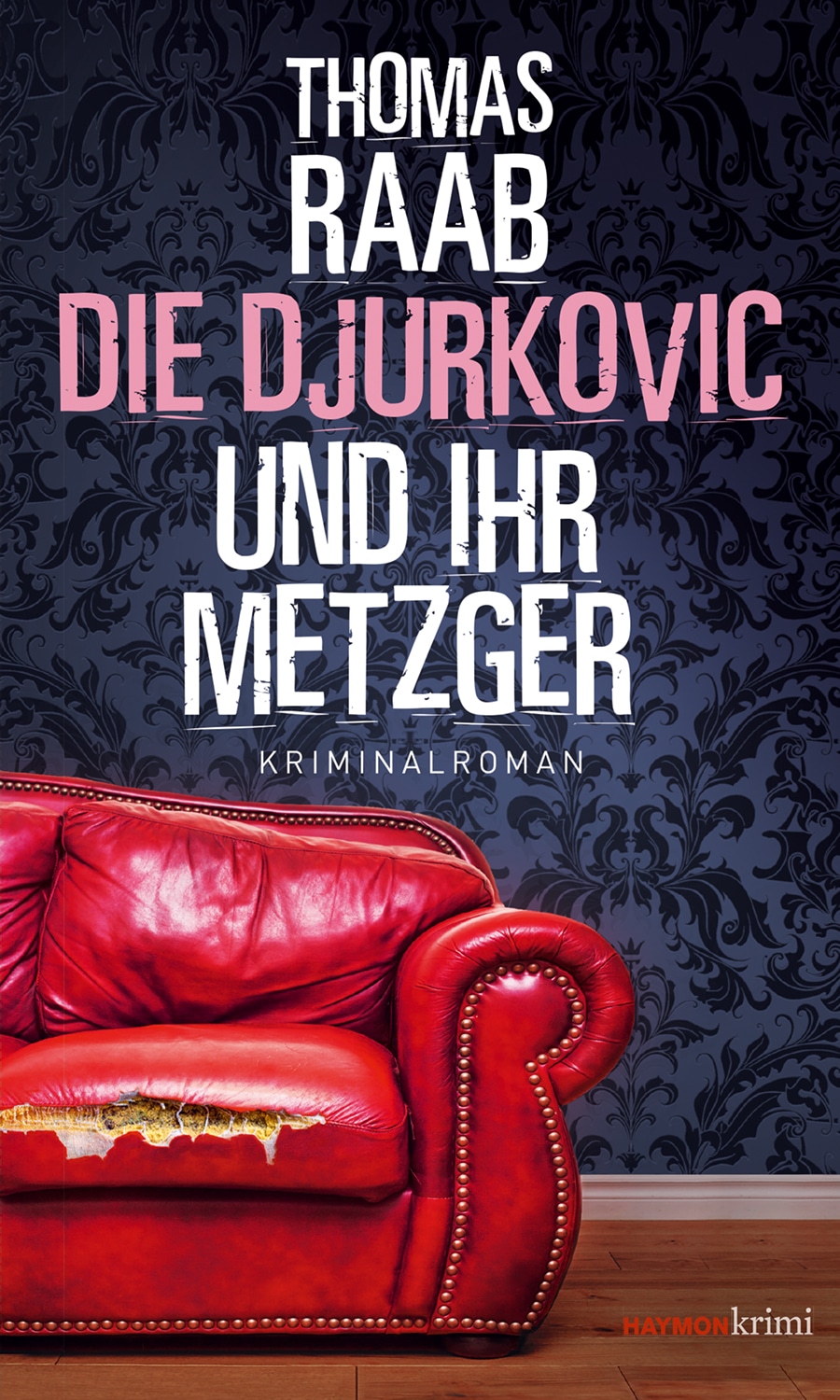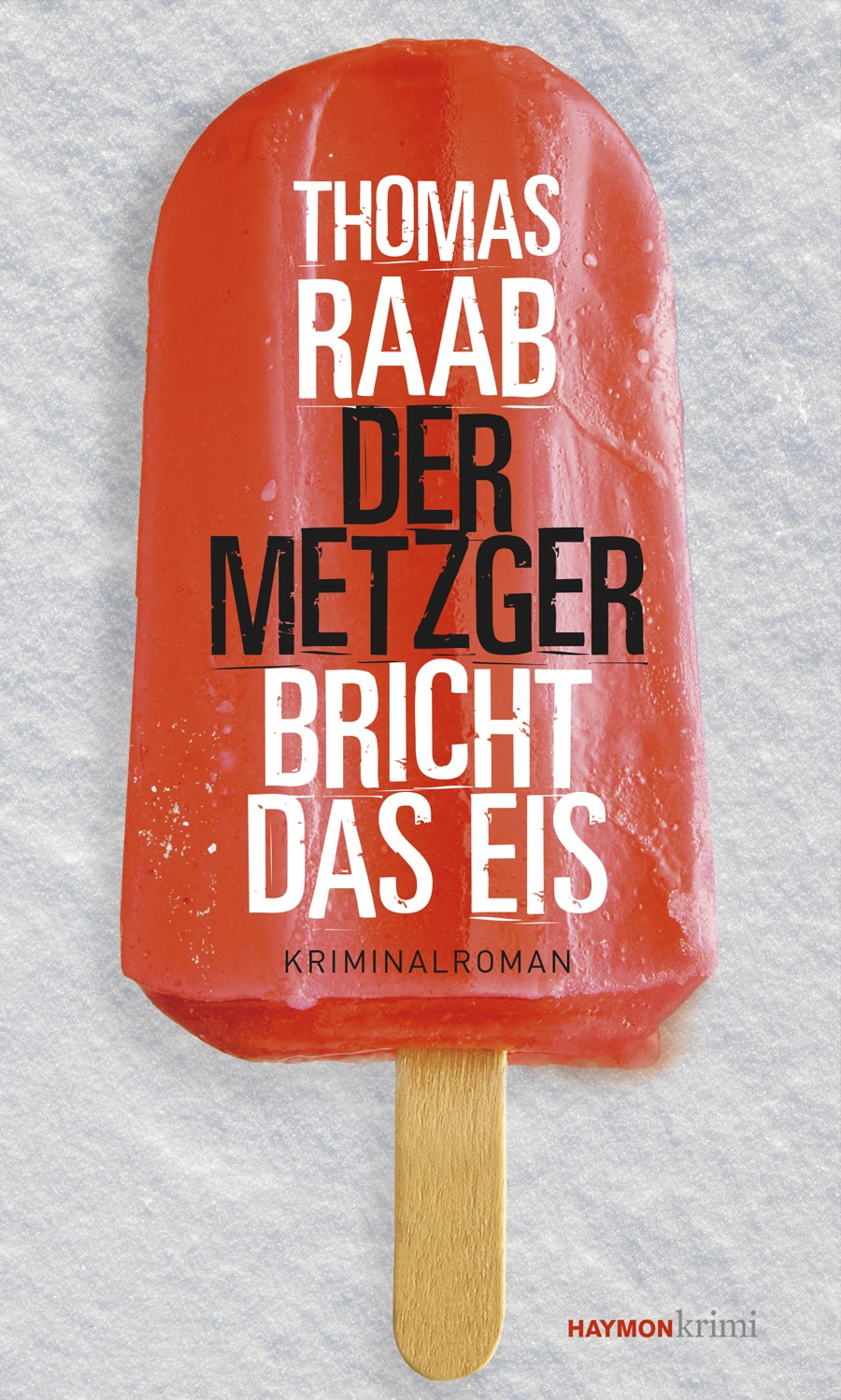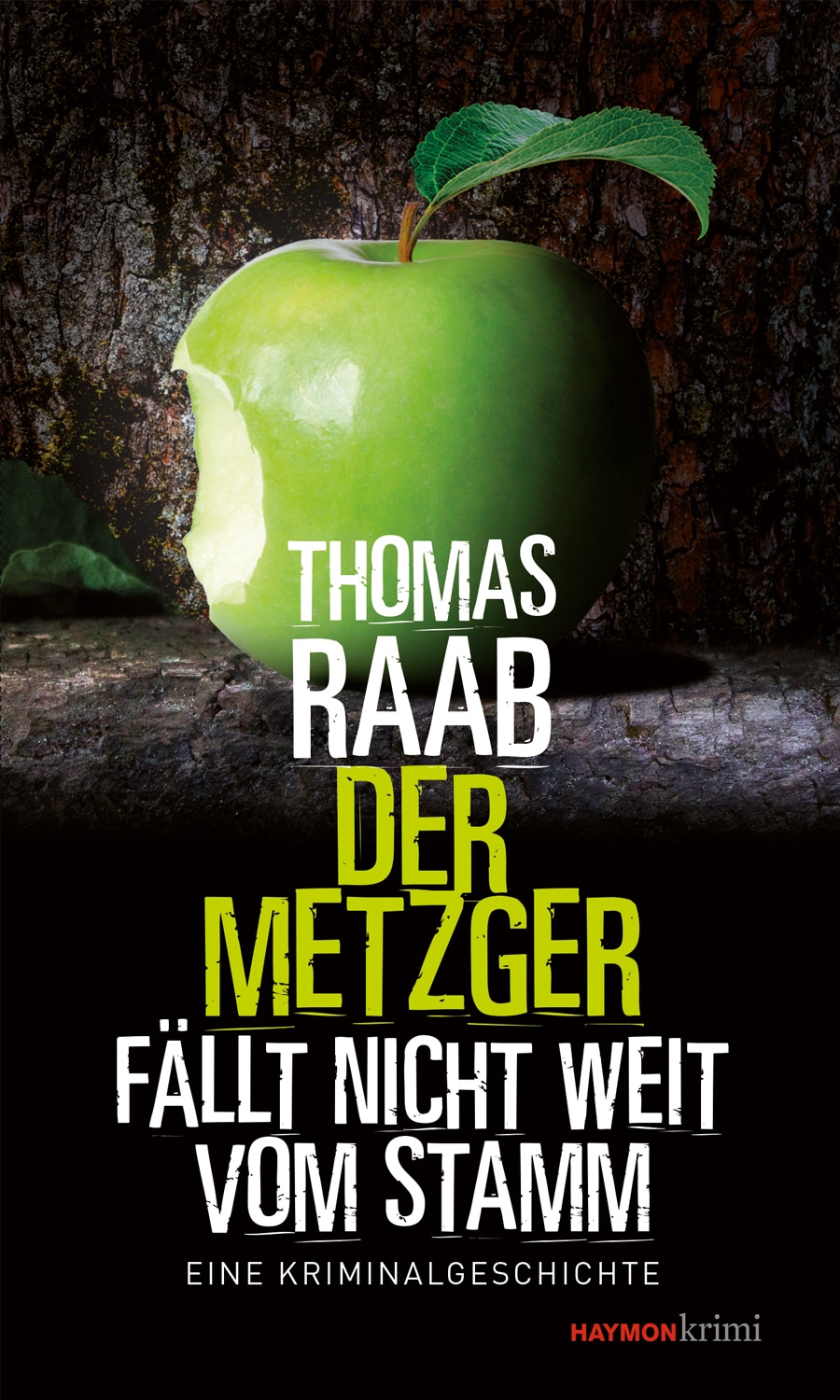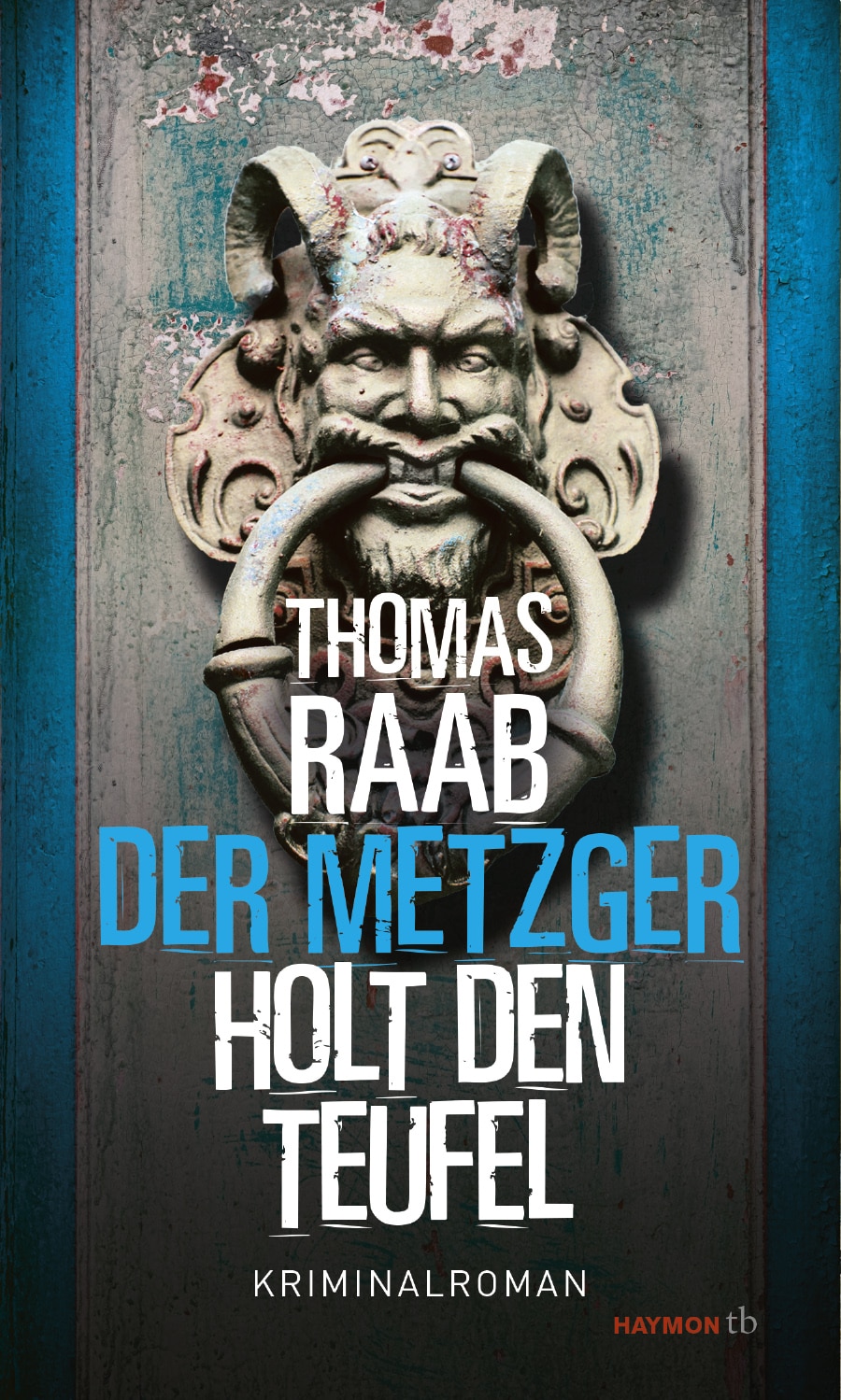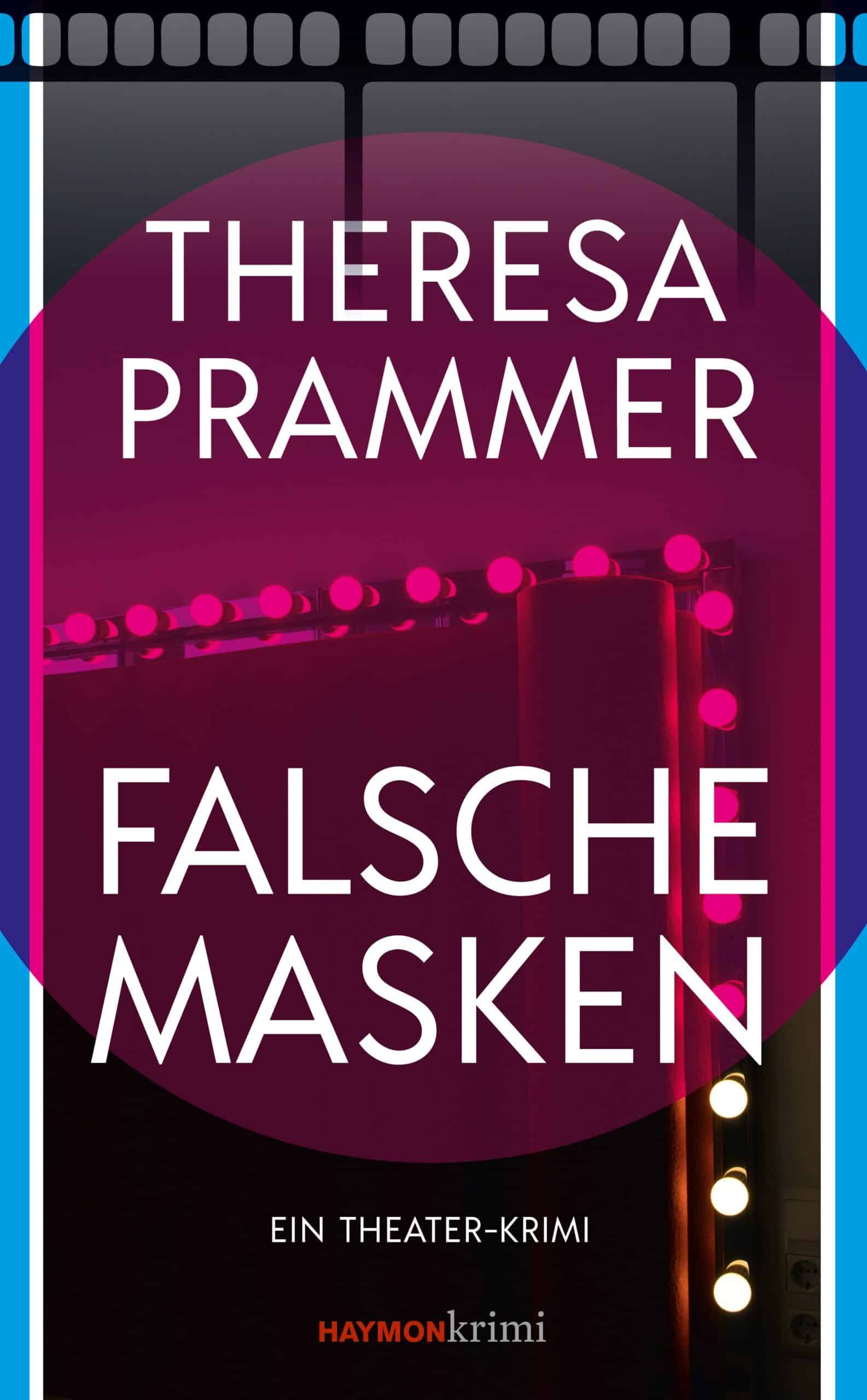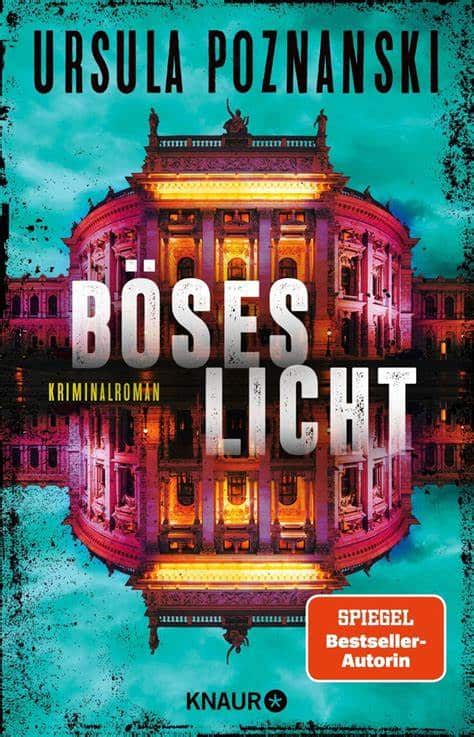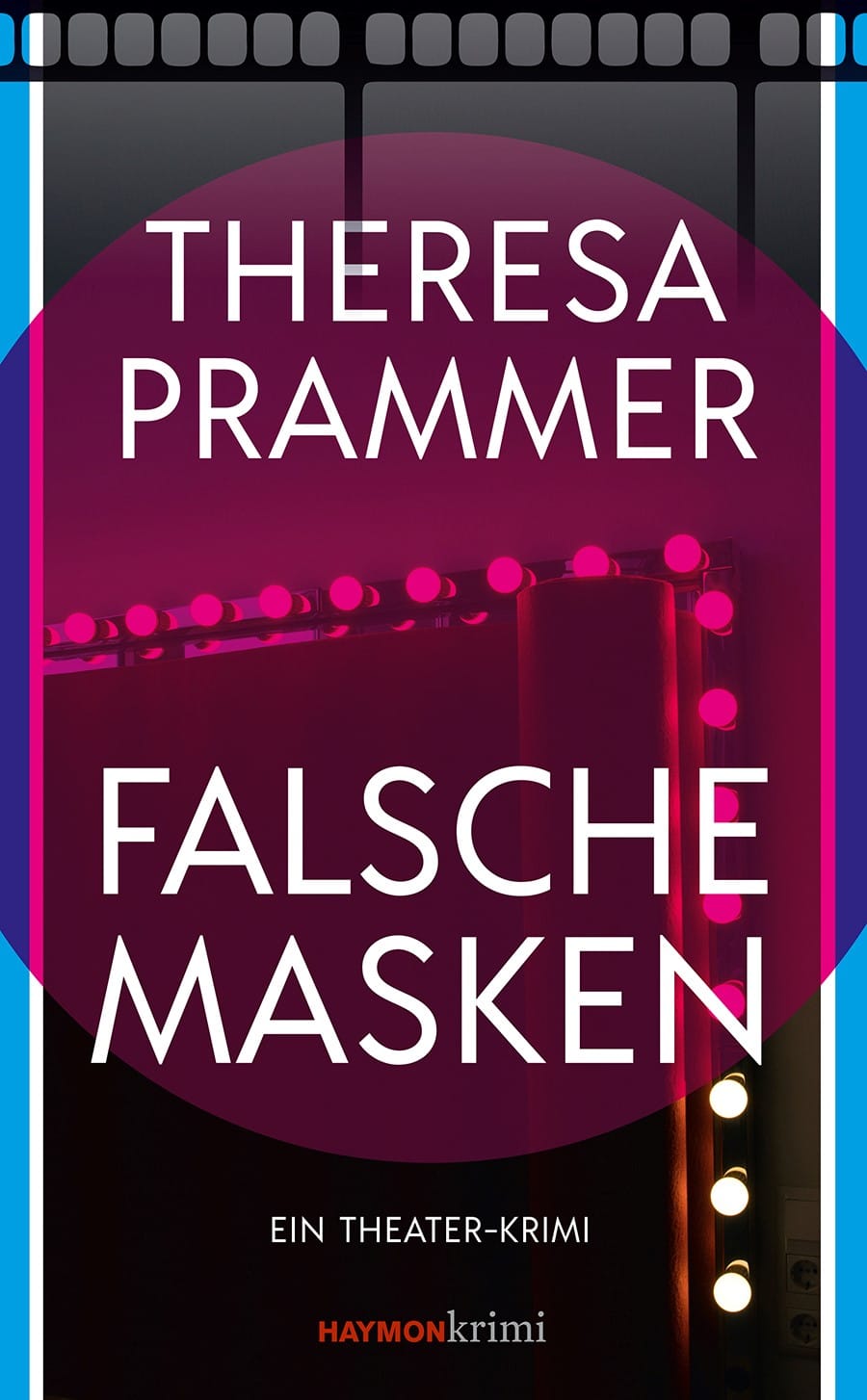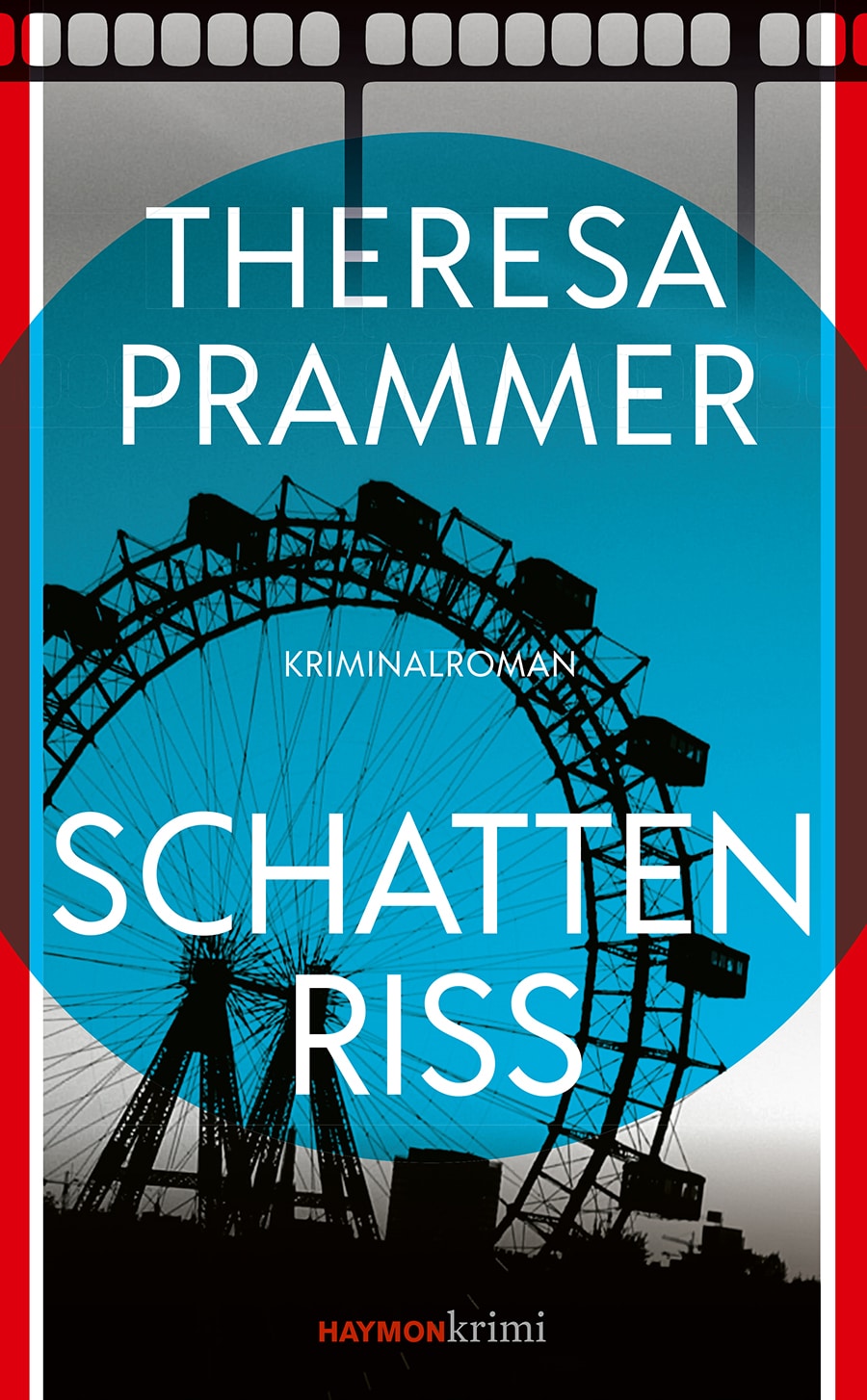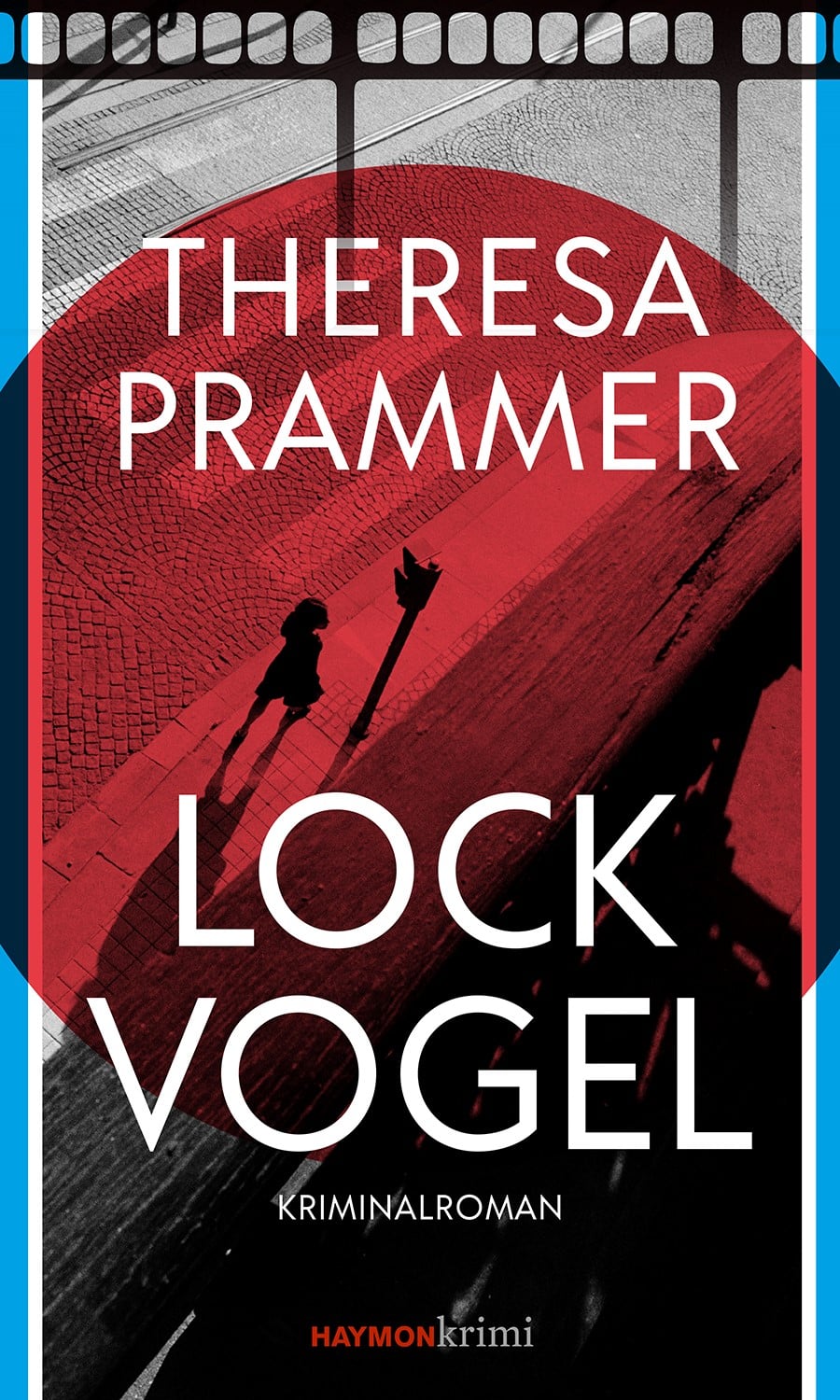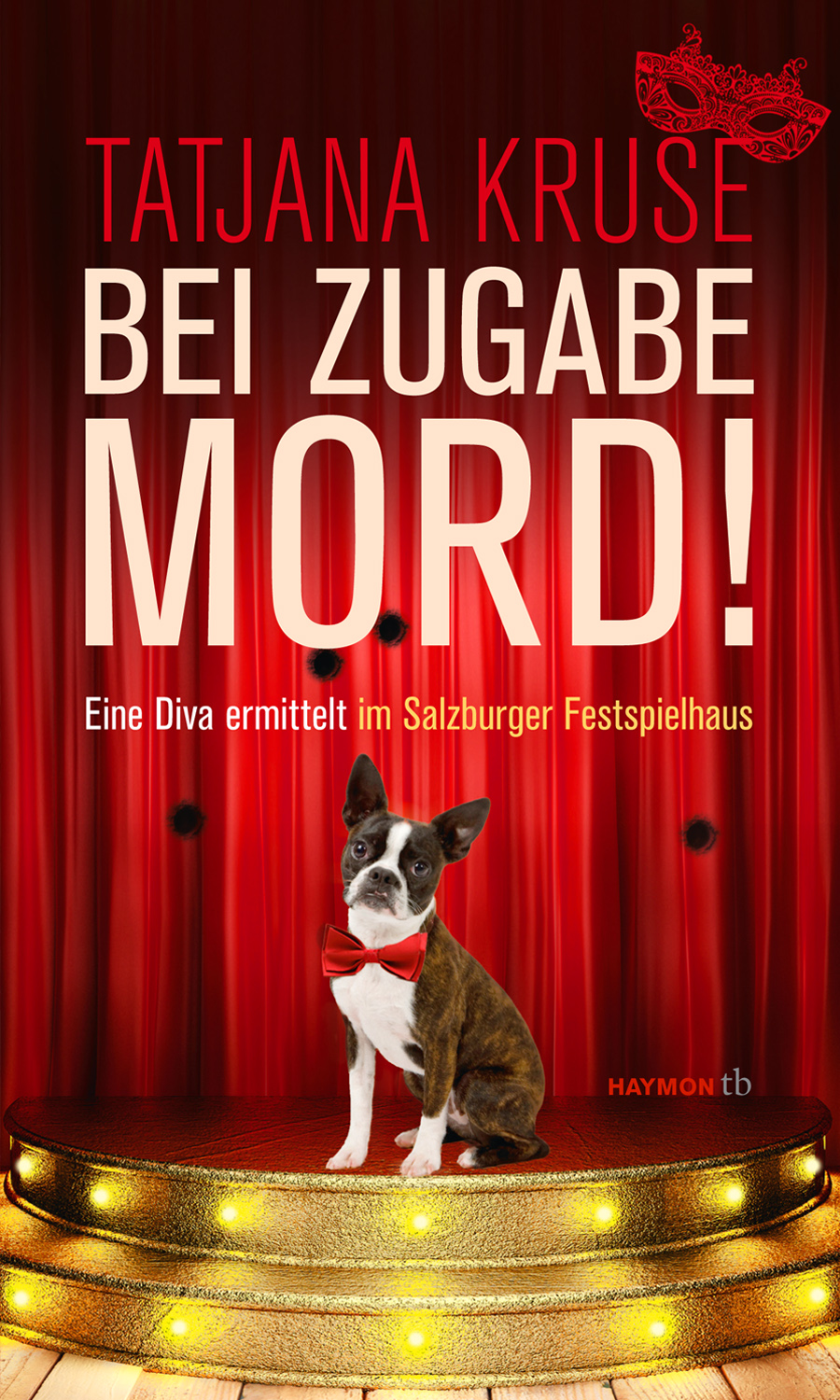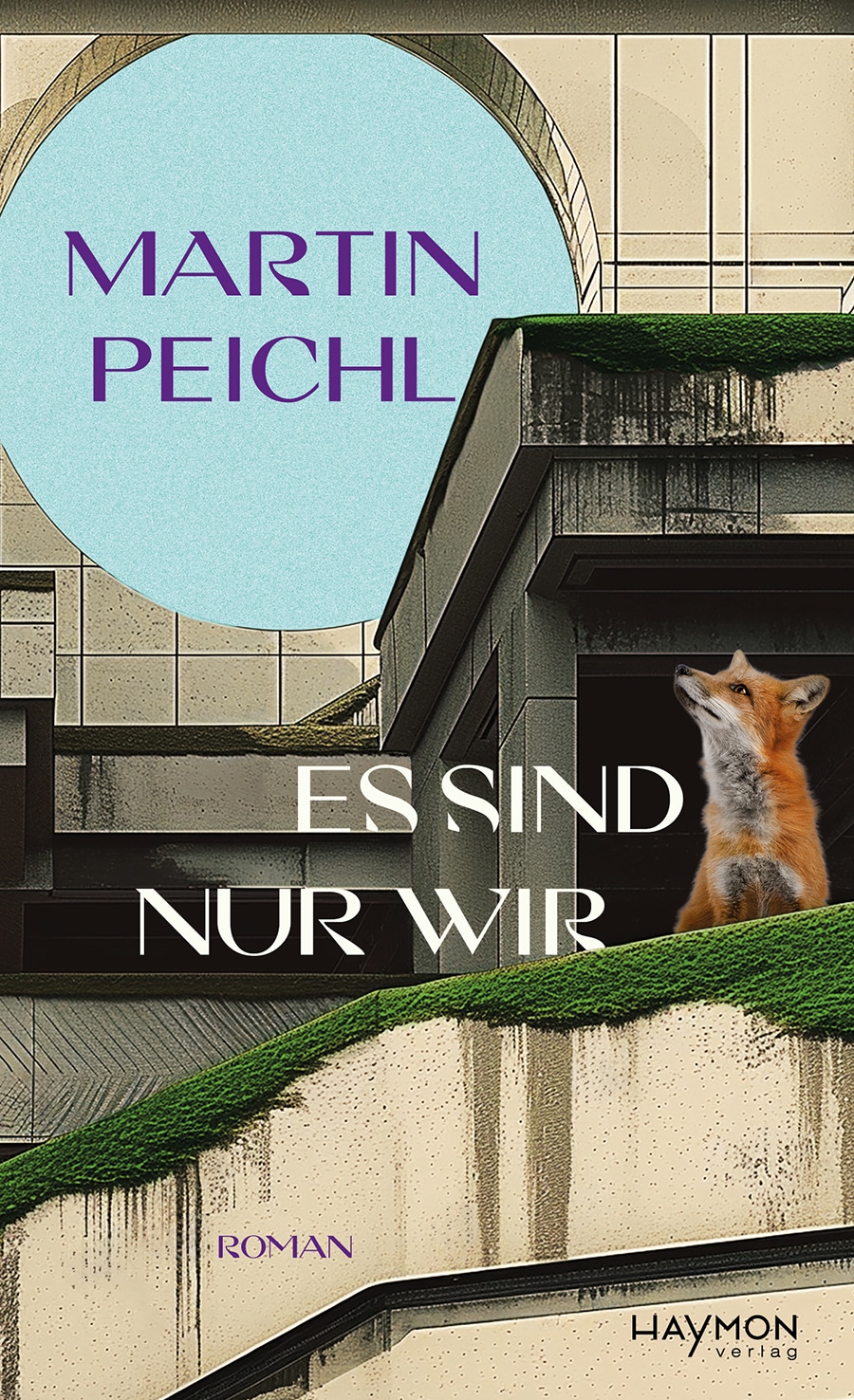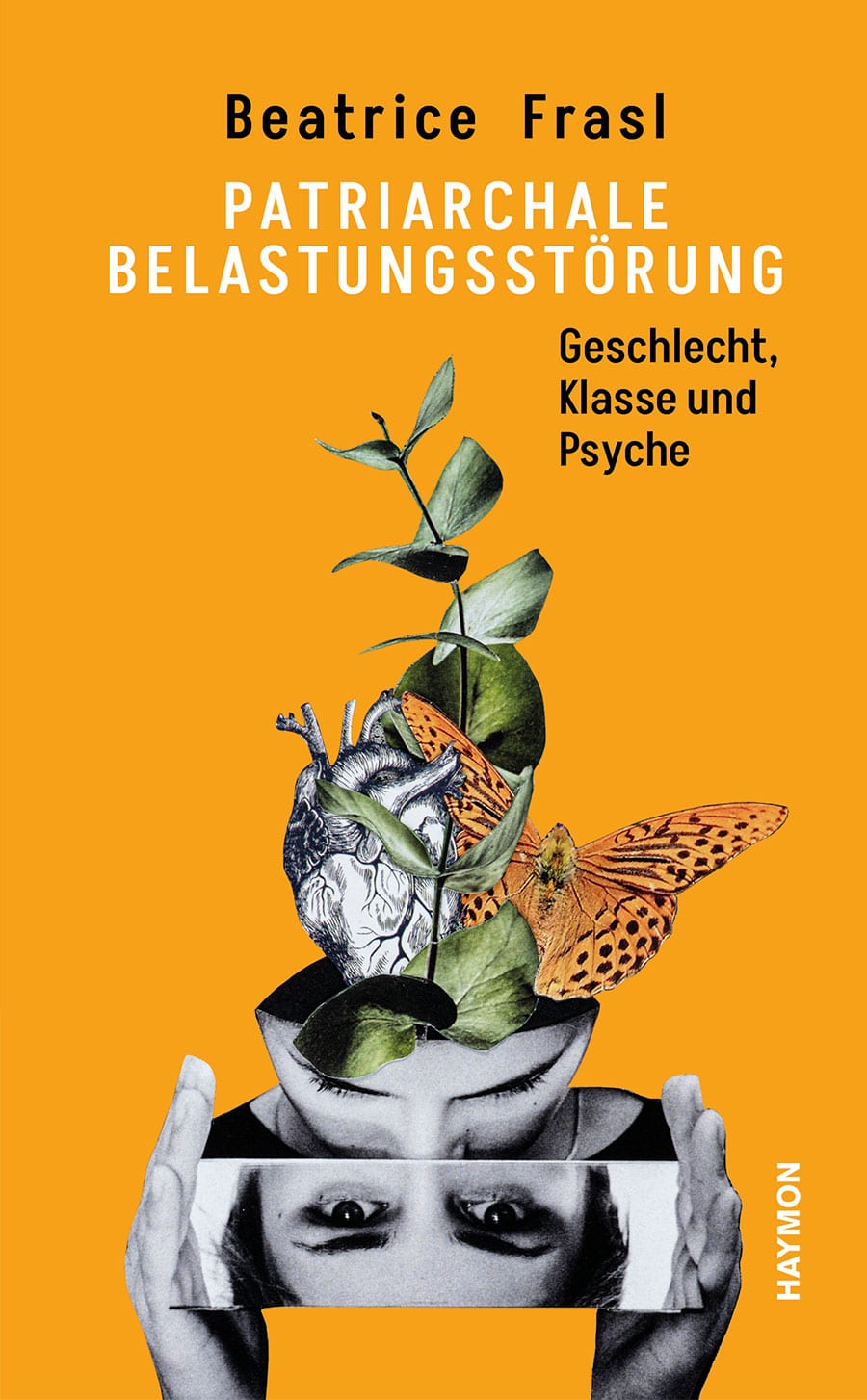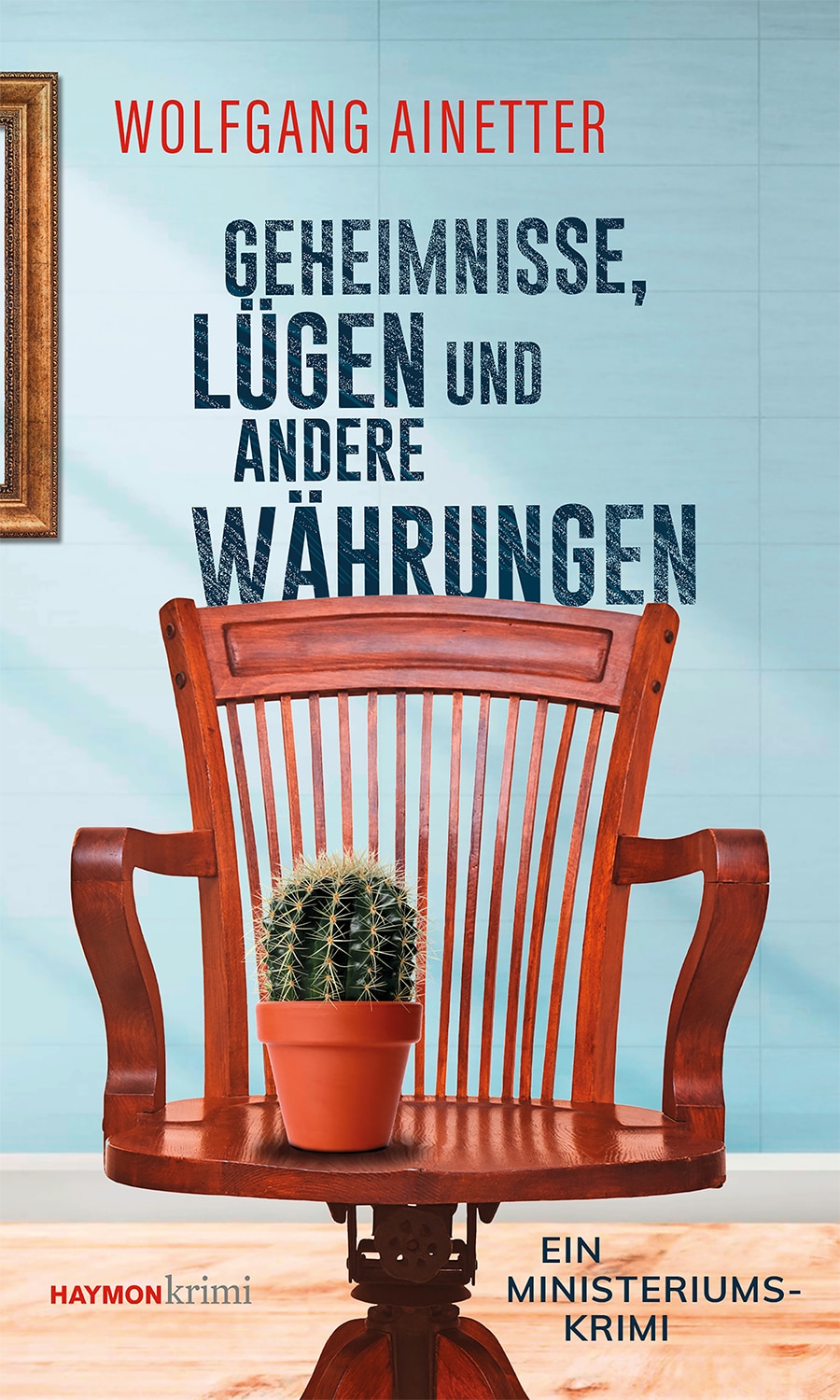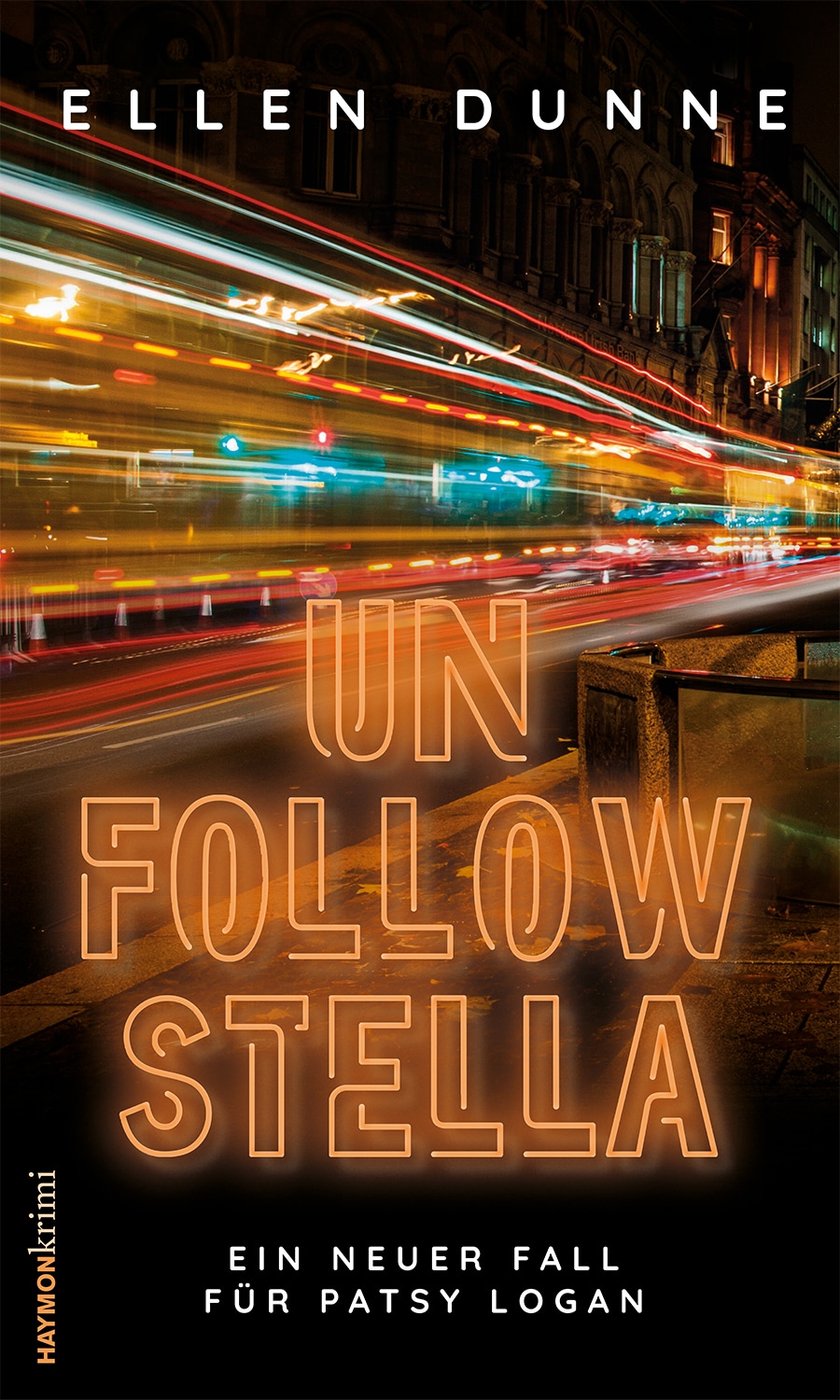Wie sieht beziehungsweise sah dein Arbeitsalltag aus? Welchen Anteil hat die nachtaktive Arbeit?
🚑
Sanitäterin: Insgesamt habe ich sieben Jahre als Sanitäterin gearbeitet. In den sieben Jahren habe ich 5 Jahre auch Nachtdienste (20 Uhr abends – 6 Uhr morgens) übernommen. Wir hatten insgesamt sechs Nachtdienst-Teams, die sich im Dienstplan abgewechselt haben. Hier konnte man während des Nachdienstes schlafen und wurde geweckt im Falle eines Einsatzes, der im besten Falle ein wenig mehr als eine Stunde in Anspruch nimmt. Danach konnte man sich wieder schlafen legen.
📦
Paketverteilerin: Die Arbeit bei DHL begann um 3 Uhr in der Nacht. Deshalb bin ich um 2 Uhr aufgestanden und bin dann um halb drei losgefahren zur Arbeit. Ich hatte nur zwei Schichten pro Woche, da ich als Studentin unter dem zu versteuernden Betrag bleiben wollte. Die Arbeit bestand darin, Pakete aus den LKWs zu entladen und dann auf die richtigen Fließbänder zu sortieren, um spätestens um 6 Uhr alle Pakete in die richtigen LKWs verladen zu haben für den Weitertransport/Auslieferung. Diese Arbeit habe ich insgesamt ein halbes Jahr gemacht, mit dem Ziel, mir als Studentin eine Reise nach Nepal finanzieren zu können.
🩺
Arzt: Als Arzt habe ich im Krankenhaus von Anfang an ca. vier Nachtdienste monatlich gemacht. Später als Oberarzt hatte ich sowohl Nachtdienste als auch Bereitschaftsdienste bis zu einer Woche monatlich, bei denen ich nachts jederzeit zu Hause geweckt werden konnte und in die Klinik fahren musste.
🛎️
Nachtportier: Ich habe früher neben dem Studium als Nachtportier gearbeitet. Und nicht nur rückblickend war das ein interessanter, fordernder und auch verantwortungsvoller Job, den ich sehr gern gemacht habe und bei dem ich nicht zuletzt auch viel gelernt habe. In den ersten Stunden von 22 Uhr bis ca. 1 Uhr versah ich die Aufgaben eines Rezeptionisten, wickelte die Anreisen ab und war natürlich erste Anlaufstelle aller Hotelgäste für alle Fragen. Sobald die Bar geschlossen hatte, begann ein Kontrollgang, bei dem die Türen abgesperrt wurden und ich war für den Tagesabschluss zuständig, dokumentierte und kontrollierte die Kassa, programmierte Weckrufe, erstellte Rechnungen und Listen usw. Dann brachen in der Regel mehrere Stunden an, die ruhiger waren und die ich hervorragend zum Lesen nutzen konnte, sofern die Arbeit es zuließ. Das war nicht immer gegeben, an Wochenenden in einem großen innerstädtischen Hotel ist oft im Haus und auch außerhalb viel Betrieb, mal wollen intoxikierte Personen sich Zugang verschaffen, mal sind es Lärmbeschwerden innerhalb des Hauses, medizinische Notfälle, auch Feueralarme, die mich auf Trab hielten. Als einziger Angestellter in einem Haus mit teilweise weit über 100 bewohnten Zimmern gebietet es ja das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten, dass zwangsläufig jemand Hilfe braucht, nicht in den Schlaf findet, usw. Der surreale Gedanke, dass mehrere hundert Menschen in diesem Moment gerade alle über mir in ihren Zimmern schlafen und alles, was man hört, ist das laute Klackern und Poltern der Eismaschine in der Bar, kam mir dennoch erstaunlich oft. Gegen 4:00 morgens fing das Leben wieder an, die Brotlieferung kam, die Frühstücksköche trafen ein und ab 6 Uhr war ich wieder als „klassischer Rezeptionist“ im Einsatz, beim Auschecken, Kassieren, Informieren. Um 7 Uhr wurde ich in der Regel abgelöst.
👩⚕️
Pflegefachkraft: Ich arbeite in einem Krankenhaus als examinierte Pflegekraft. Ich arbeite im klassischen 3-Schicht-System. Das heißt, dass unsere Frühschicht um 6 beginnt, hier muss ich um 4 Uhr aufstehen. Was genau passiert, ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Es gibt feste Termine, Besprechungen, Übergabezeiten, aber auch diese können manchmal nicht eingehalten werden. Ich arbeite auf einer unfallchirurgischen/orthopädischen Akutstation, es gibt keine geplanten Aufnahmen. Wenn sich jemand etwas bricht, kommt diese Person zu uns, das kann morgens um 06:30 in der Übergabezeit sein, um 10:00, wenn man versucht, Pause zu machen, oder auch nachts um 02:15, wenn alle schlafen sollten. Der Spätdienst geht bis 22:30 Uhr, was bedeutet, dass ich hier auch ohne Nachtschicht häufig erst nach 02:00 Uhr ins Bett gehe, um dann auszuschlafen, nur damit ich überhaupt so lange durchhalte. Obwohl es nicht zur klassischen Nachtschicht zählt, ist auch mein Spätdienst azyklisch. Man lebt an allen anderen vorbei, auch in einem 5-Personen-Haushalt kam es dann vor, dass ich über eine Woche lang niemanden zuhause gesehen habe. Unsere Nachtschicht beginnt um 21:00 Uhr und endet um 06:30. Hier gibt es pflegerisch-medizinisch drei Rundgänge zu erledigen, feste Zeiten für intravenöse Medikamentengaben und viele Dokumentations- und Aufräumarbeiten. Hier gibt es auch feste Zeiten, jedoch arbeitet man die Arbeit so ab, wie man es an die Patient*innen anpassen kann. Für viele meiner älteren Patient*innen, die als Nebendiagnose beispielsweise eine dementielle Entwicklung haben oder nach ihrer Operation im Delir sind, ist der Tag-Nacht-Rhythmus gestört. So kann es passieren, dass nachts manchmal der Pflegeaufwand höher ist als tagsüber. Orientierung geben, Patient*innen mit Hinlauftendenz suchen, die von Station verschwunden sind, Menschen mit Angstzuständen beizustehen – all das sind Aufgaben, mit denen ich vor Ausbildungsbeginn nicht gerechnet hätte. Ich mache meist 6-8 Nachtschichten im Monat, 2 Mal 3-4 Stück, mehr schaffe ich nicht gut.
🍸
Barkeeper: Gastronomie. Ganz unterschiedlich, ich habe meistens wechselnde Schichten, sodass ich sowohl Tages- als auch Nachtschichten habe. Generell ist das ganze eher wechselhaft als routiniert.