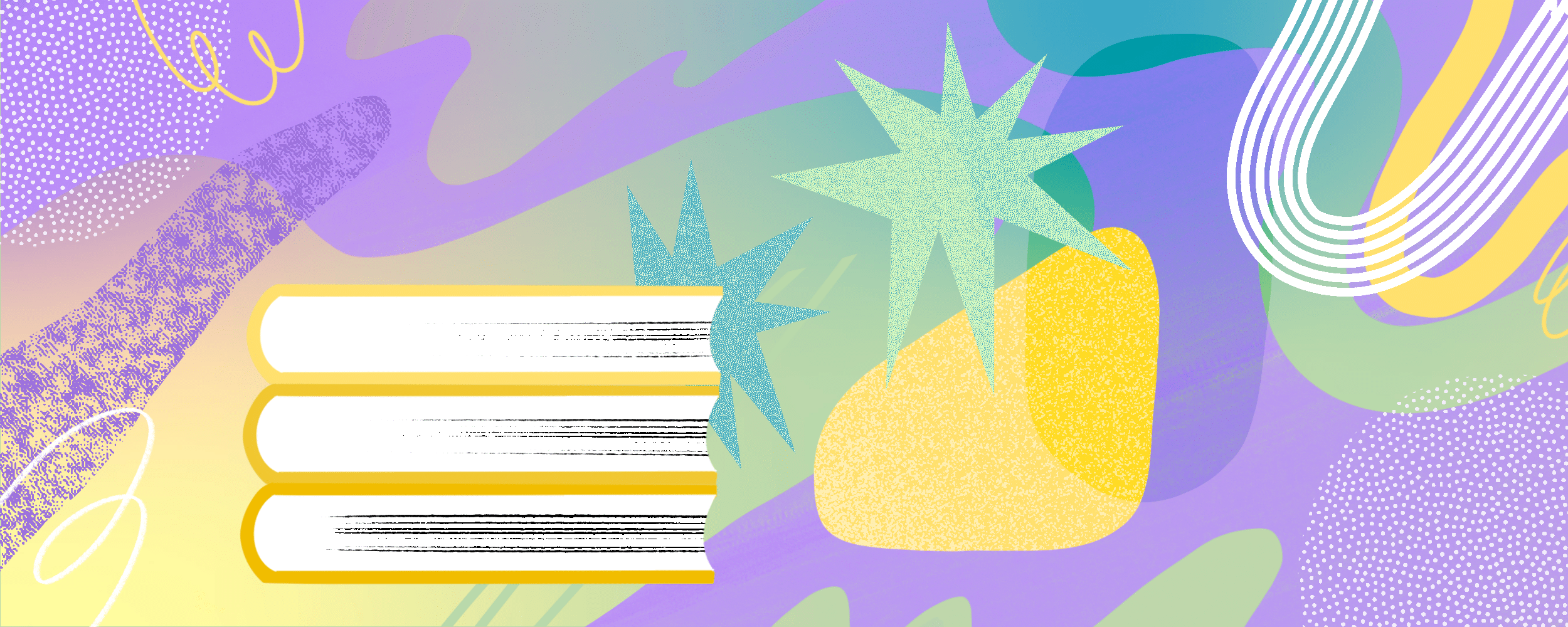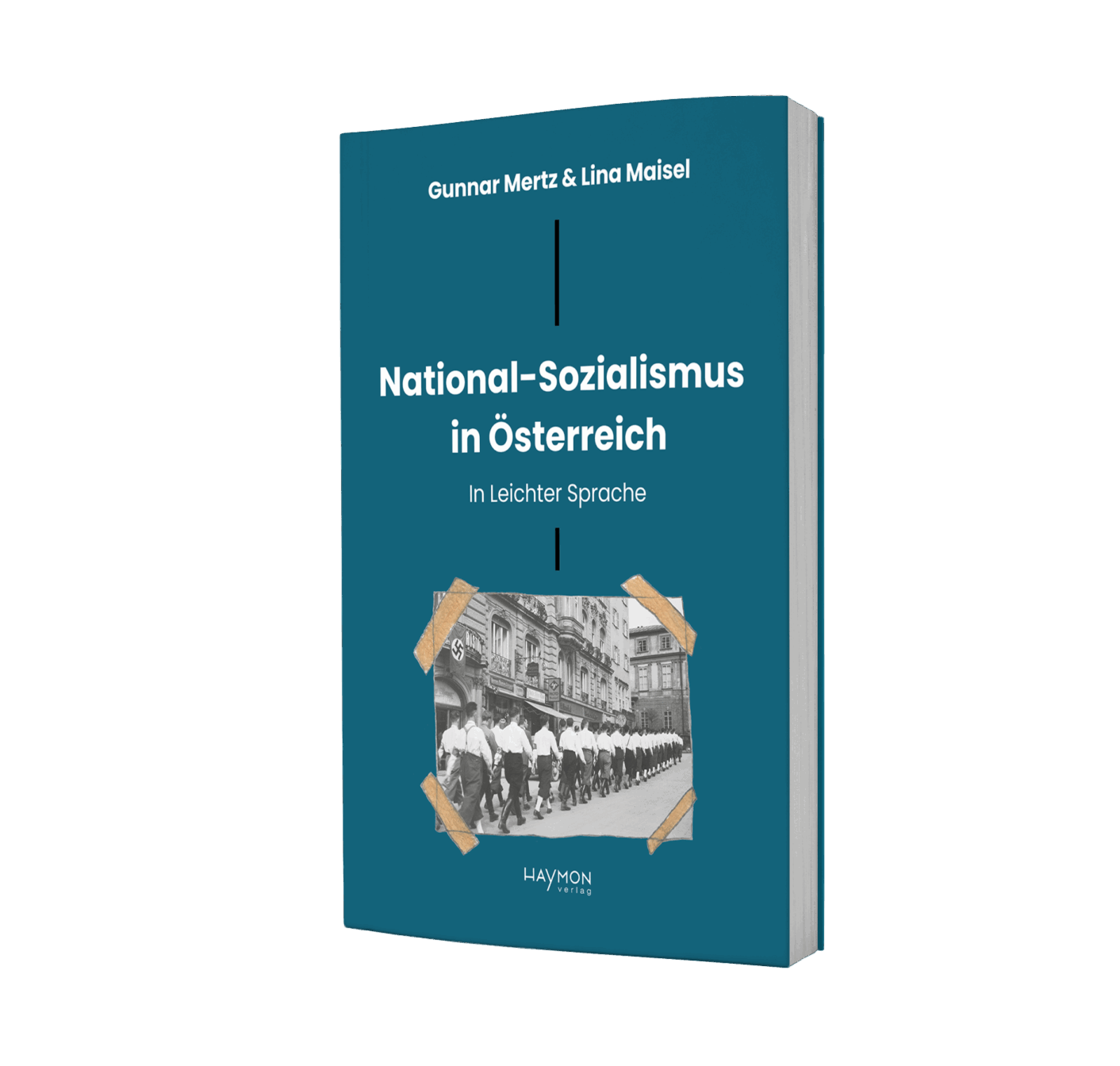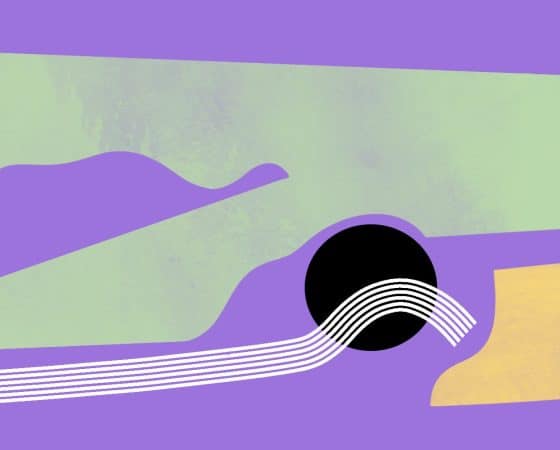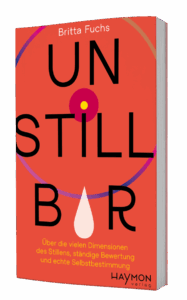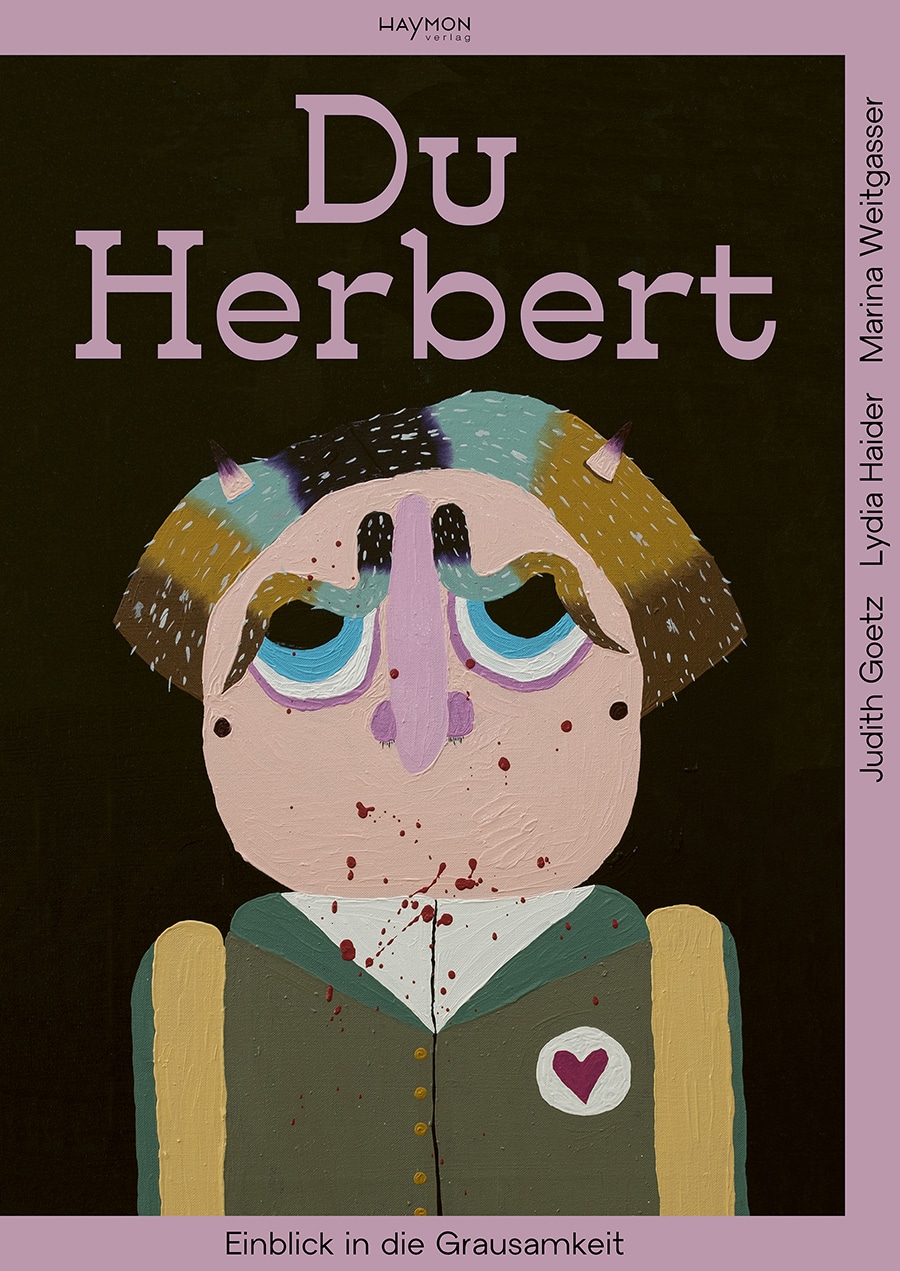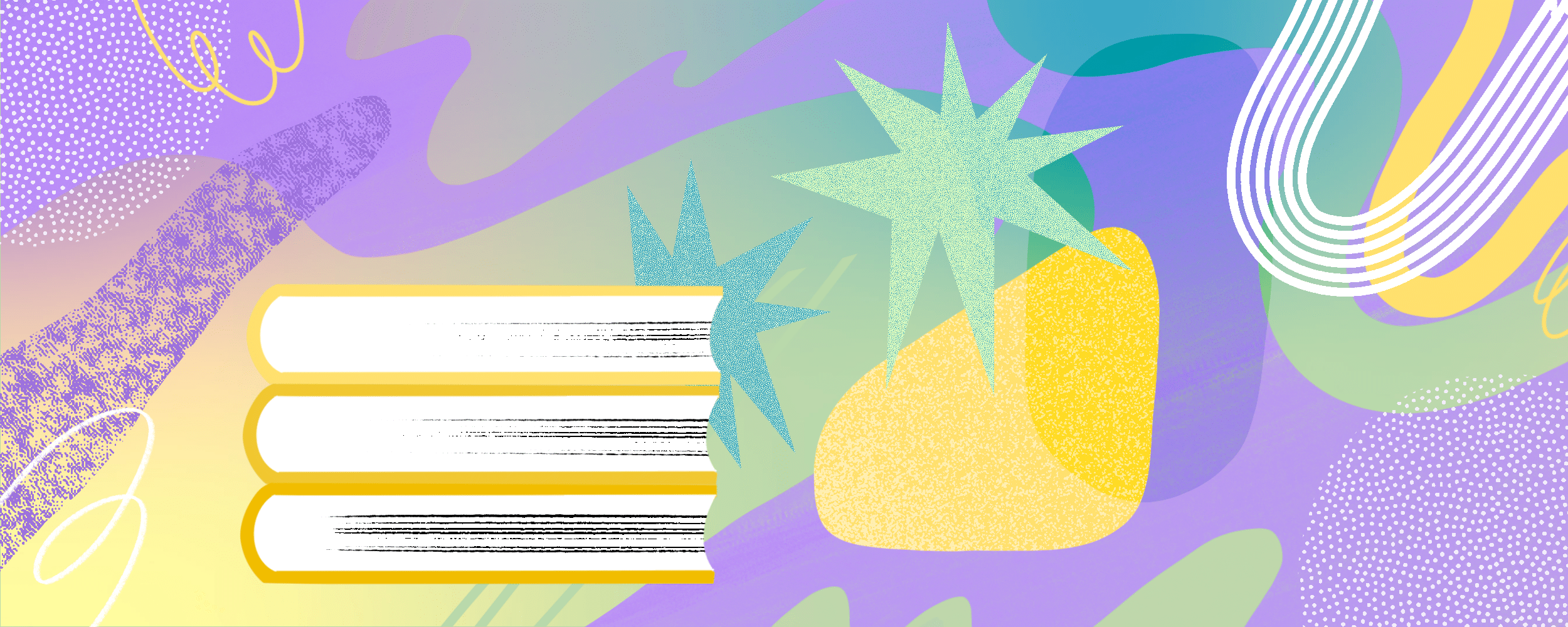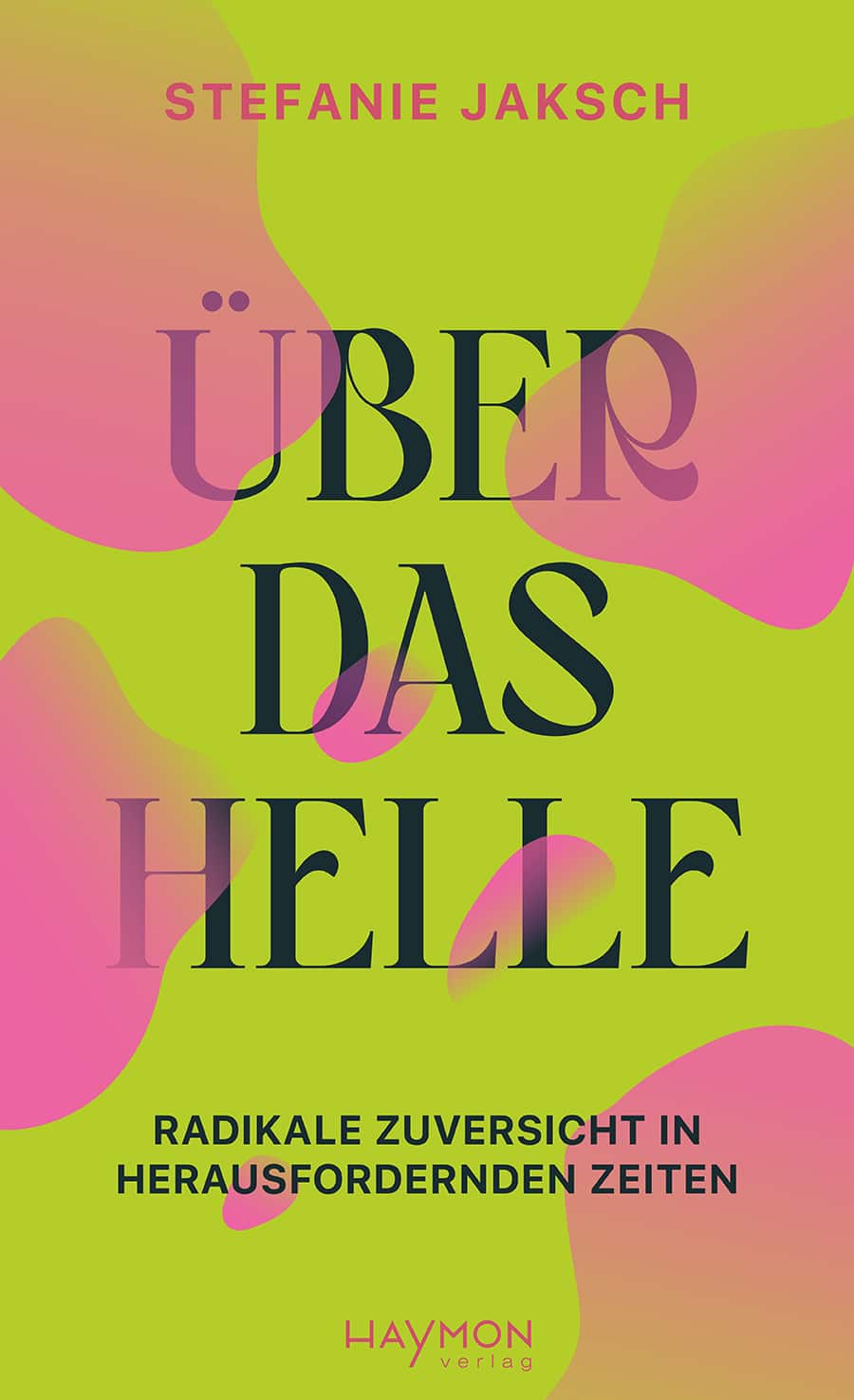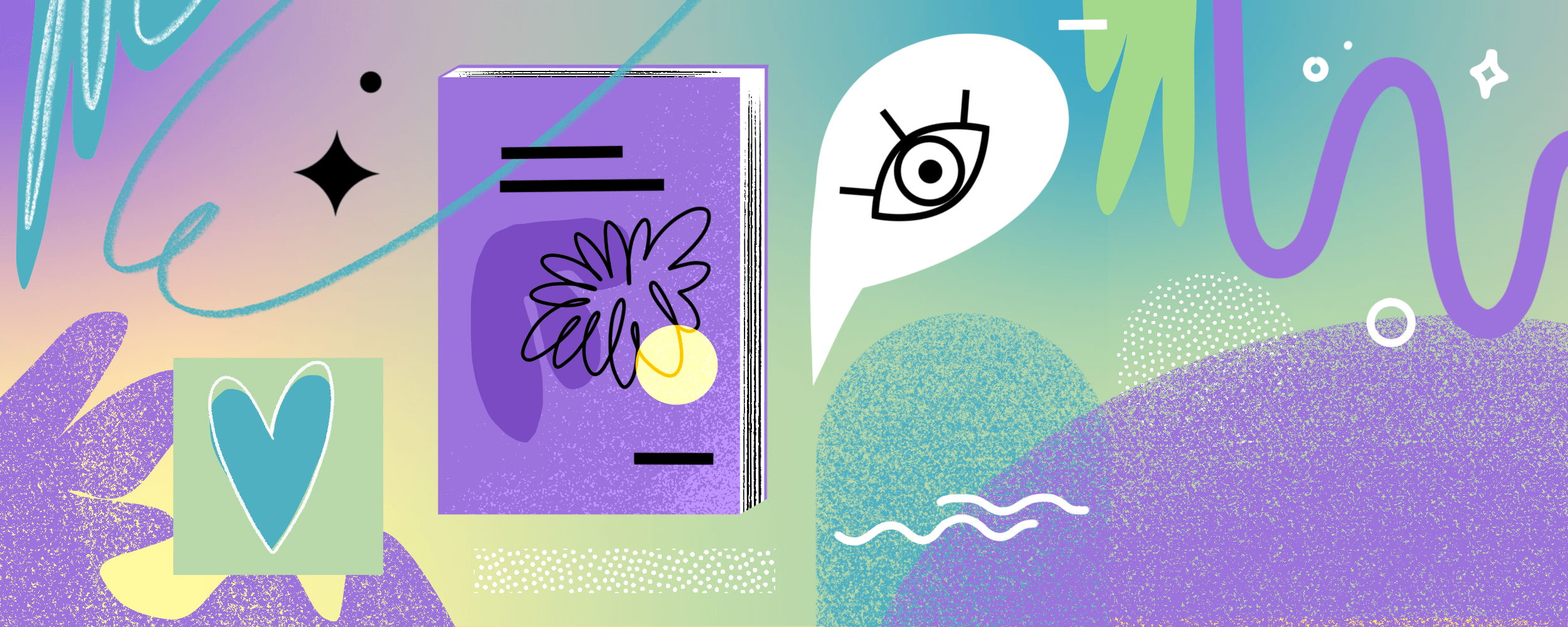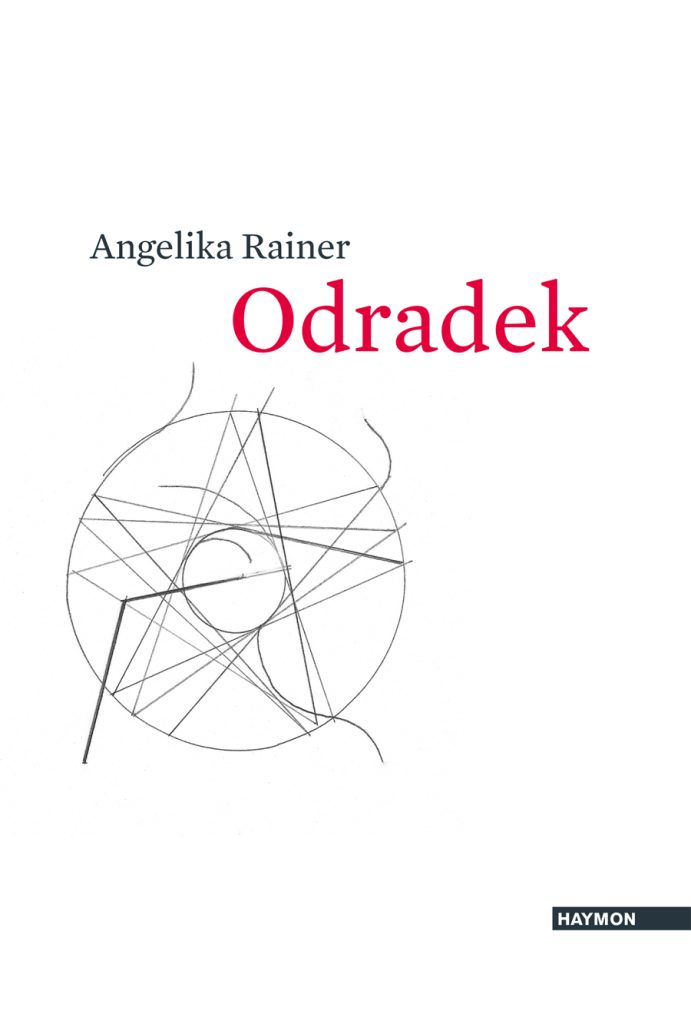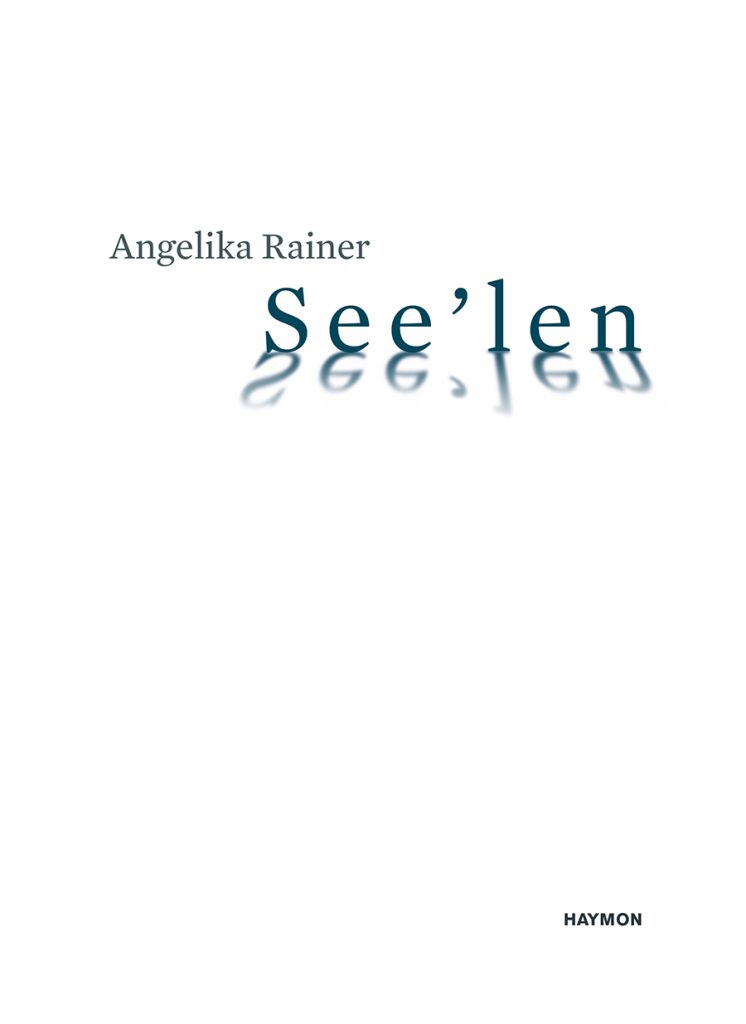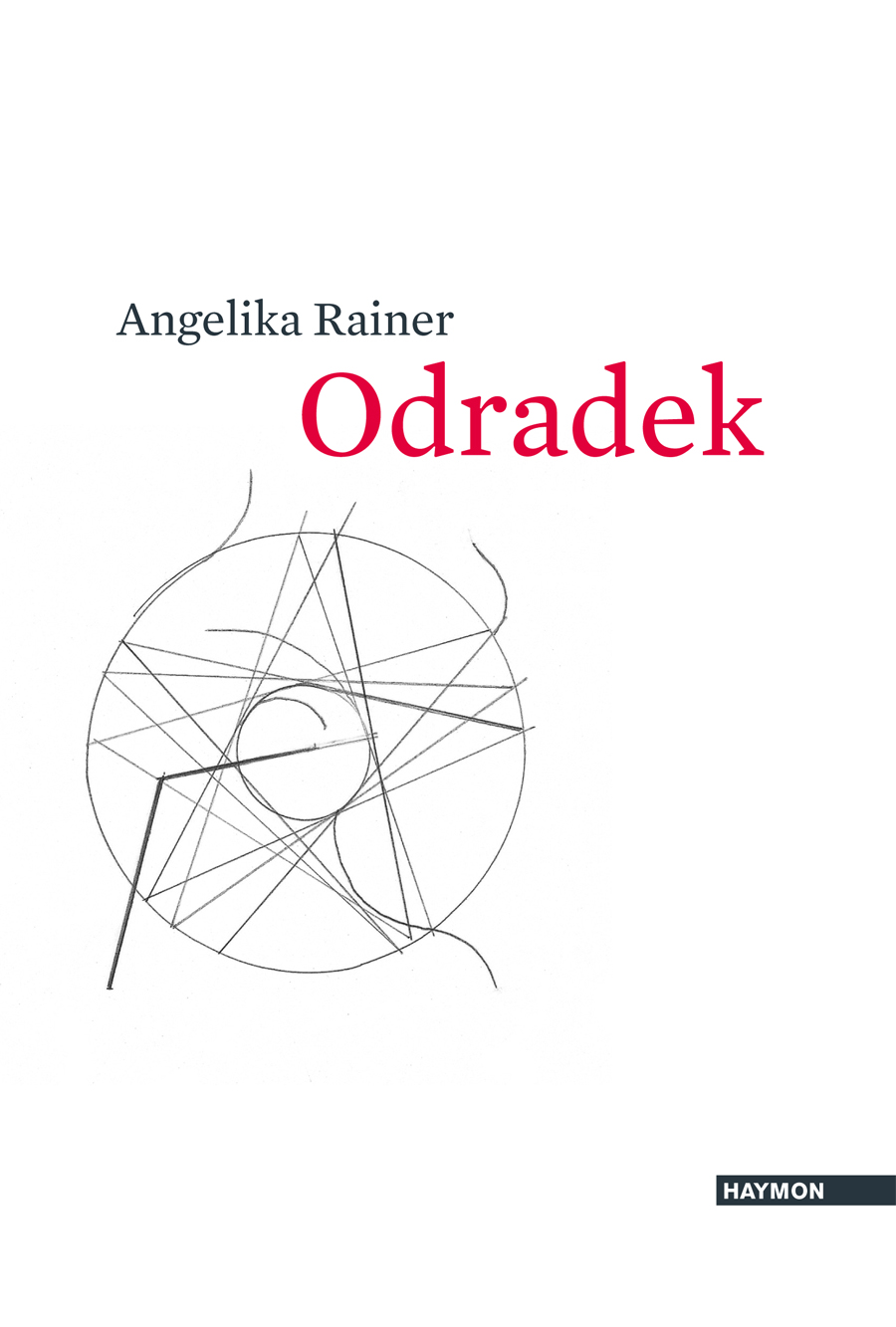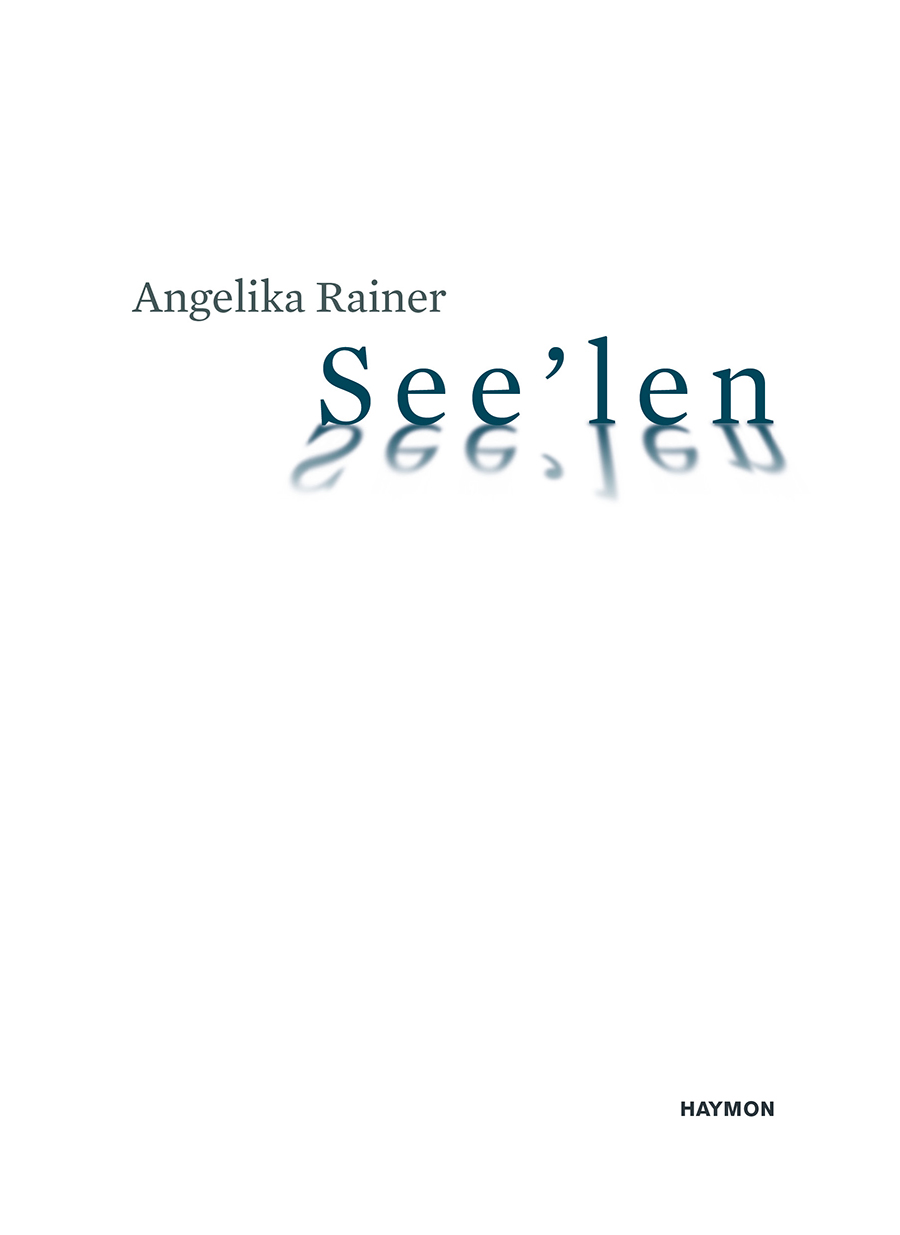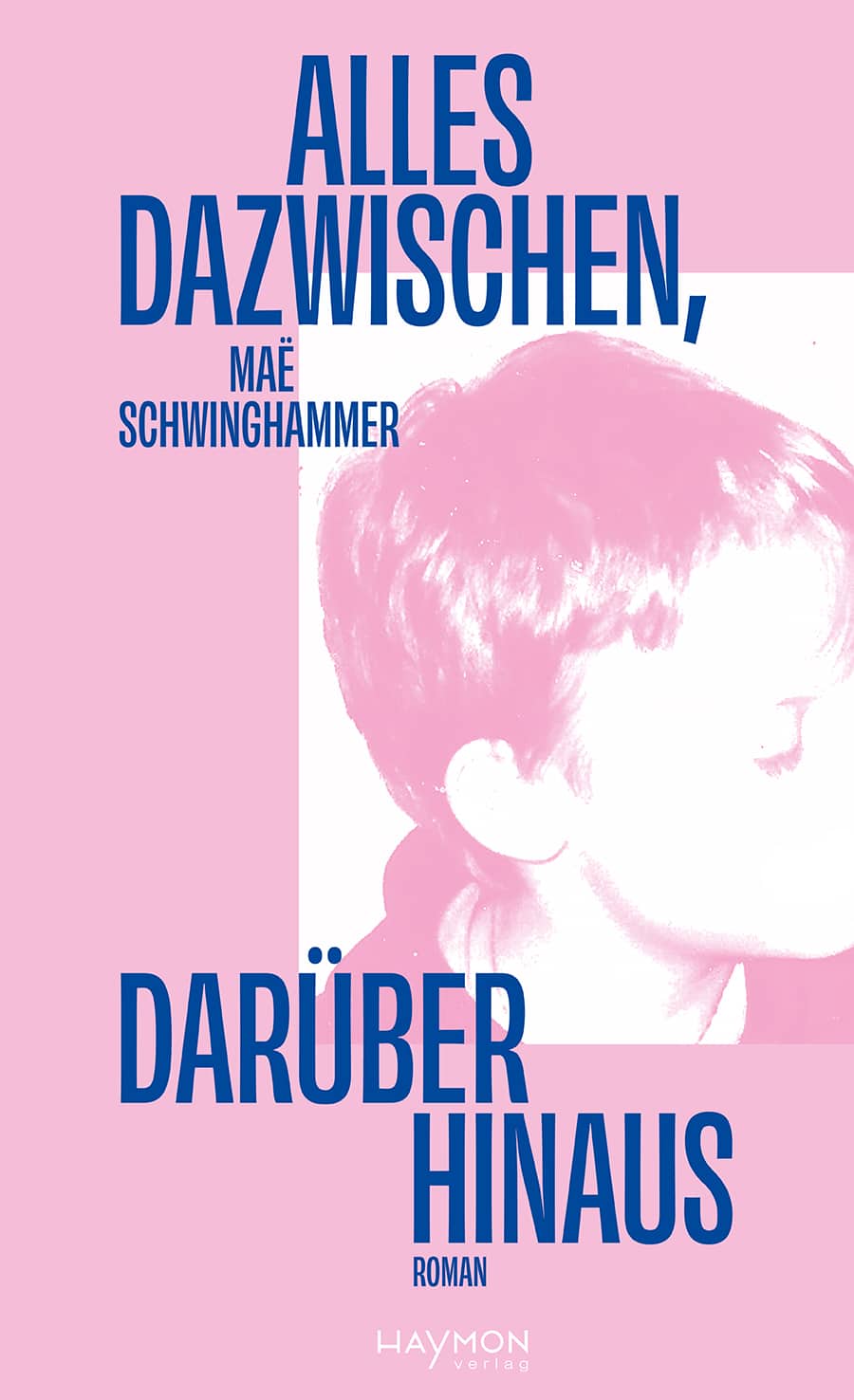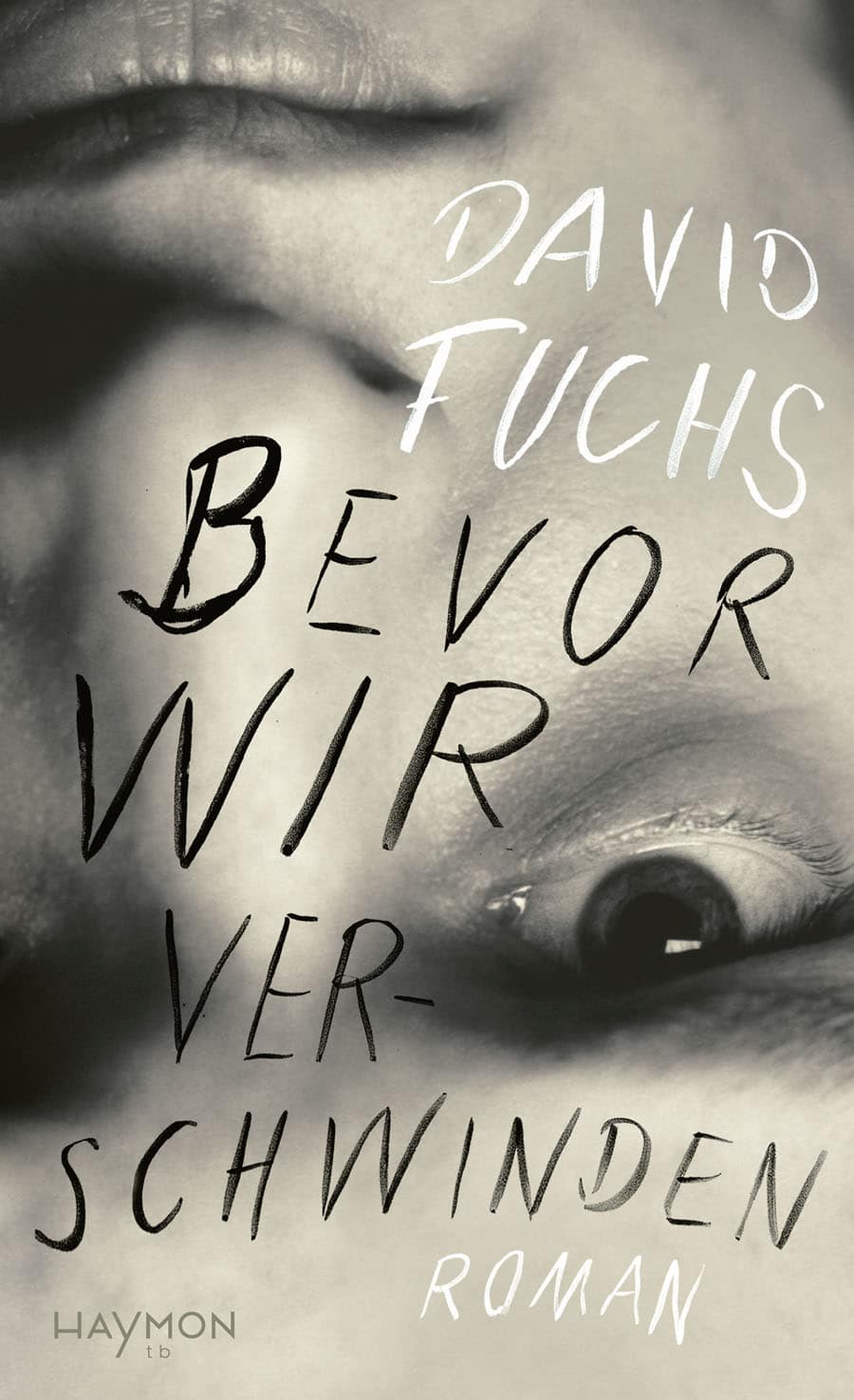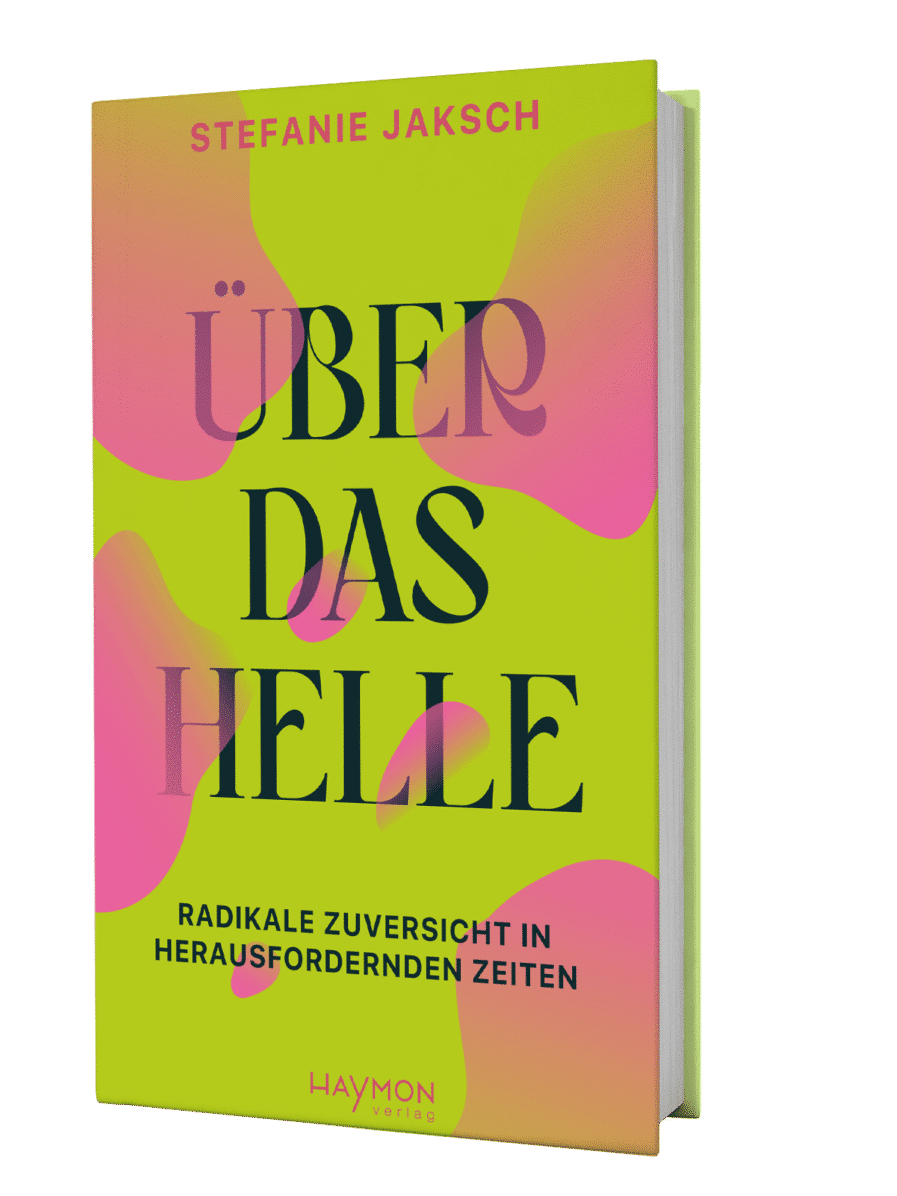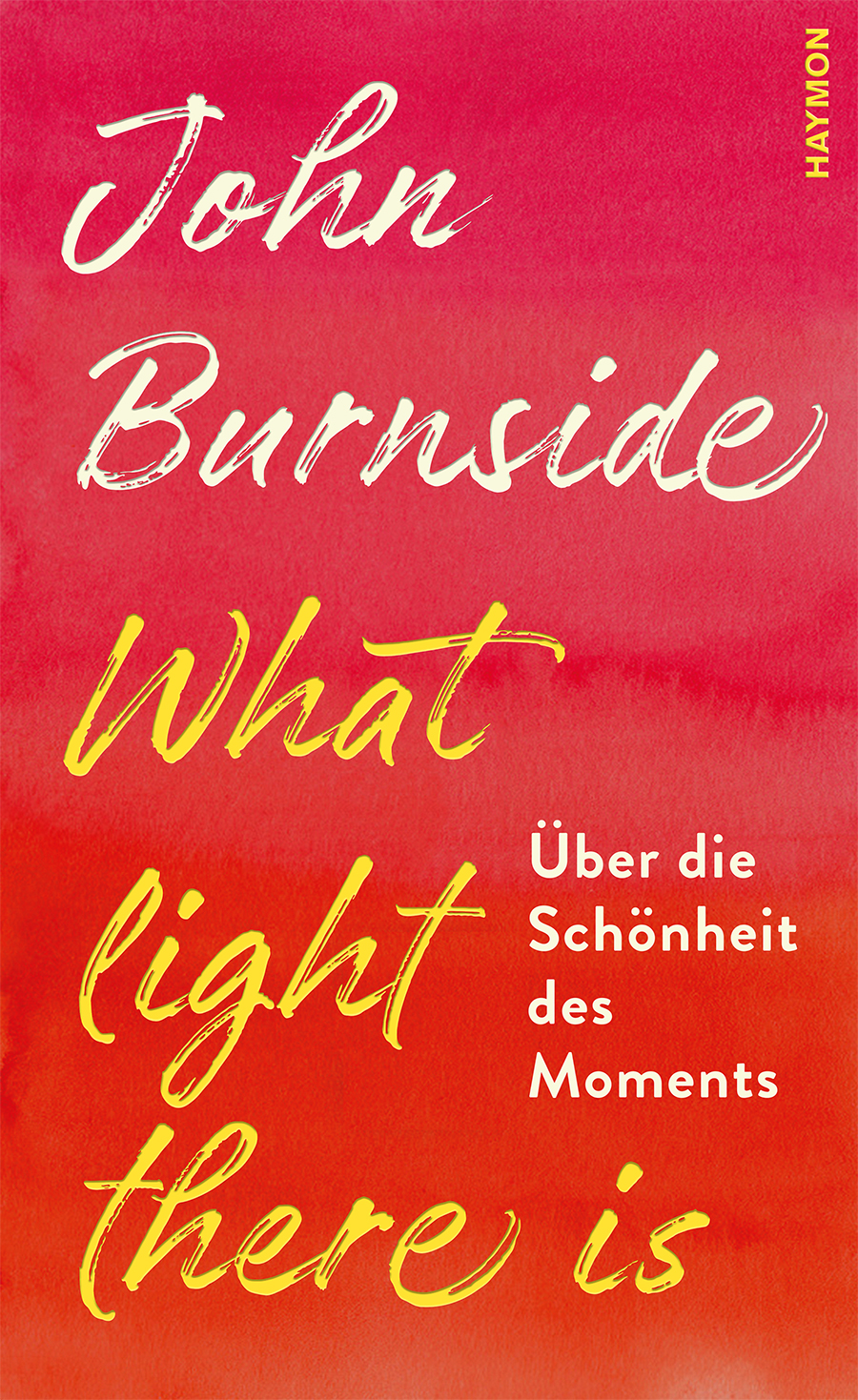/01/ irreversible physikalische Prozesse
Wir beobachten tagtäglich irreversible physikalische Prozesse. In meiner Wohnung häuten sich Spinnen. Ihre Netze wirken verlassen, aufgegeben. Sie sammeln Staub, manchmal zittern sie gespenstisch im Luftzug. Gespenstisch auch das Licht, das durchs Fenster in die Wohnung sickert und sich in die Pfandflaschen hineinzwängt, wo langsam ein paar Tropfen Bier aufgewärmt werden, die zusammen vielleicht noch für einen letzten Schluck gereicht hätten.
Der Probealarm erinnert mich daran, dass ich meine Pflanzen gießen sollte. Zum An- und Abschwellen der Sirenen fülle ich die Gießkanne mit Wasser, bewege mich von Raum zu Raum, denke, wie unwahrscheinlich grausam es wäre, wenn sich tatsächlich eine Katastrophe ereignet hätte, und der Probealarm legt sich über den echten Alarm, weil irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert oder der Krieg unerwartet ein paar hundert Kilometer näher gerückt ist, und die Menschen gießen Blumen, hängen Wäsche auf, skippen zum nächsten Song in der Playlist, während der Wind die Strahlung vor sich hertreibt, während Raketen starten, während Raketen einschlagen.
Mein Blick fällt auf die gebrochenen Sonnenstrahlen in den leeren Bierflaschen, ich drücke zwei Schmerztabletten aus der Blisterpackung, denke: Selfcare. Mein Handydisplay leuchtet auf, Sophia schreibt, dass sie mich liebt, ich dich auch, antworte ich und zünde mir eine Zigarette an. Die Tage sind zum Verwechseln ähnlich, seit ich nicht mehr in die Schule muss, die Tage sind austauschbar, aber ich weiß nicht, was ich lieber hätte stattdessen.
Die Schulleiterin war sichtlich erleichtert, als ich mit dem ausgefüllten Antrag auf Dienstfreistellung in ihr Büro gekommen bin, kaum Platz genommen, hatte ich auch schon ihre Unterschrift. Alles Gute für Ihr Projekt, hat sie gesagt und mir die Hand geschüttelt, ich musste fest zugreifen, um nicht abzurutschen.
Alles Gute für dein Buch, hat Sandra dann später zu mir gesagt, mich lange umarmt, und komm unbedingt zur Weihnachtsfeier. Nicht, wenn ich es verhindern kann, antworte ich. Sandra lacht, sie weiß, worauf ich anspiele. Unsere Weihnachtsfeiern sind eine Ausrede für schlechte Musik, für zu viel Alkohol und einmal zu eng mit dem jungen Kollegen tanzen, sich einmal zu oft von der älteren Kollegin mit nach Hause nehmen lassen. Die Kollegin mit der Puppensammlung. Ob sie zuschauen dürfen, habe ich sie gefragt, als sie mich an den in einer Vitrine ausgeleuchteten Puppen vorbei zu ihrem Bett geführt hat. Es ist nicht bei diesem einen Mal geblieben, wir brauchen schon lange keine Weihnachtsfeier mehr, um Sex zu haben.
Manchmal werde ich gefragt, ob ich das Unterrichten vermisse. Aber nur das Läuten der Schulglocke am Stundenende fehlt mir, ein akustisches Signal, dass man etwas geschafft hat. Dass es okay ist, zusammenzupacken und zu gehen. Es war nie leicht für mich, über meinen Beruf zu sprechen. Die wenigsten Menschen haben eine konkrete Vorstellung davon, was im Informatikunterricht passiert. Also hatte ich mir eine Standardantwort zurechtgelegt: Die Kunst ist, die Nullen und die Einsen zu verstecken.
Auf meinem Schreibtisch liegt das Kuvert mit dem Befund. Ich habe den Brief wieder zusammengefaltet und in den Umschlag gesteckt. Am liebsten würde ich ihn zurück in den Briefkasten legen. Wie geht es dir heute, schreibt Sophia, wie geht es deinem Wörterbuch? Mein Wörterbuch ist in Wahrheit ein Zettelkasten. Auf Karteikarten sammle ich Geschichten über das Verlieren und habe in den letzten Jahren immer wieder die Idee geäußert, daraus ein Buch machen zu wollen, ein Wörterbuch der Verluste, habe in zu kurzer Zeit zu vielen verschiedenen Menschen von meinem Vorhaben erzählt, jetzt denken sie, ich würde tatsächlich daran arbeiten. Manchmal, an Tagen mit Sirenenalarm zum Beispiel, überkommt mich das Bedürfnis, die Karteikarten zumindest zu sortieren. Mir ein Ordnungssystem zu überlegen, das nicht nur für mich Sinn ergibt.
Ich ziehe ein paar Karten heraus, es fällt mir schwer, meine eigene Handschrift zu entziffern, nicht alle Einträge habe ich nüchtern verfasst, ich stecke sie wieder zurück und setze mich an den Computer, um nachzusehen, was heute im Workflow auf mich wartet. Seit ich nicht mehr unterrichte, arbeite ich ein paar Stunden in der Woche für ein Entwicklerstudio, das gerade sein erstes Videospiel veröffentlicht hat. Zu meinen Aufgaben gehört es, die neuesten Patch-Notes zu kommunizieren, auf unserer Website und in diversen Foren. Die anderen im Team sind gut darin, Bugs und Glitches zu beseitigen, ich muss nur die richtigen Worte dafür finden. Sie haben mir eine Liste geschickt mit allen Änderungen, ab morgen soll die neue Version zum Download angeboten werden. Ich beschließe, mich später darum zu kümmern.
Ich stelle fest, dass ich nur die Hälfte meiner Pflanzen gegossen habe. An manchen Tagen bin ich mir nicht sicher, ob ich eine Aufmerksamkeitsstörung habe oder mich einfach nicht einlassen will. Auf diese Welt, dieses Leben. Ich zünde mir eine Zigarette an, rauche zum Fenster hinaus, in einem der Innenhofbäume haben Vögel ihr Nest gebaut. Vögel, hat mir einer der Programmierer gesagt, findet er am schwierigsten. Er kennt kein Videospiel, das sie auch nur ansatzweise überzeugend darstellt. An diesen Satz denke ich oft. Und dem Rauch von der ausgedämpften Zigarette wachsen Federn.