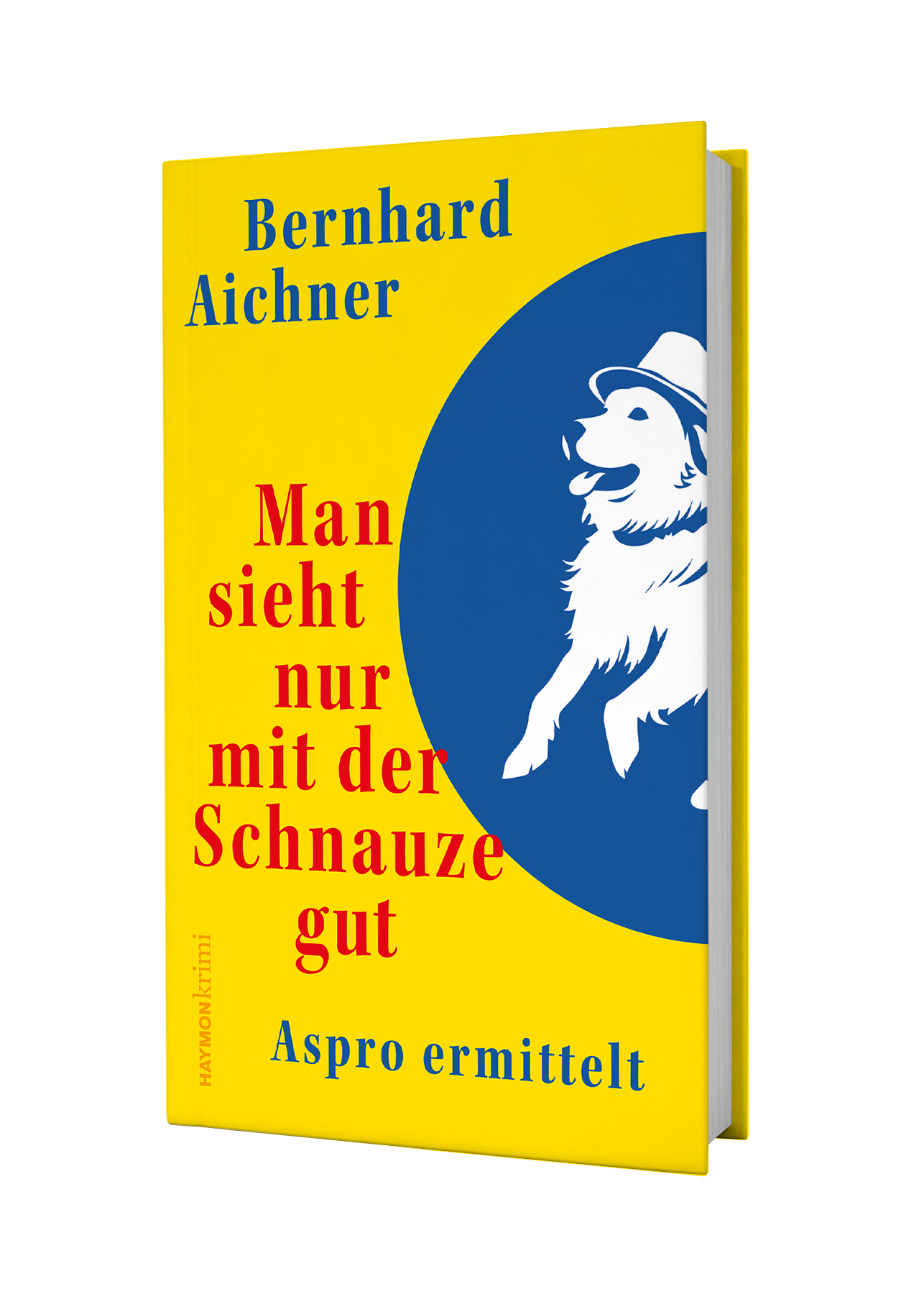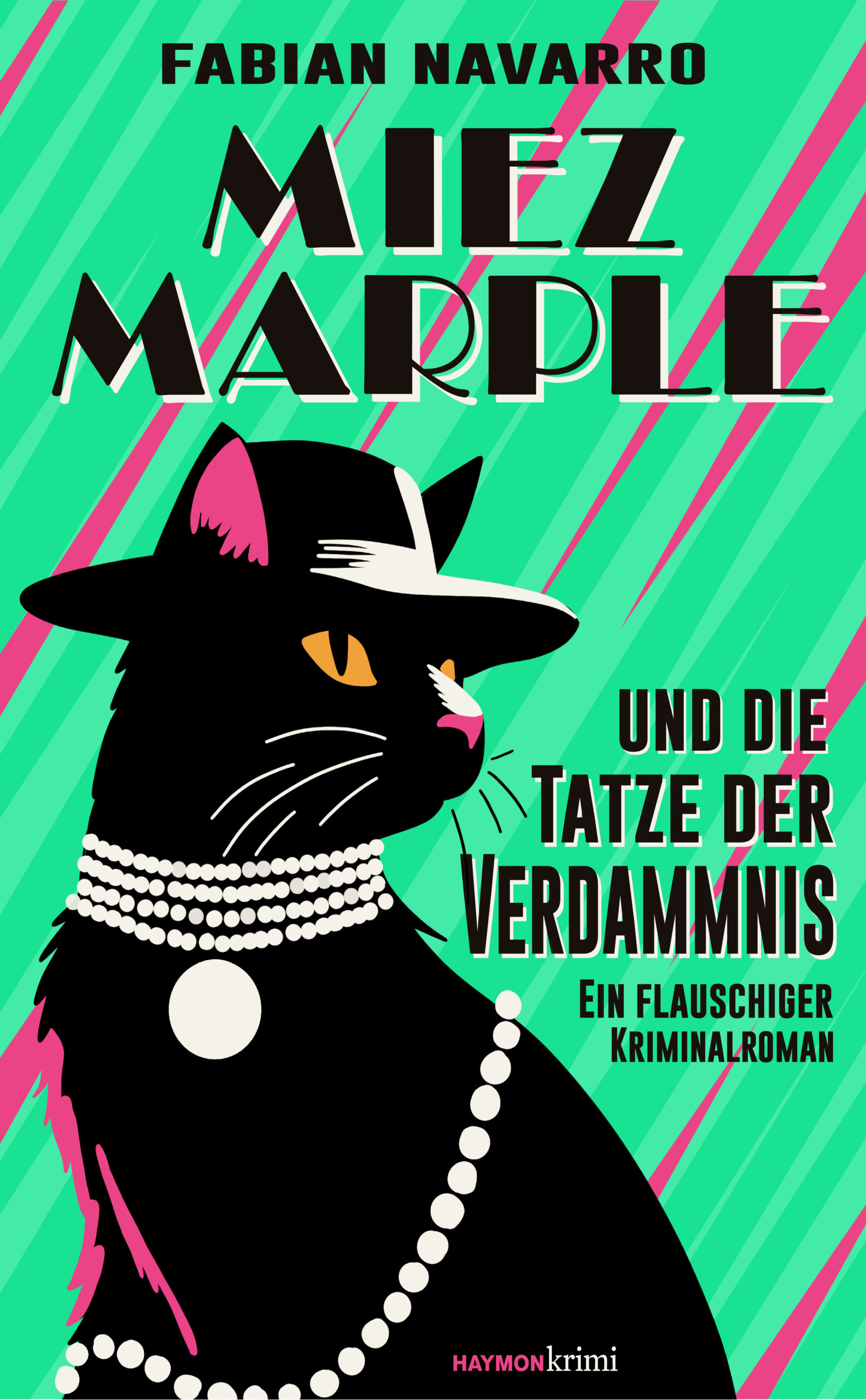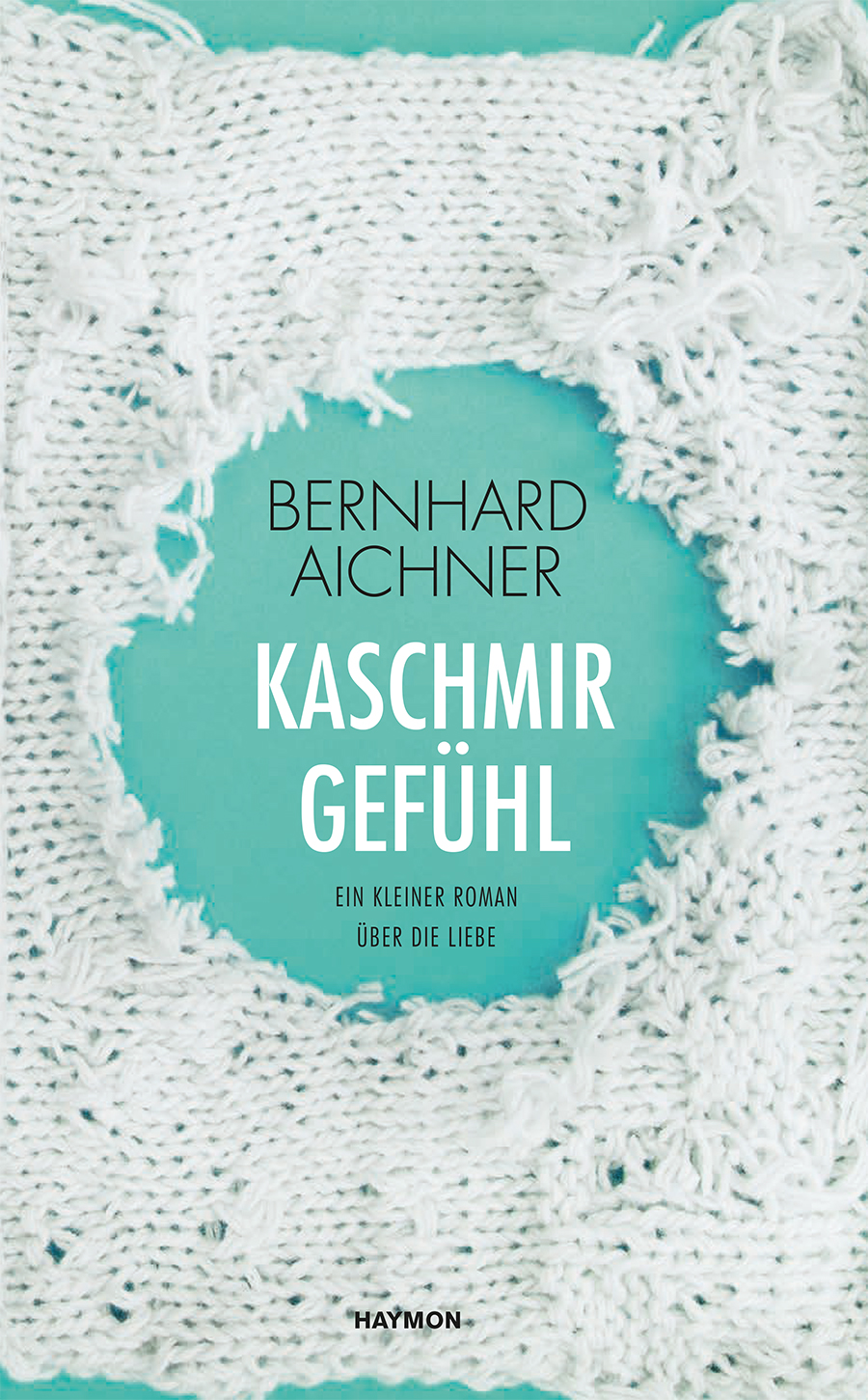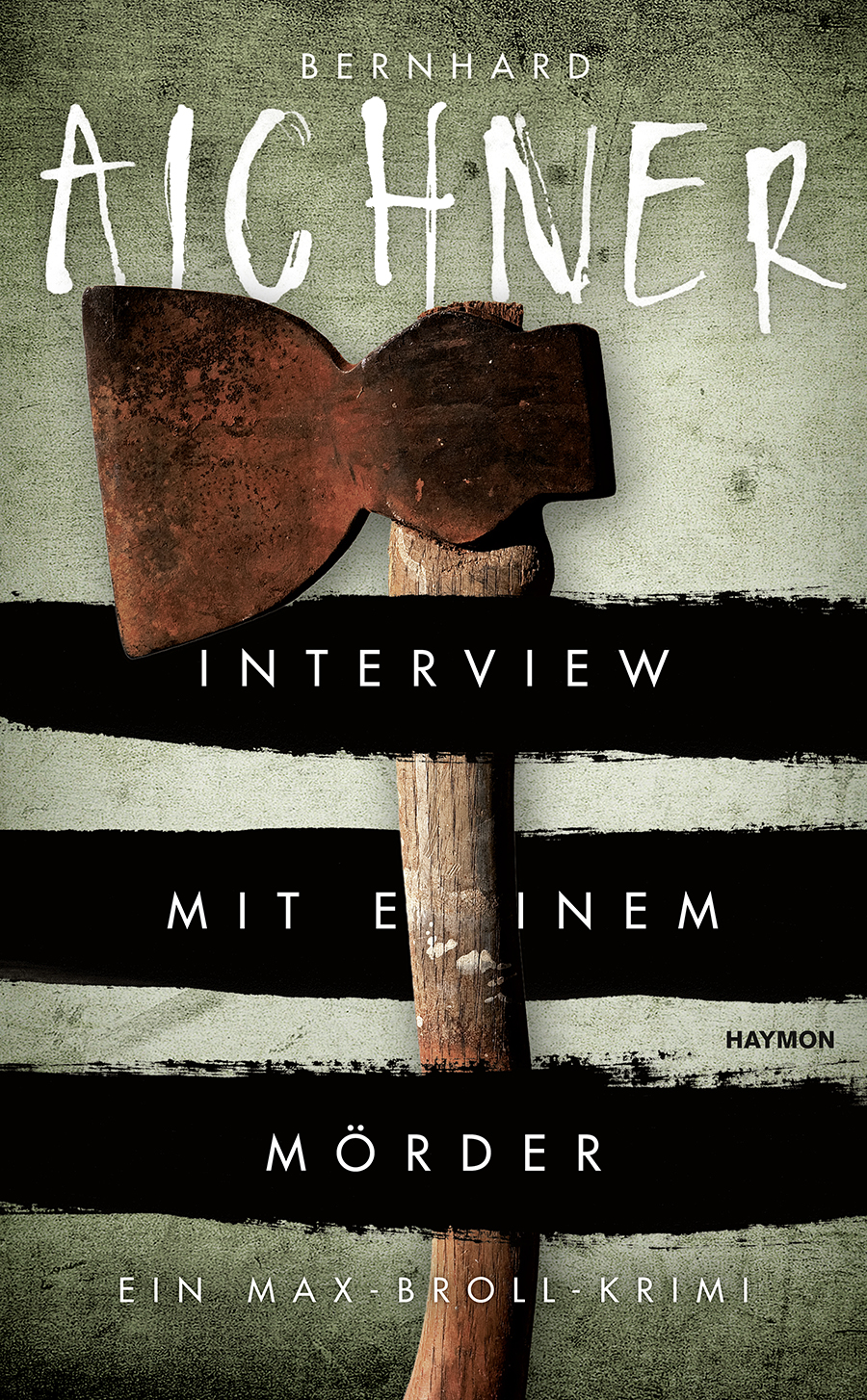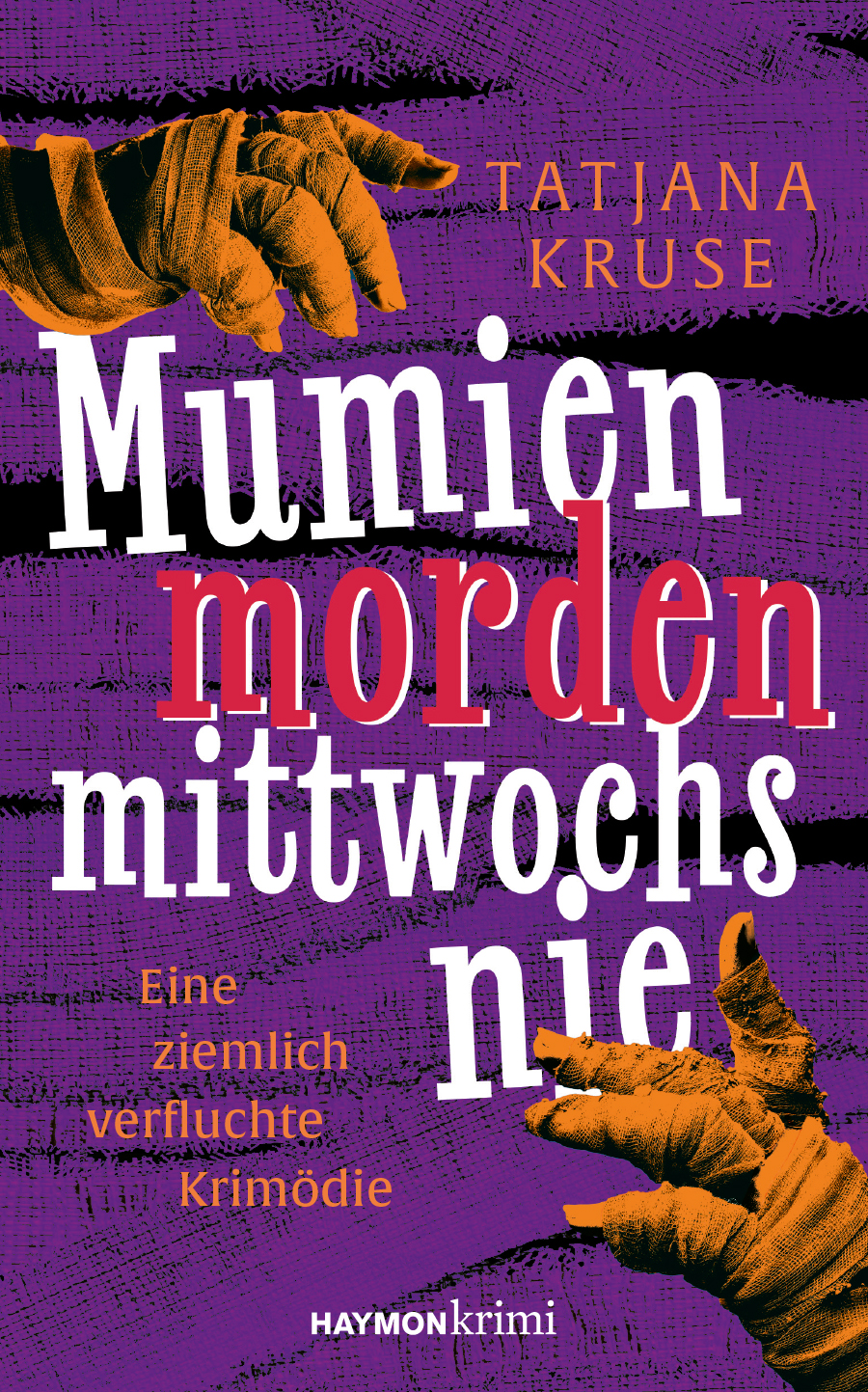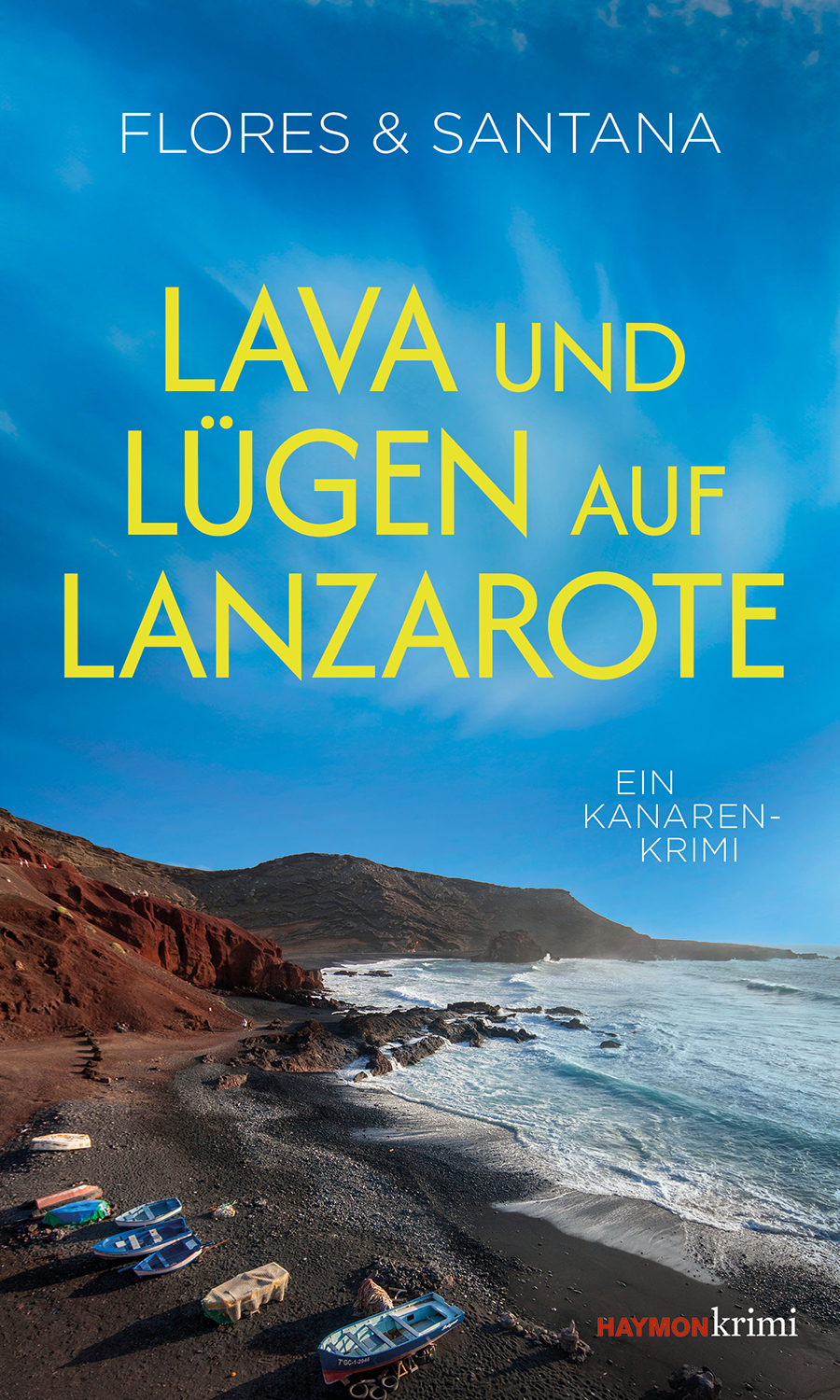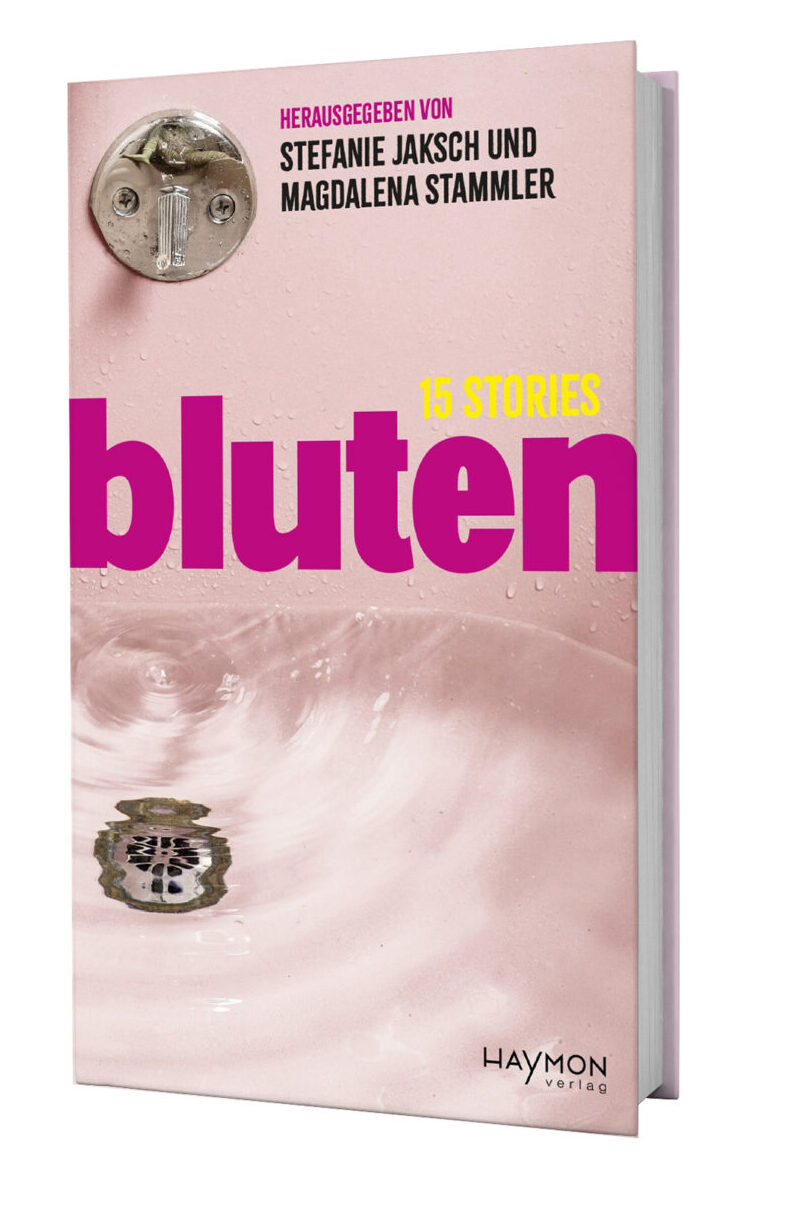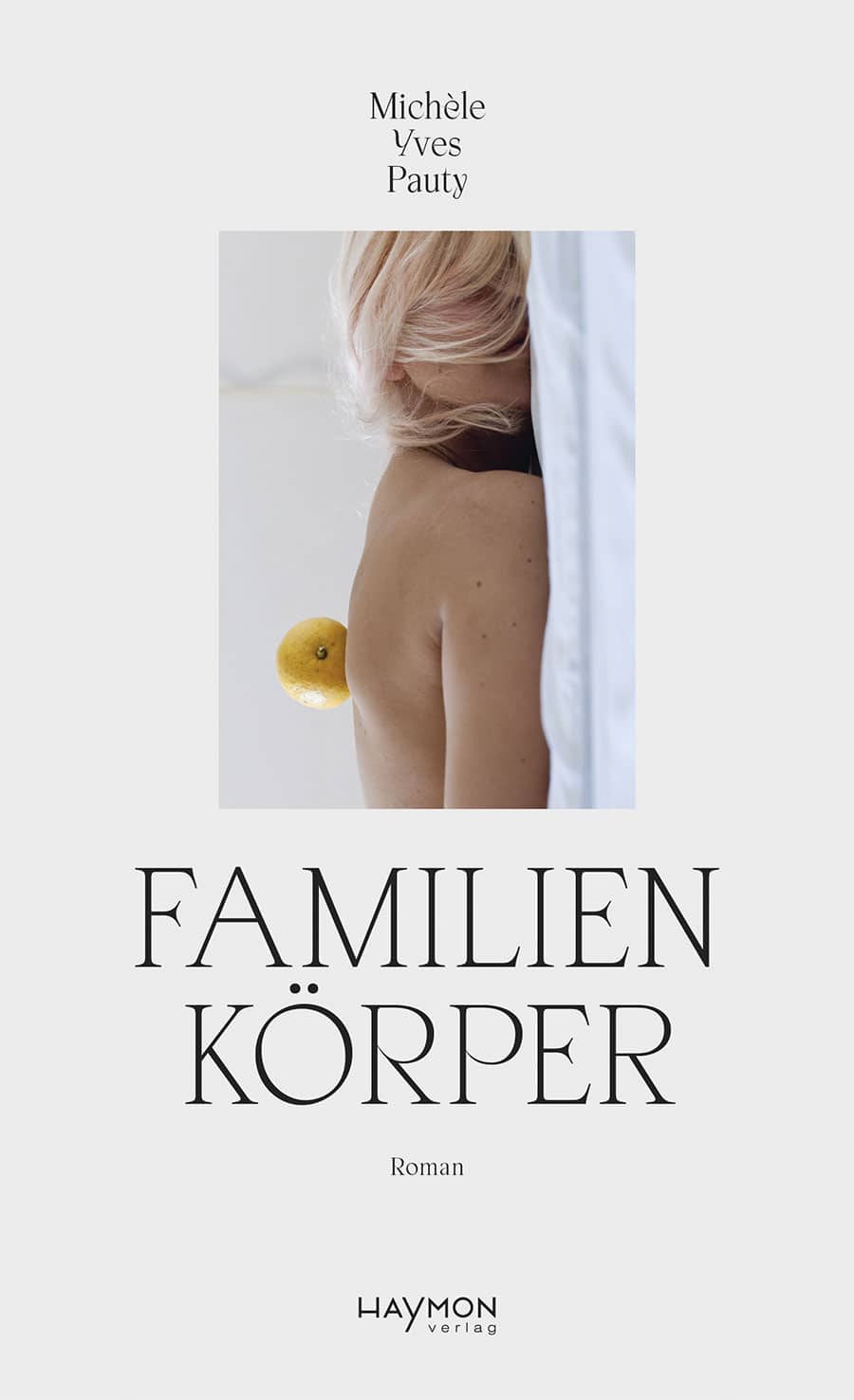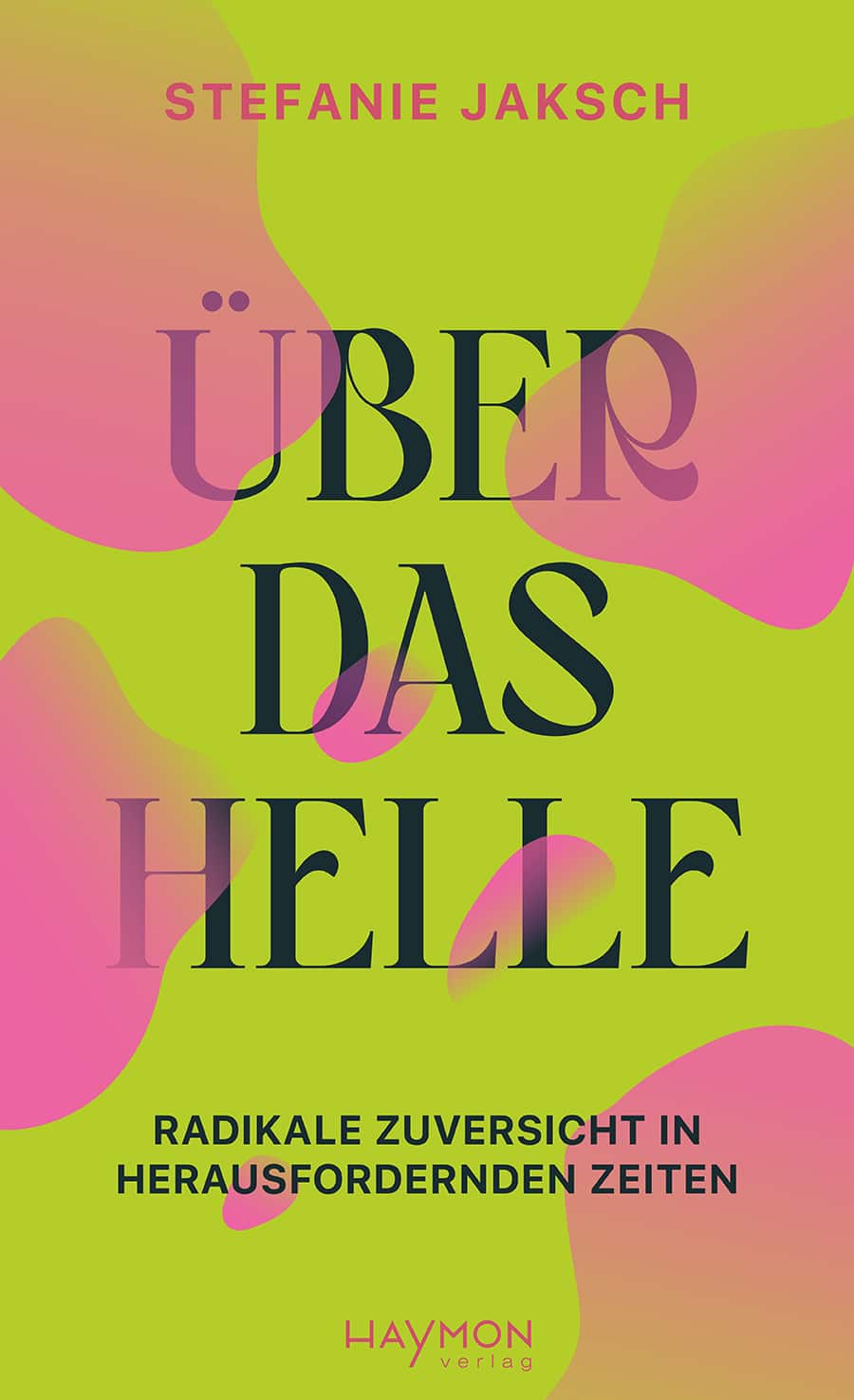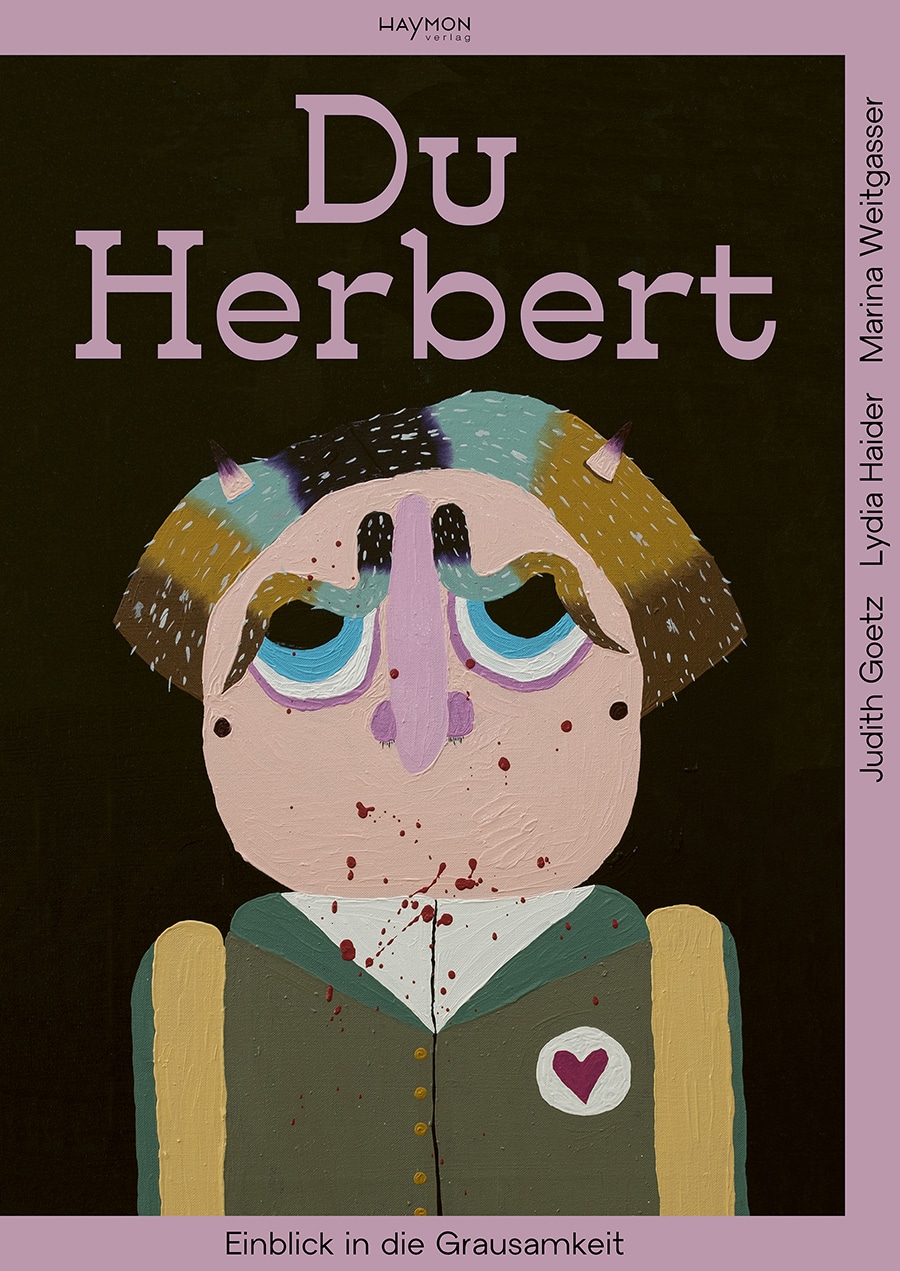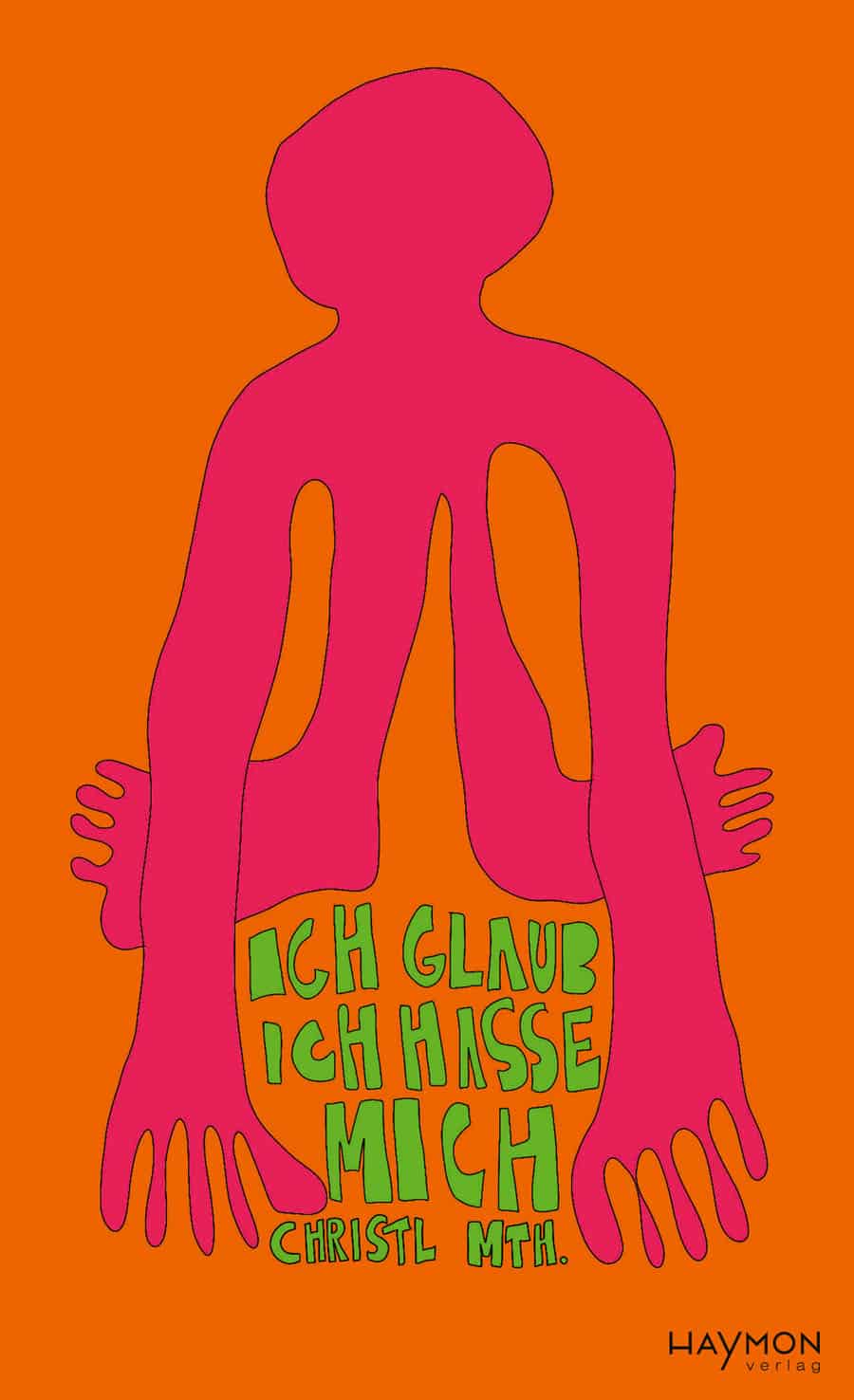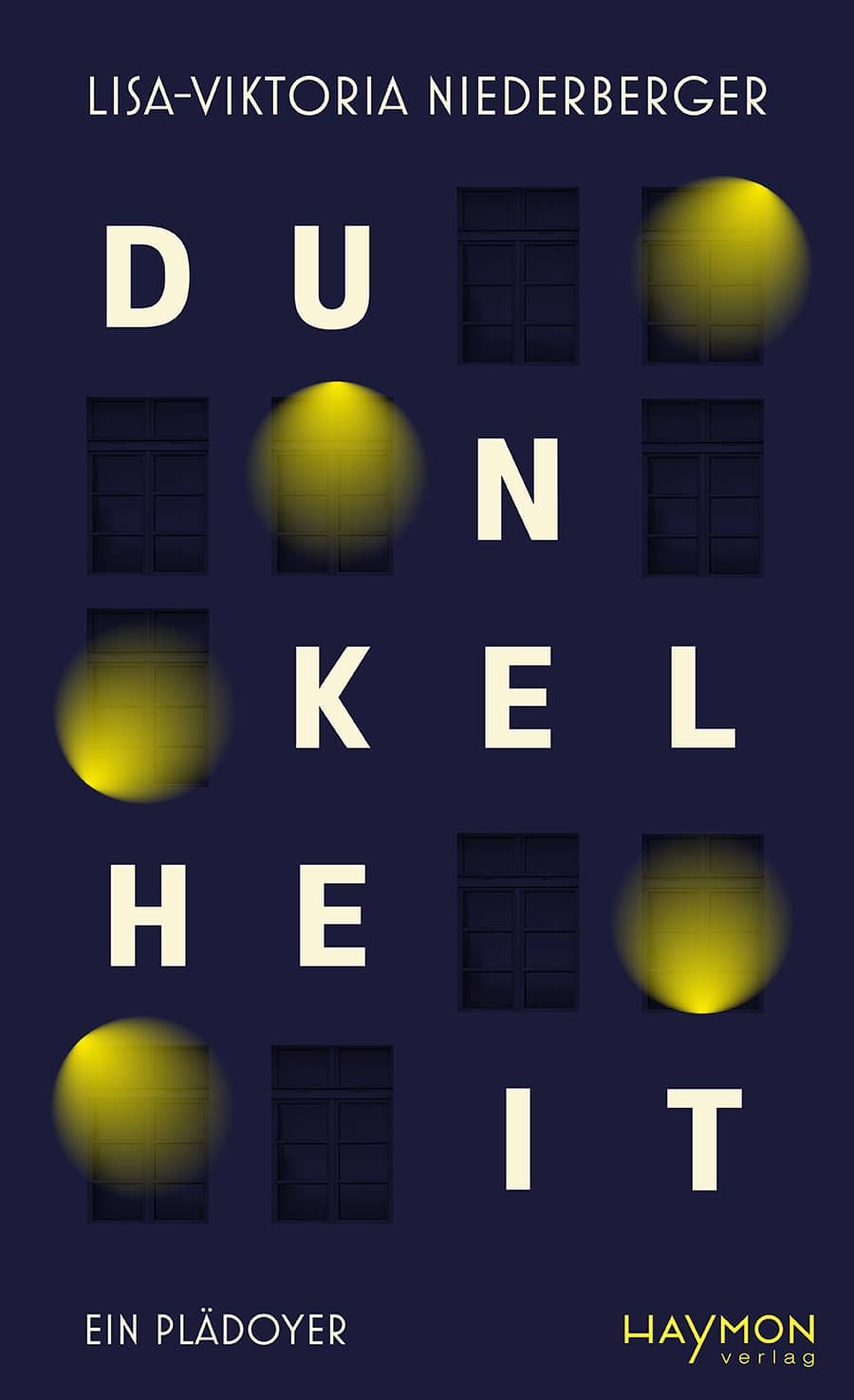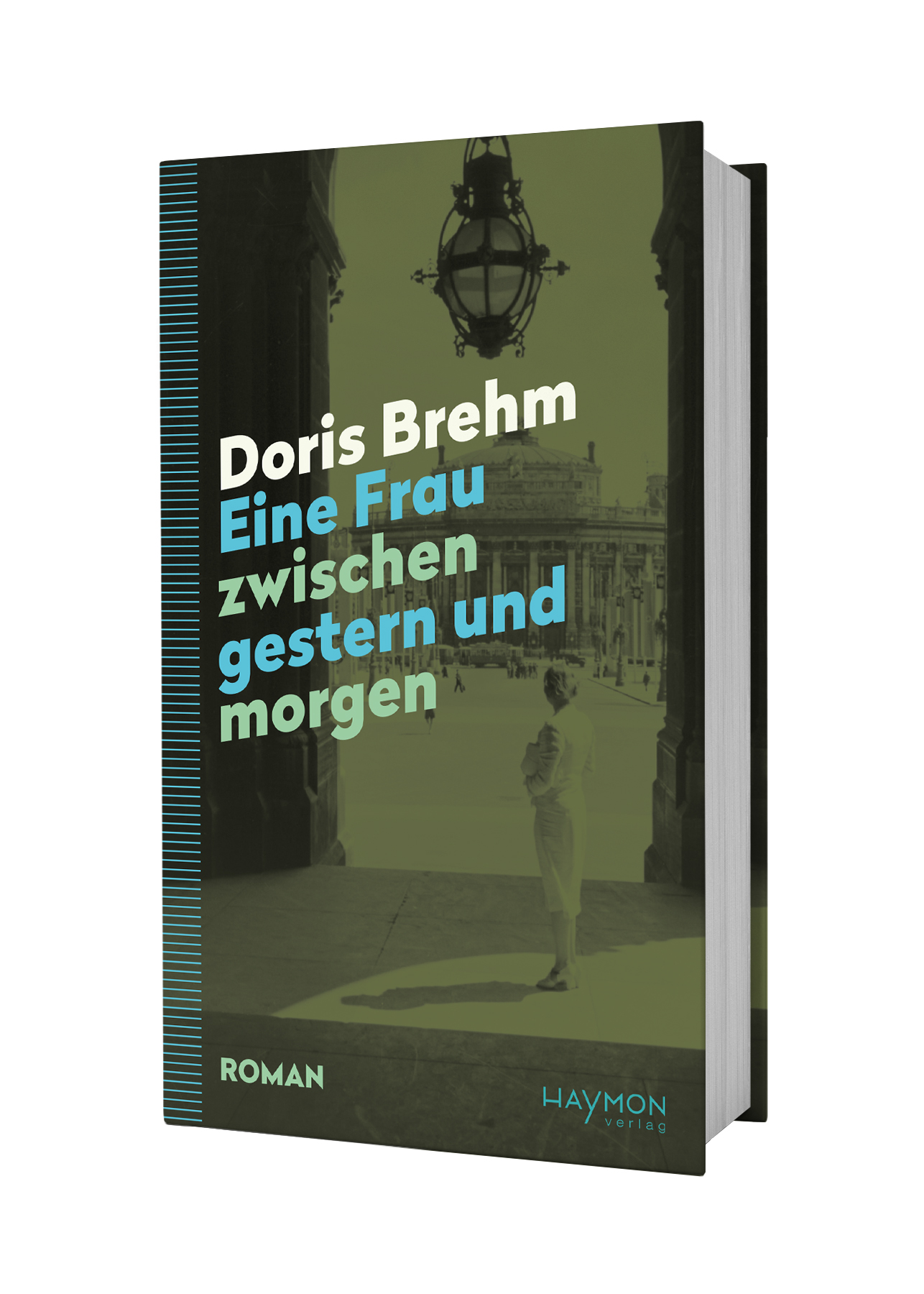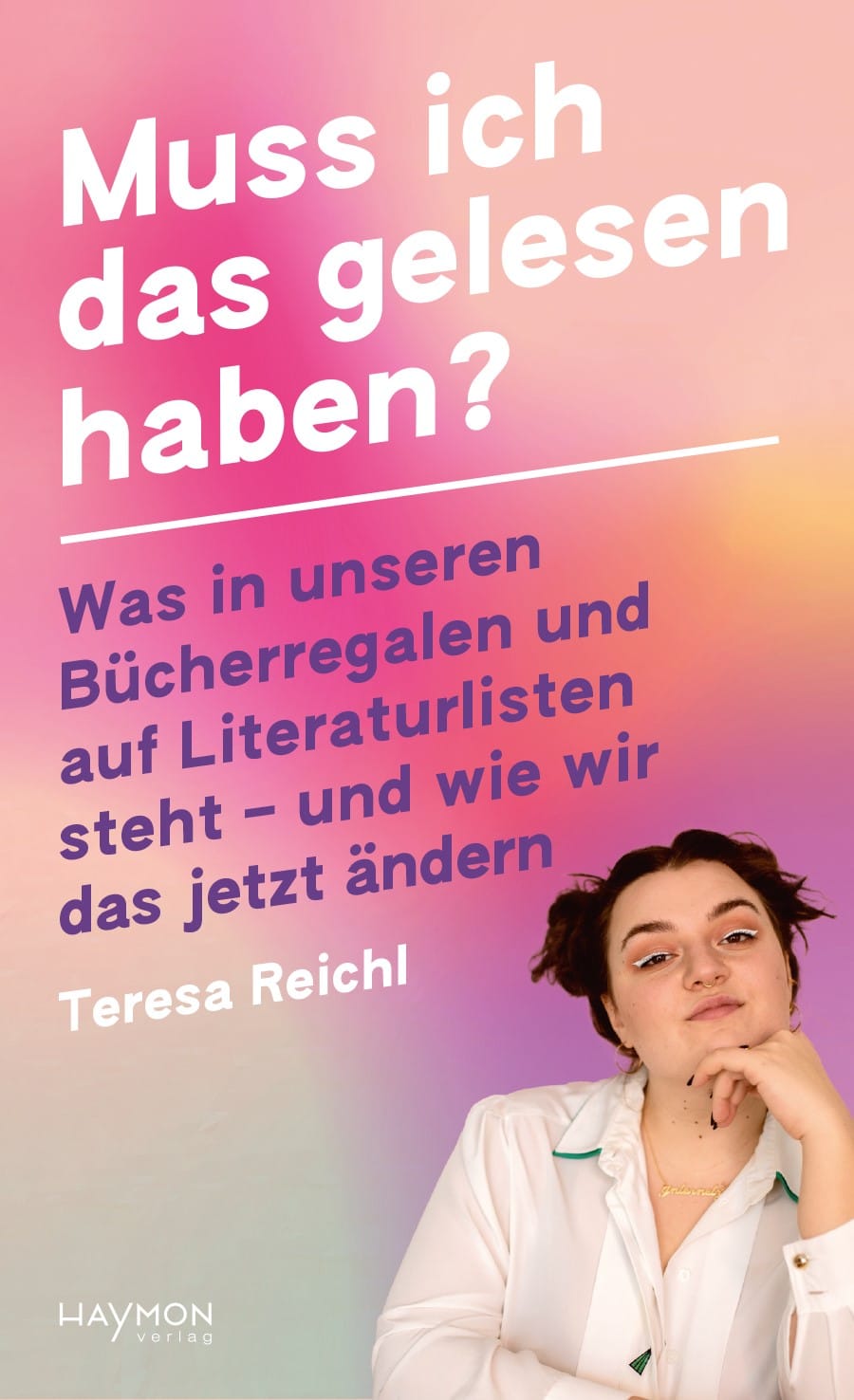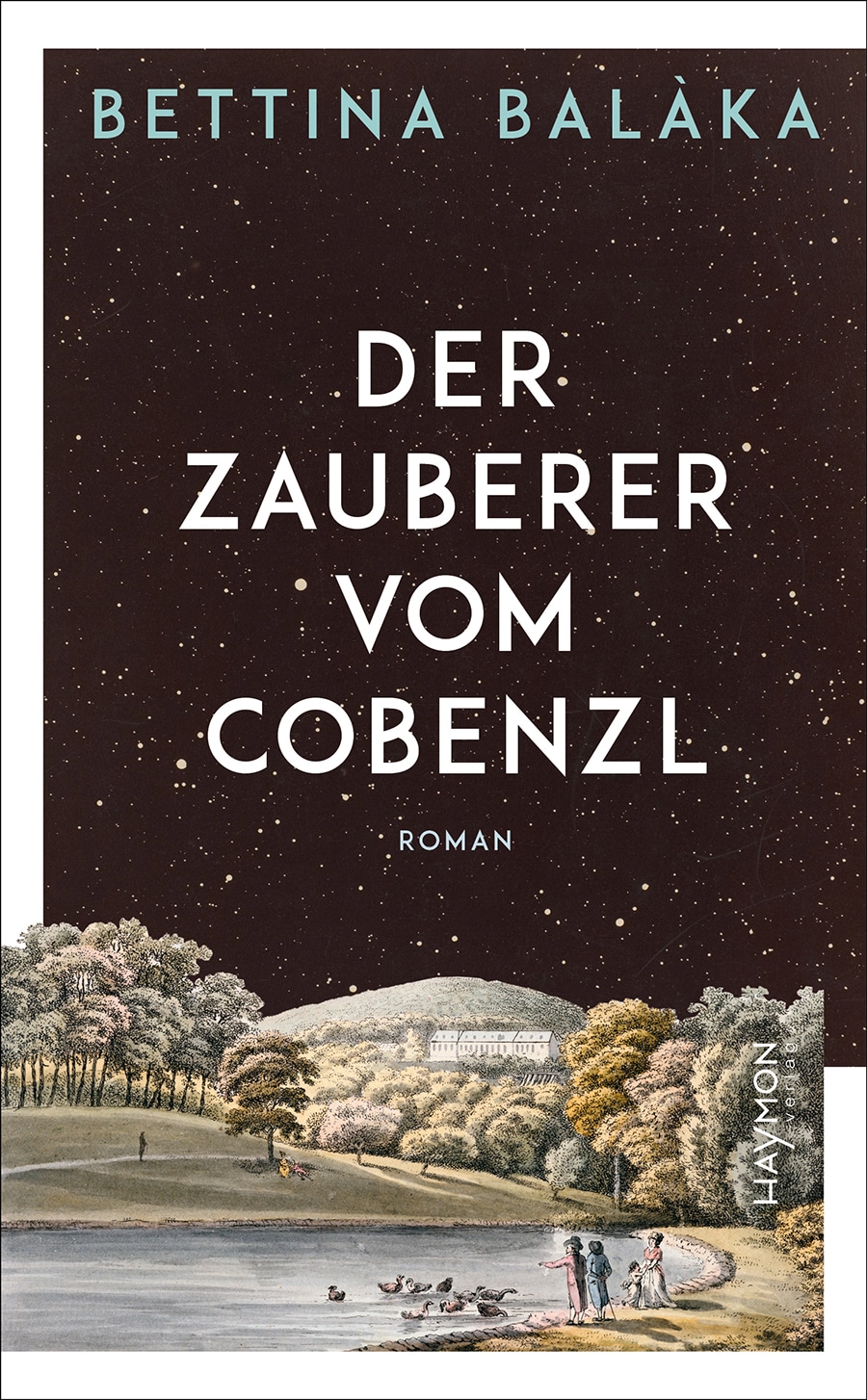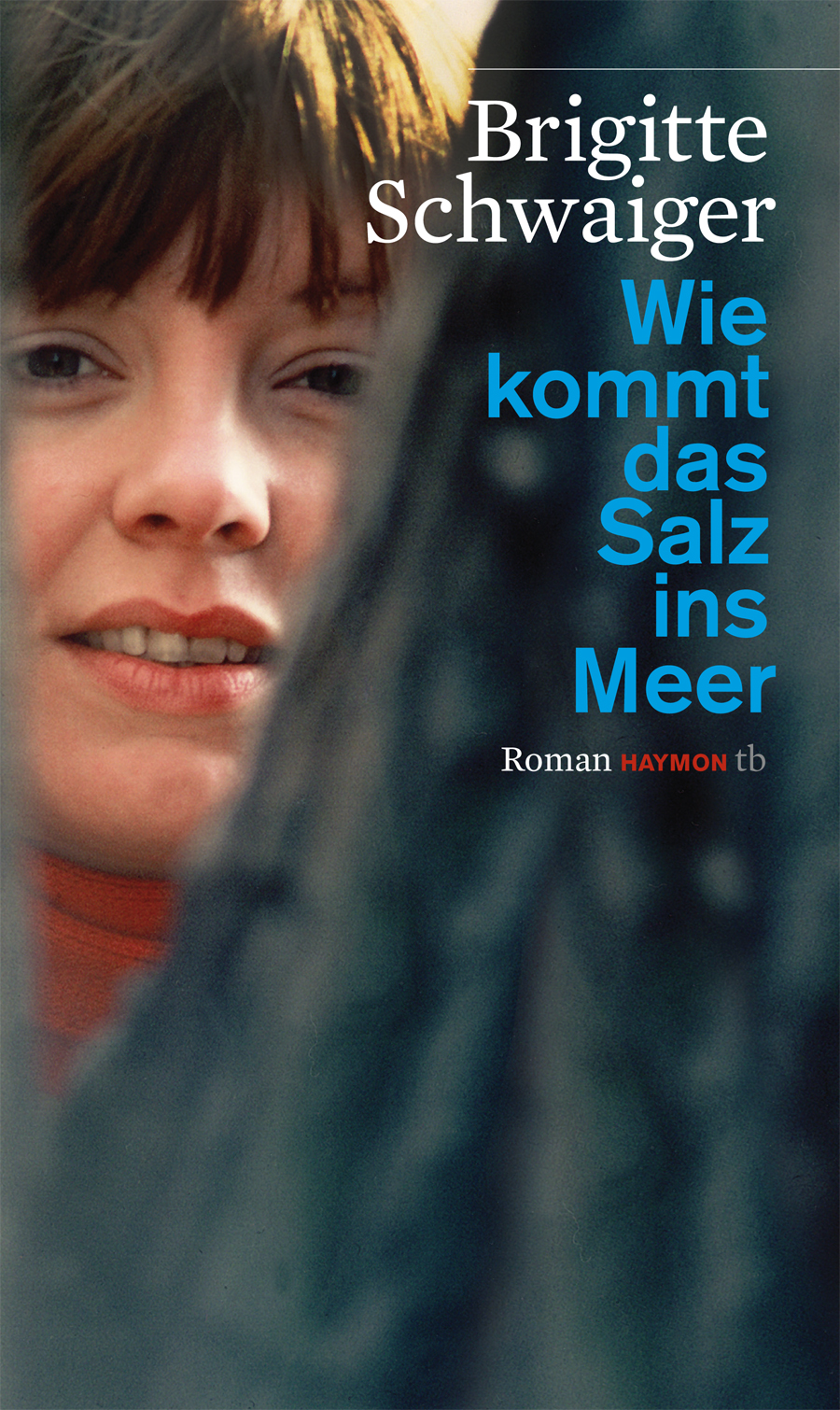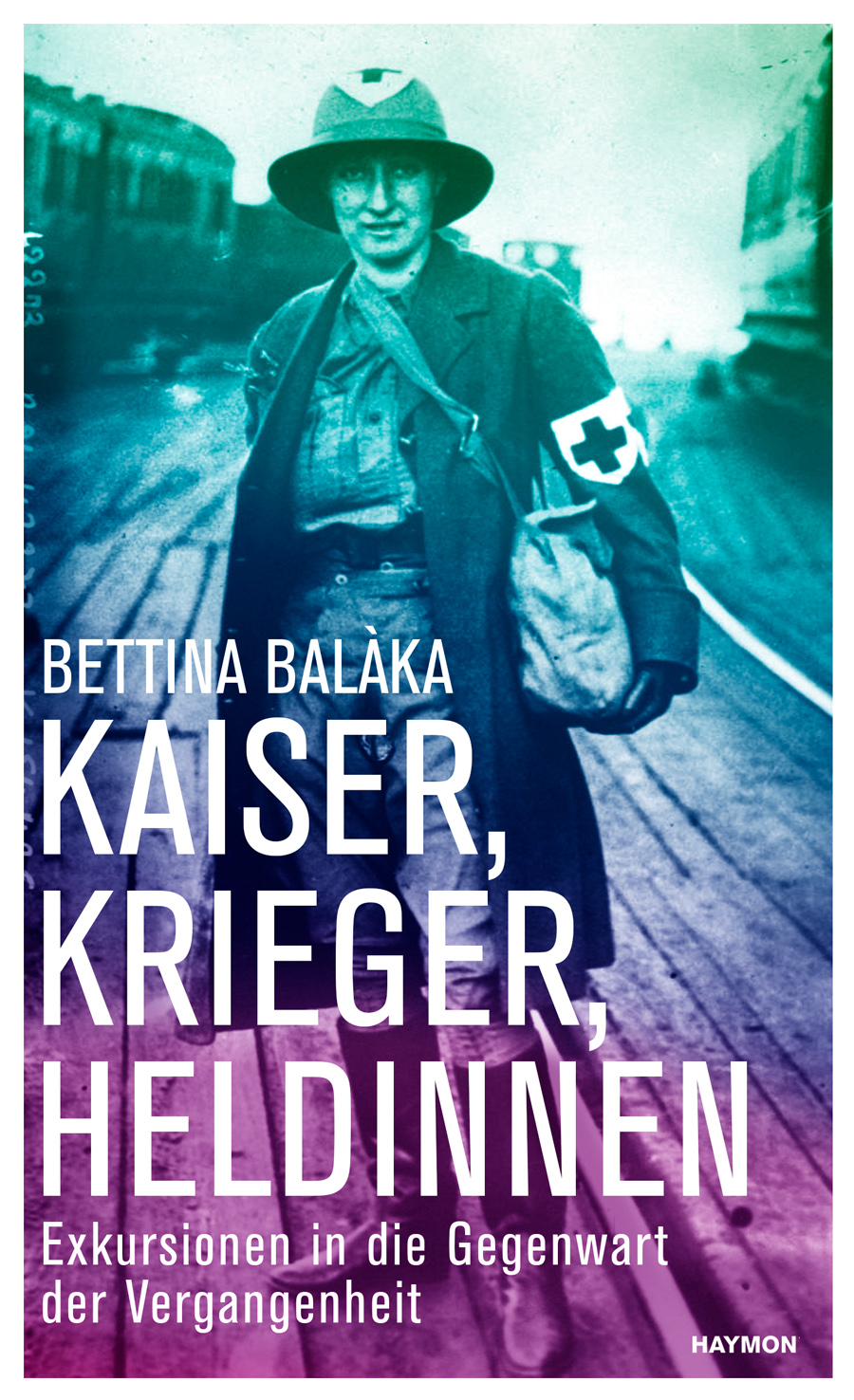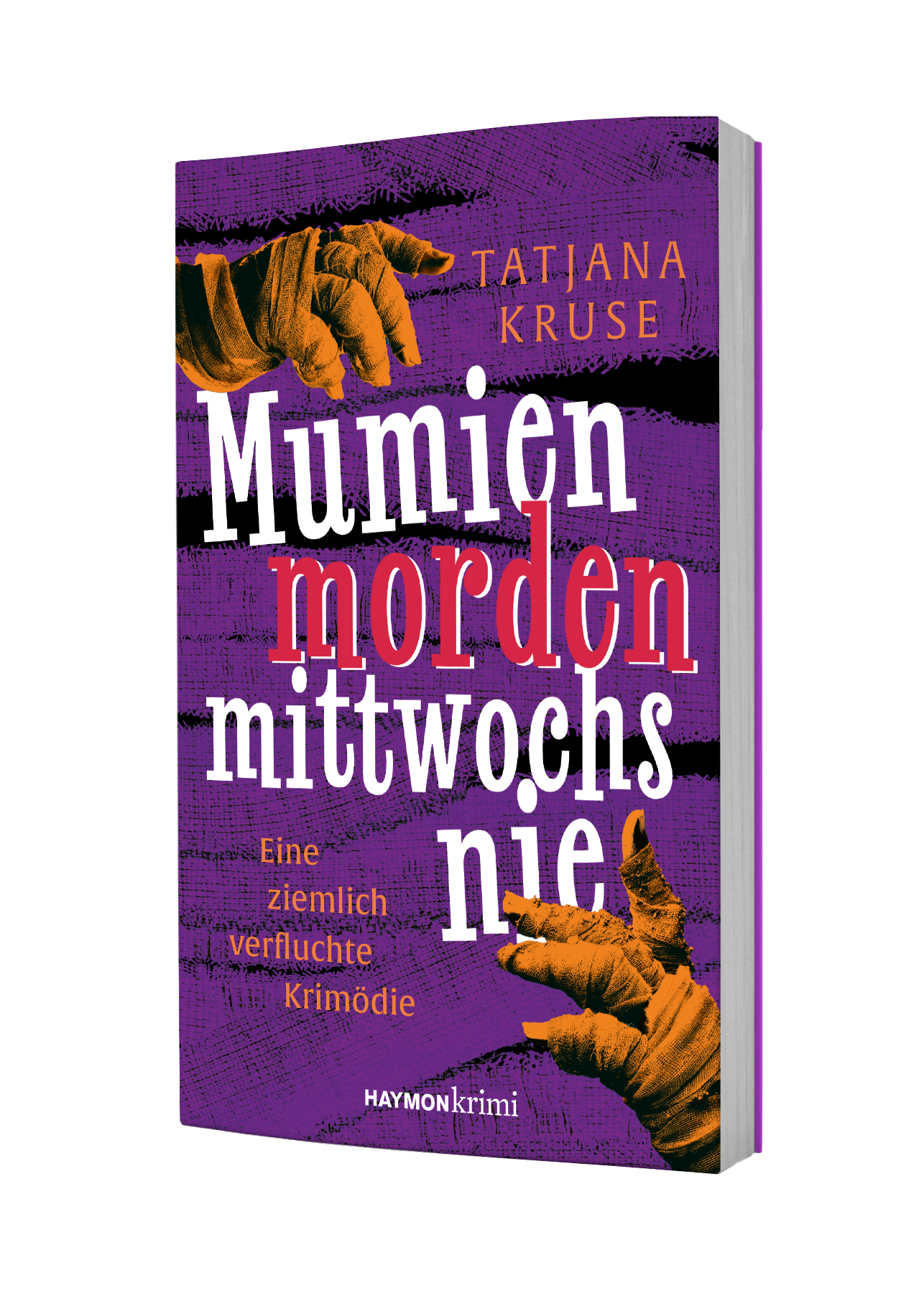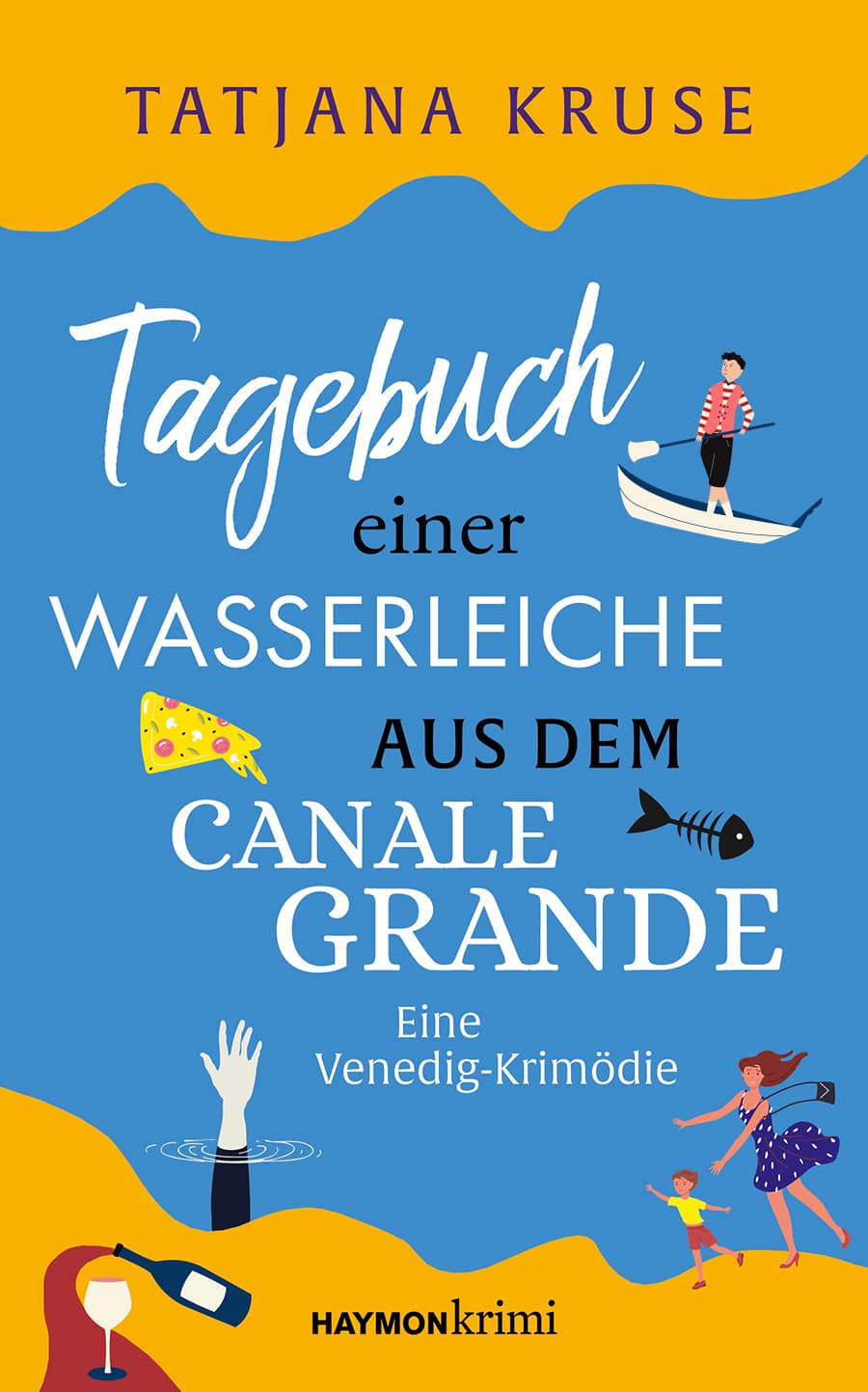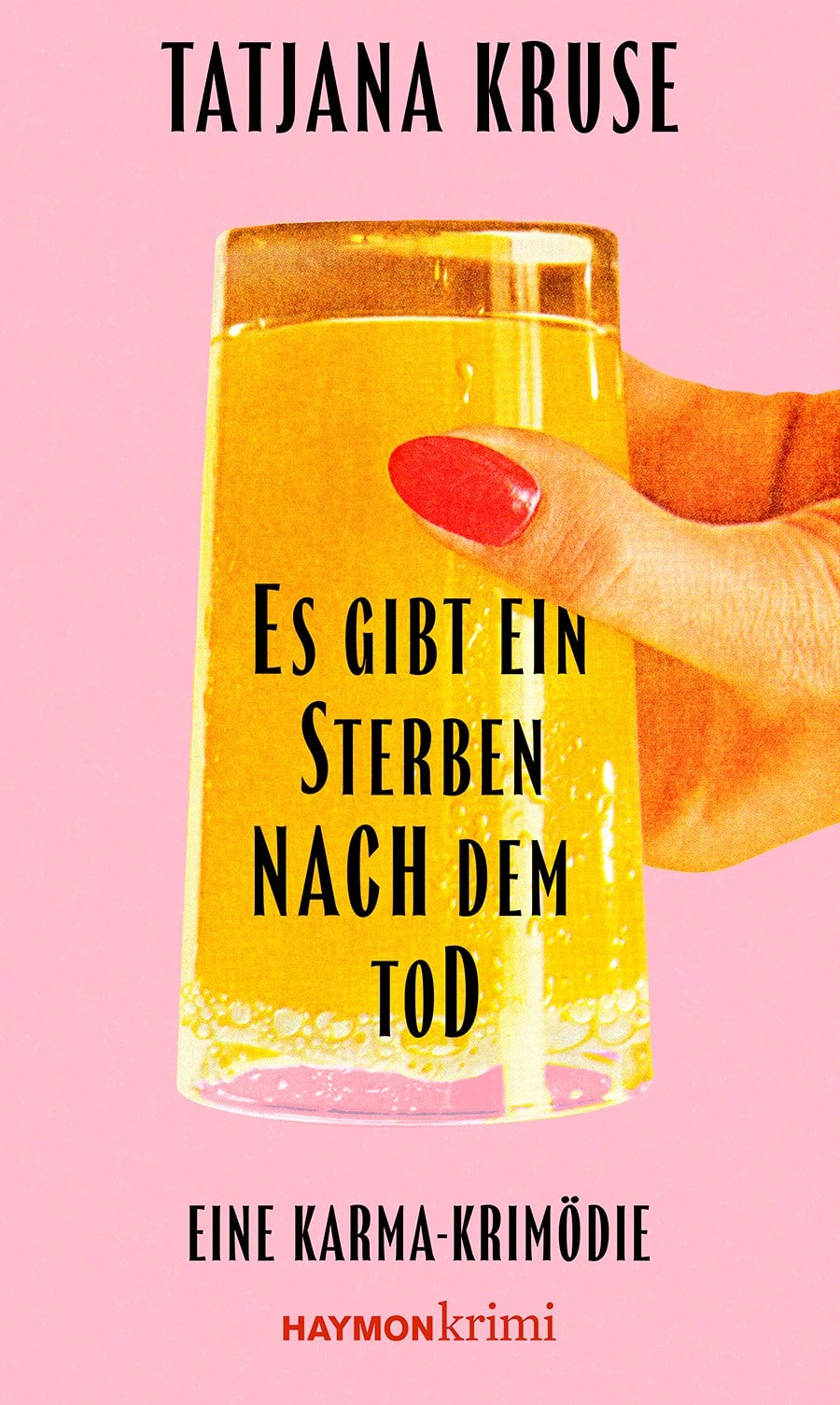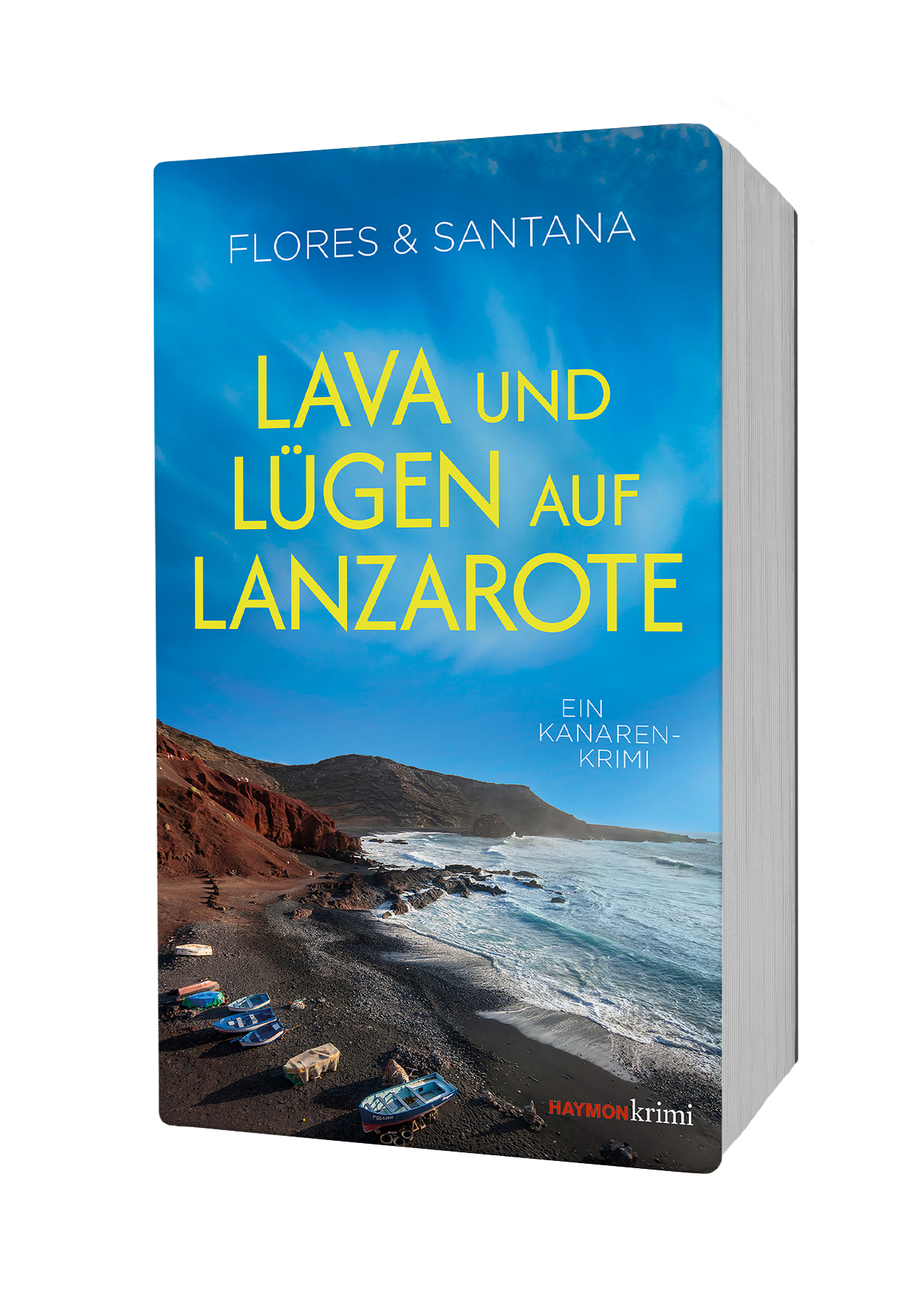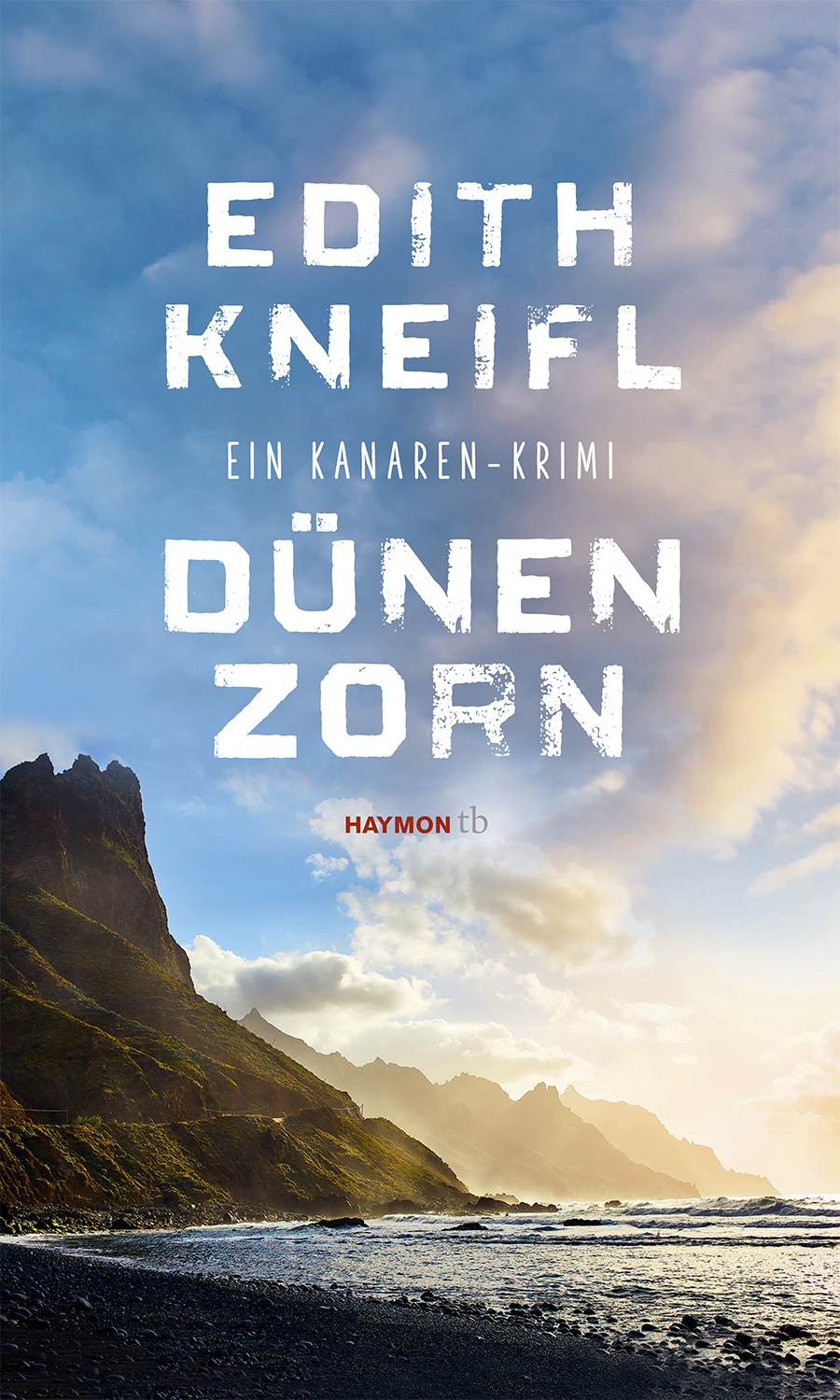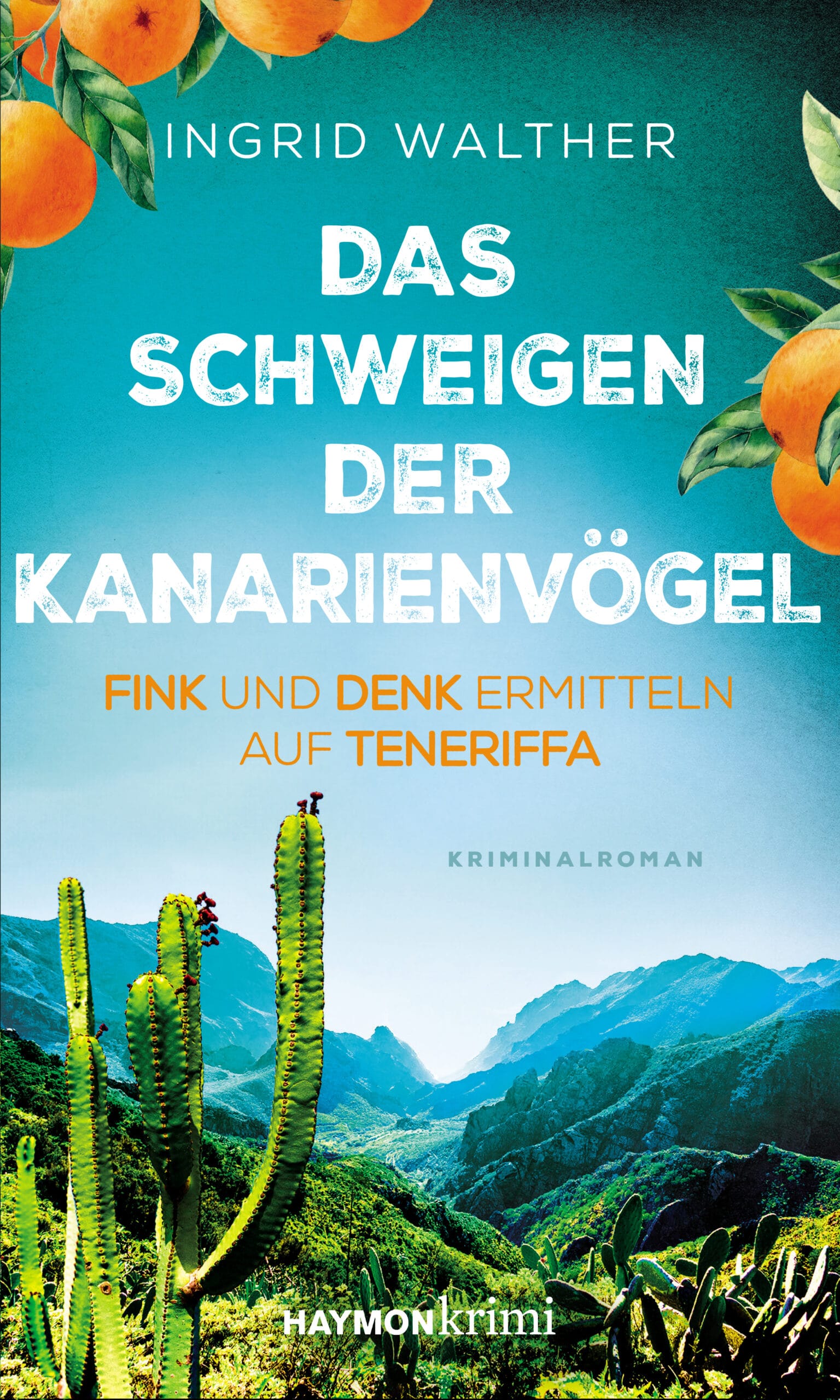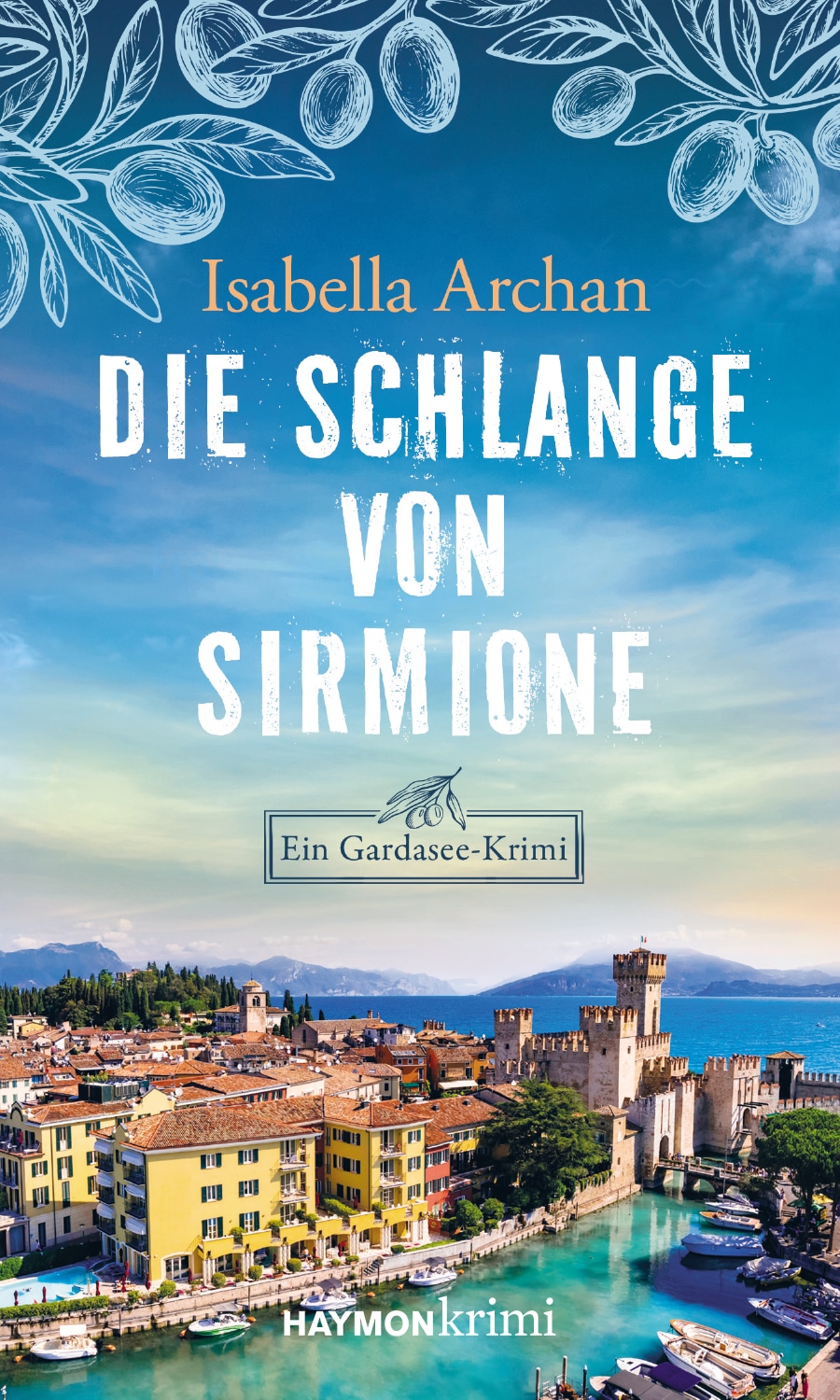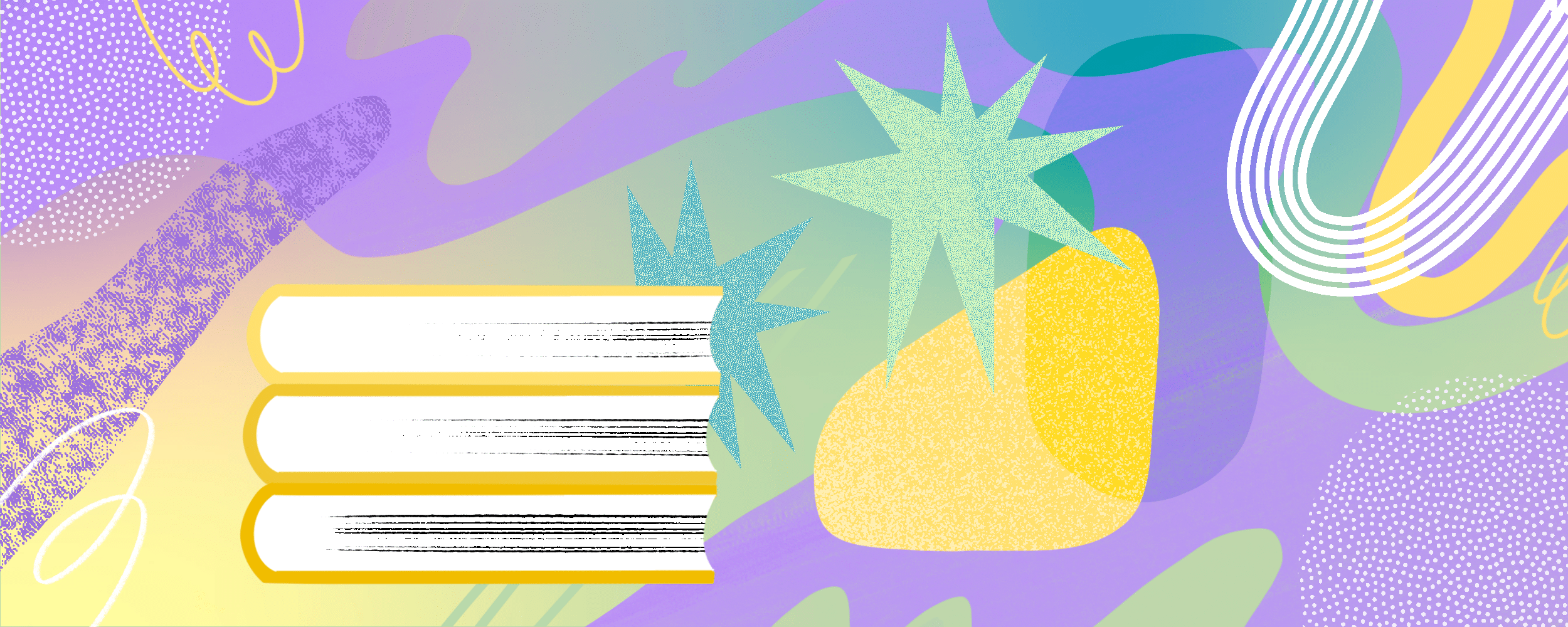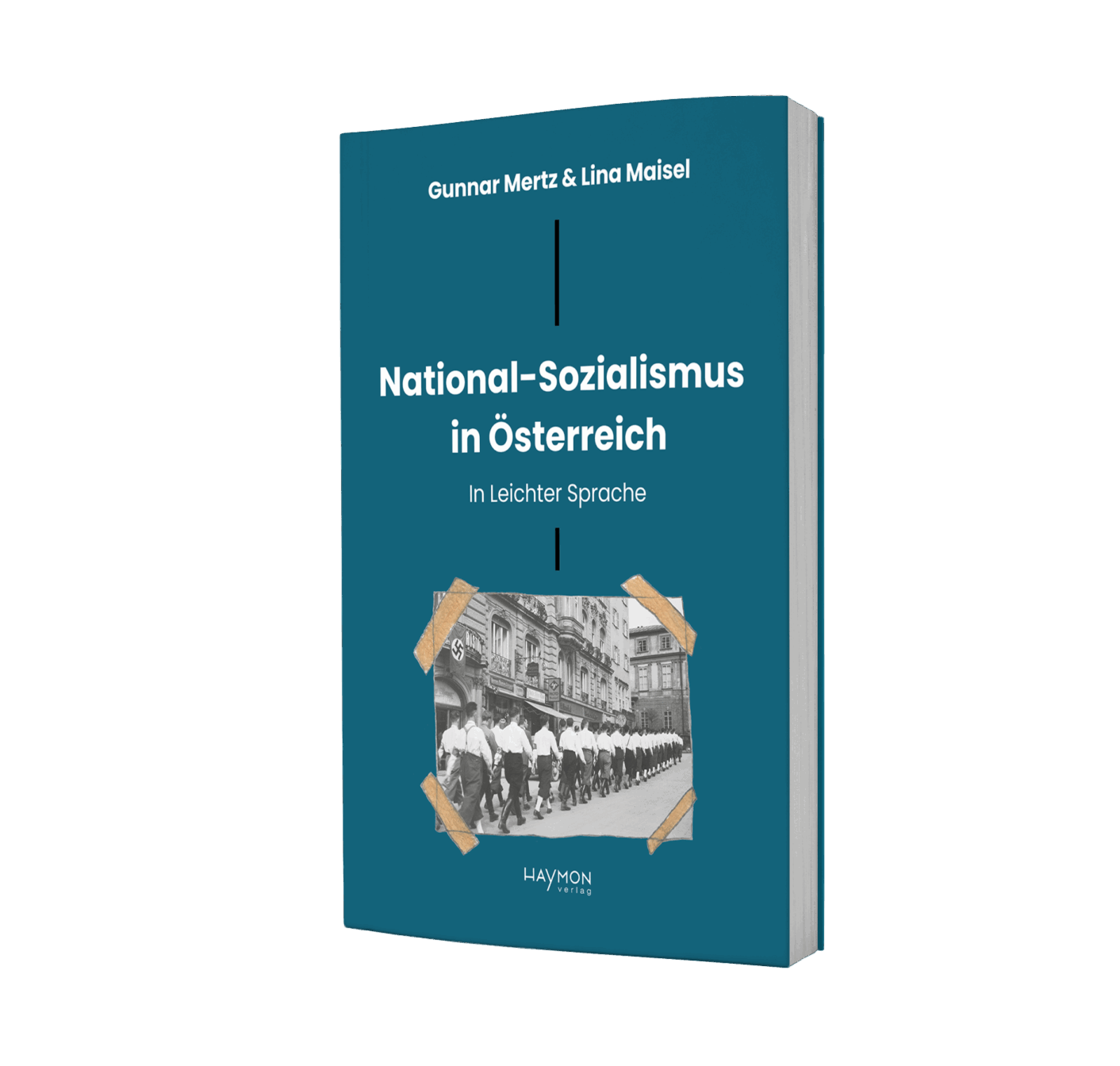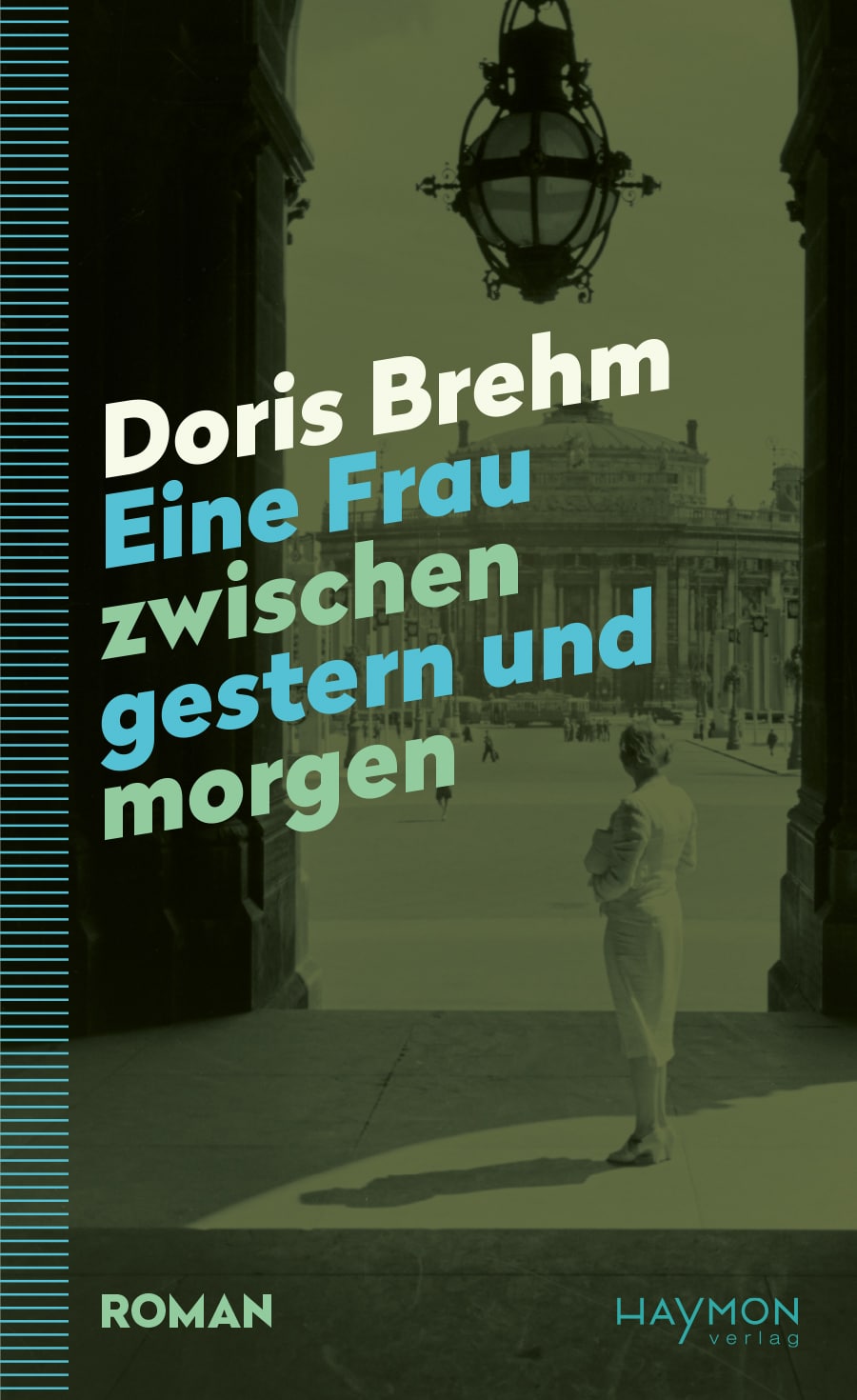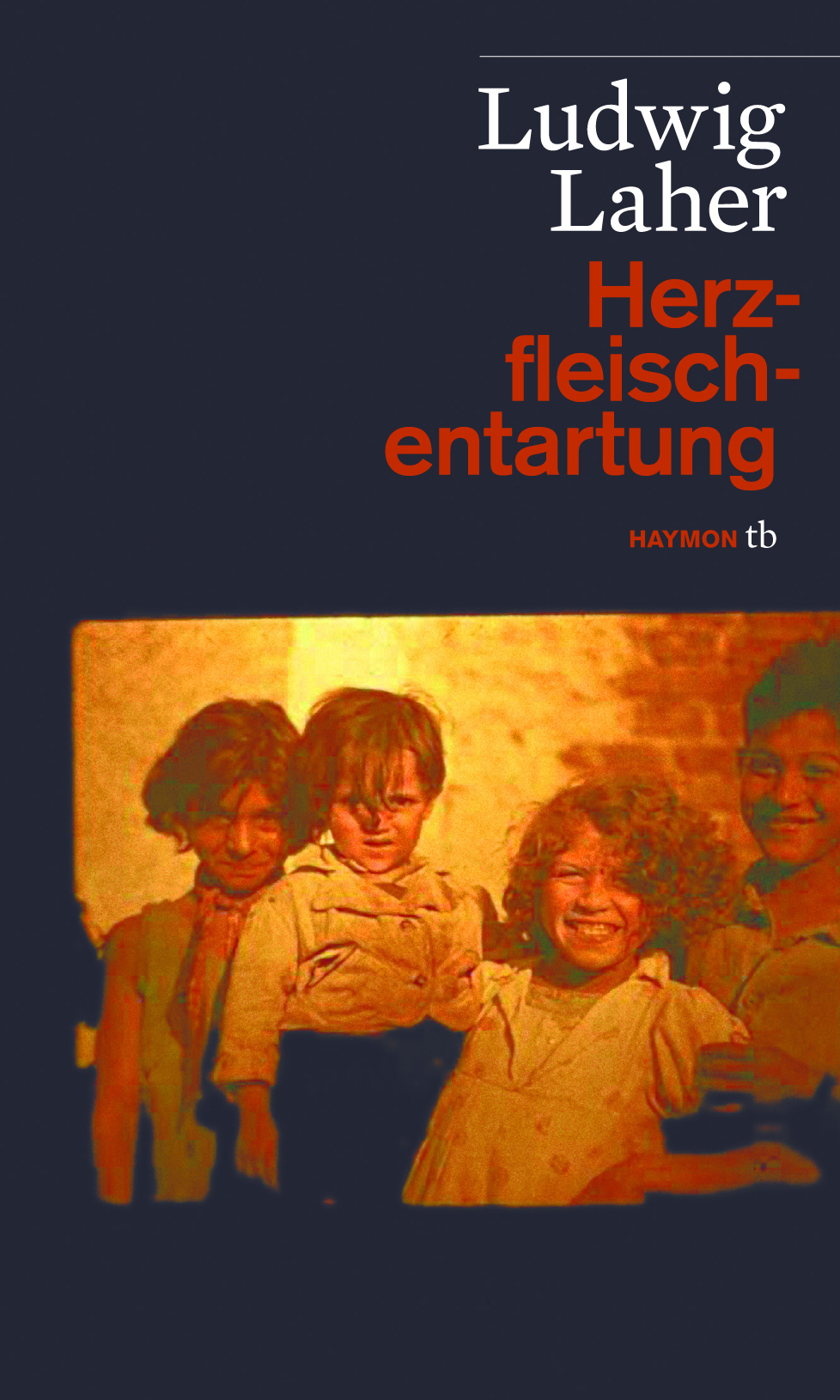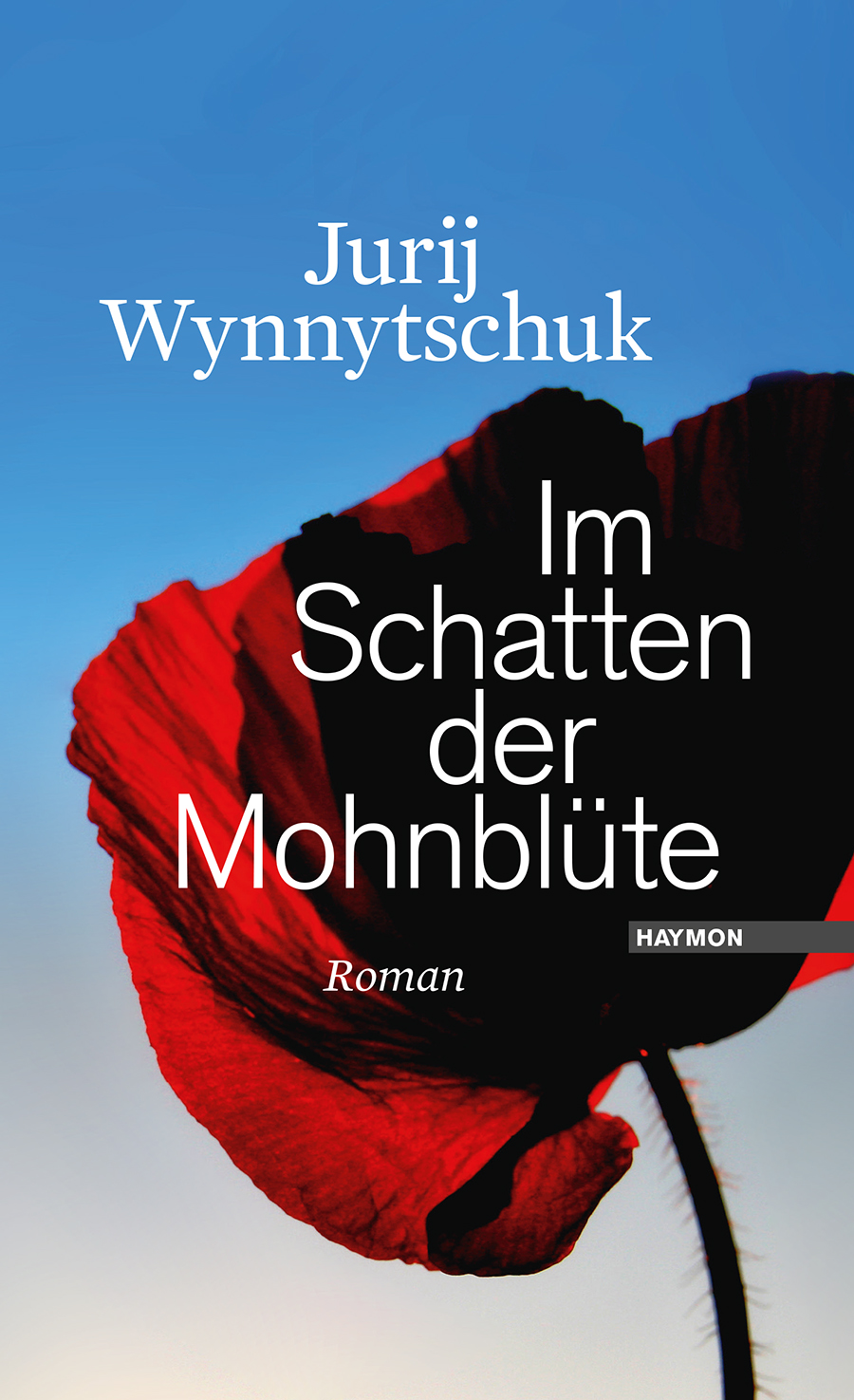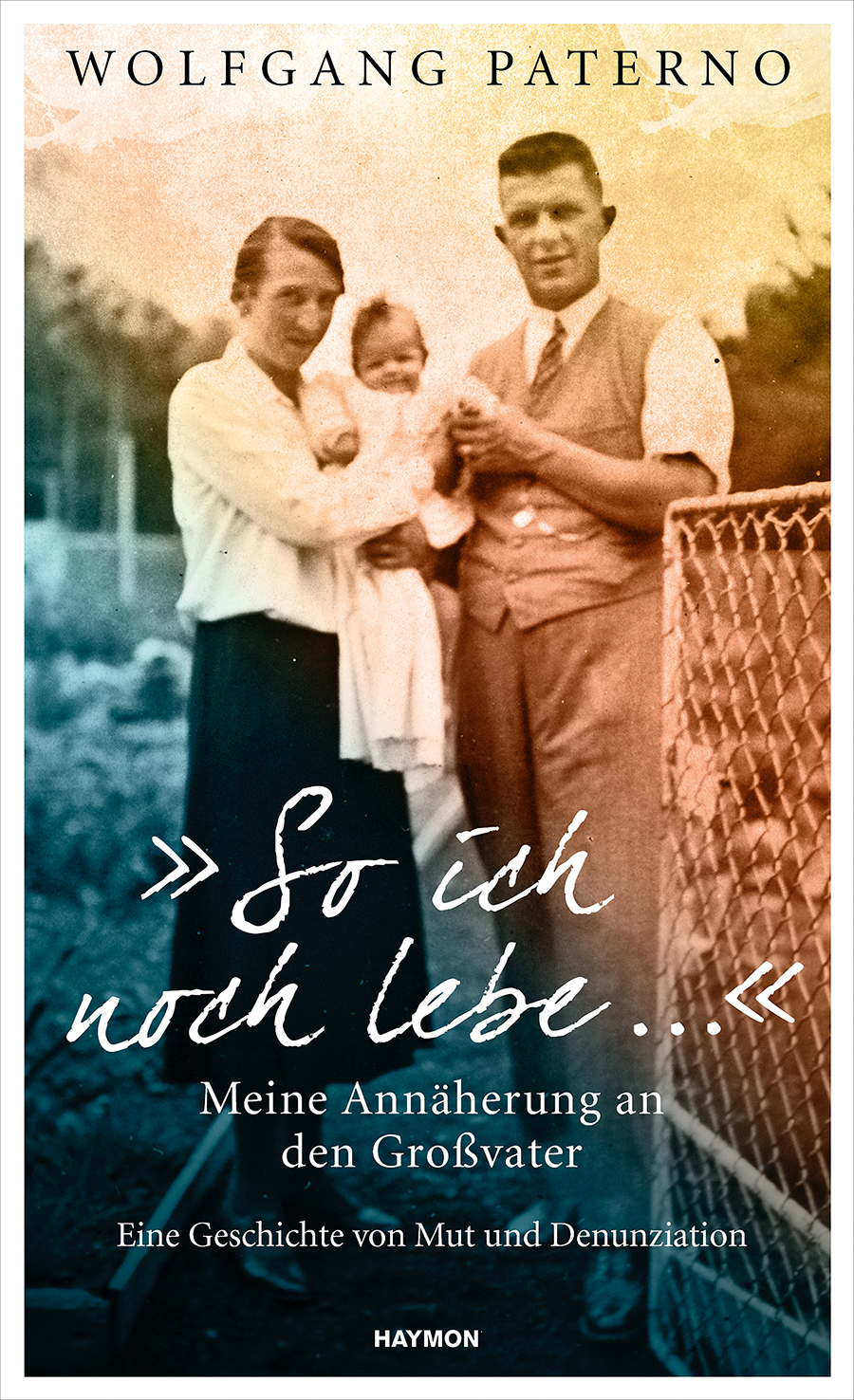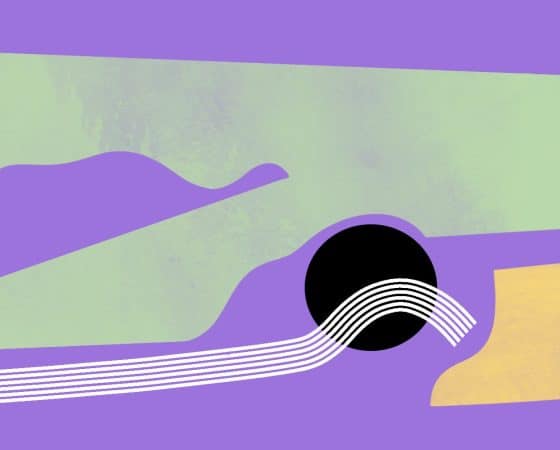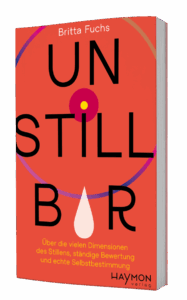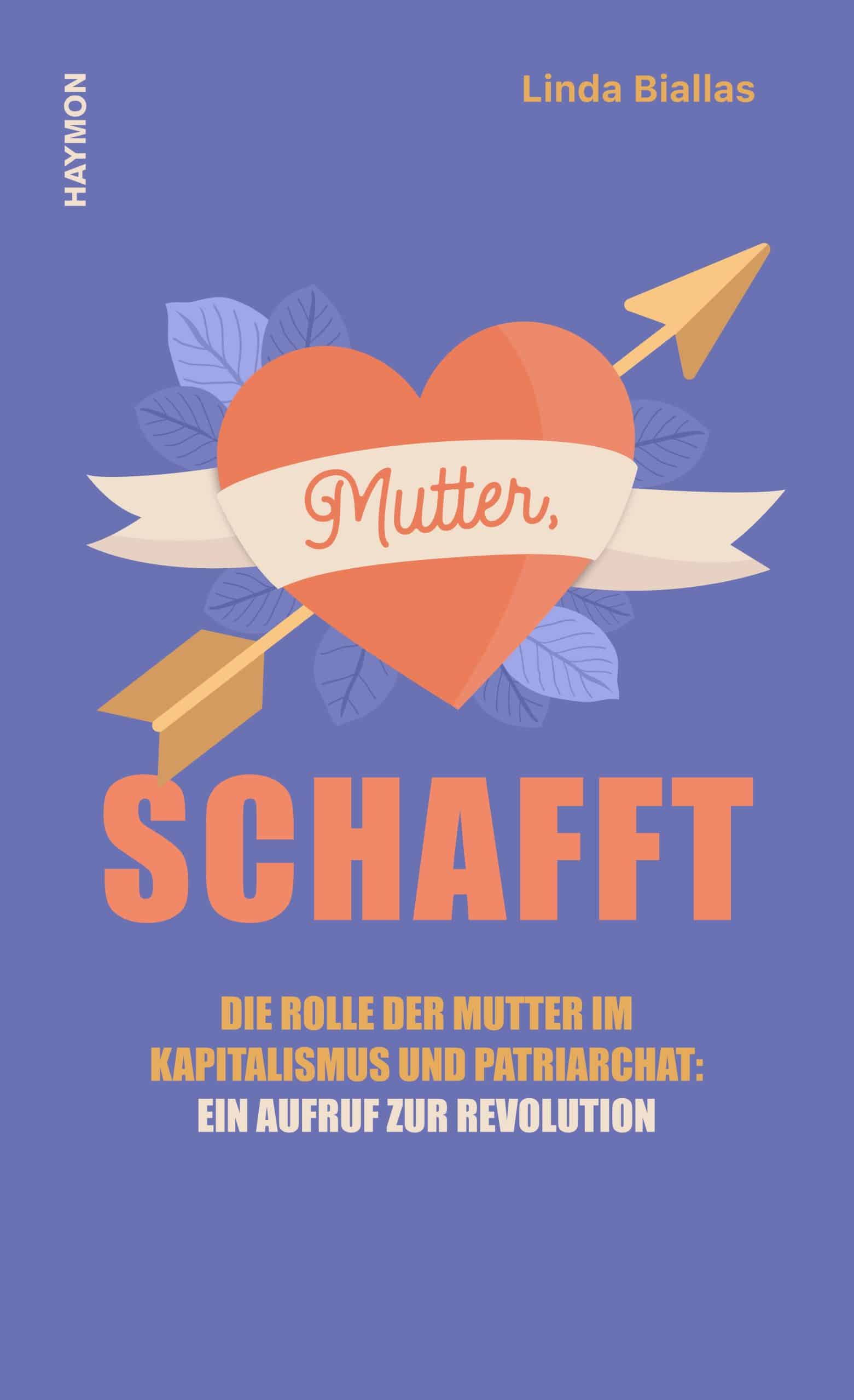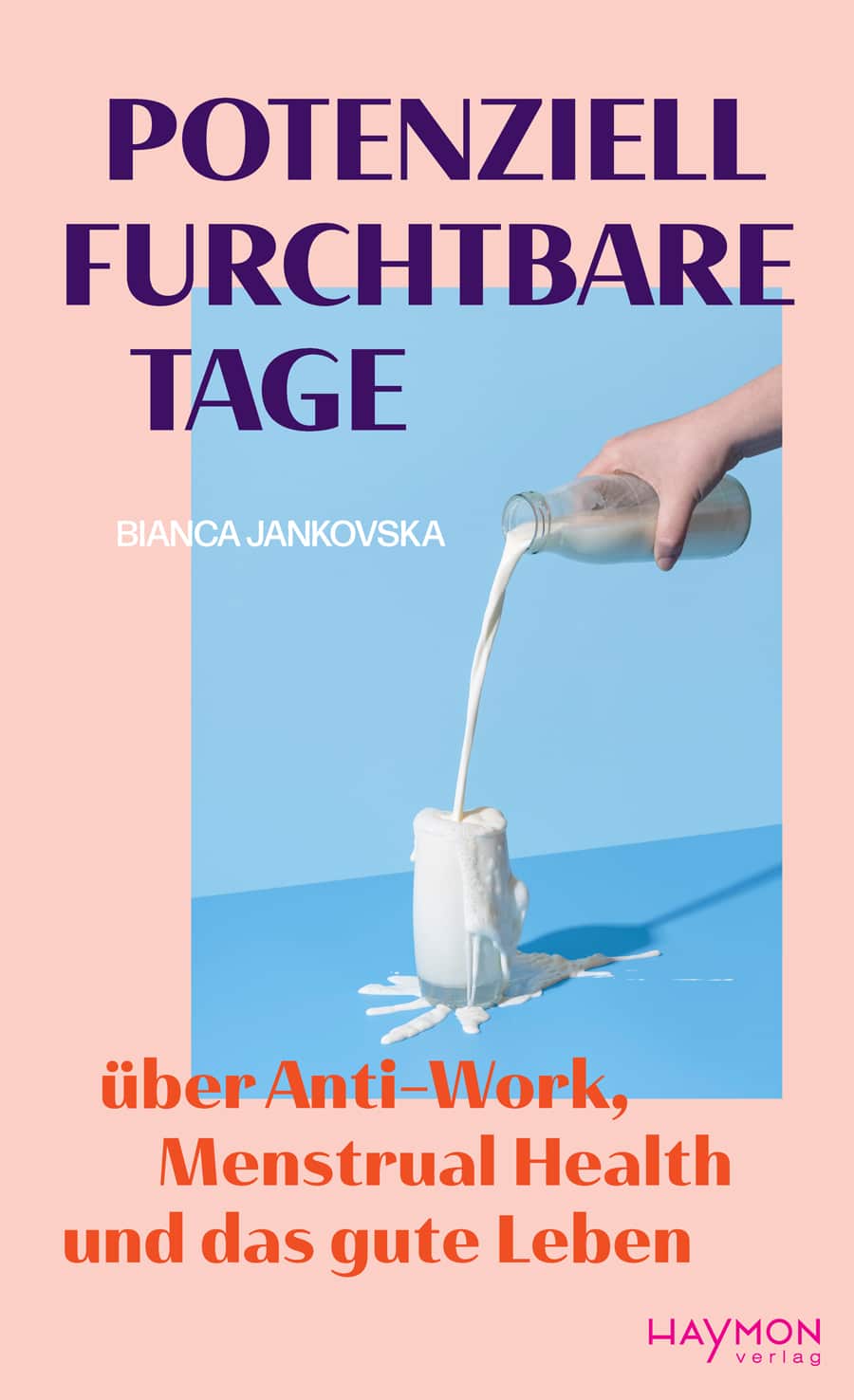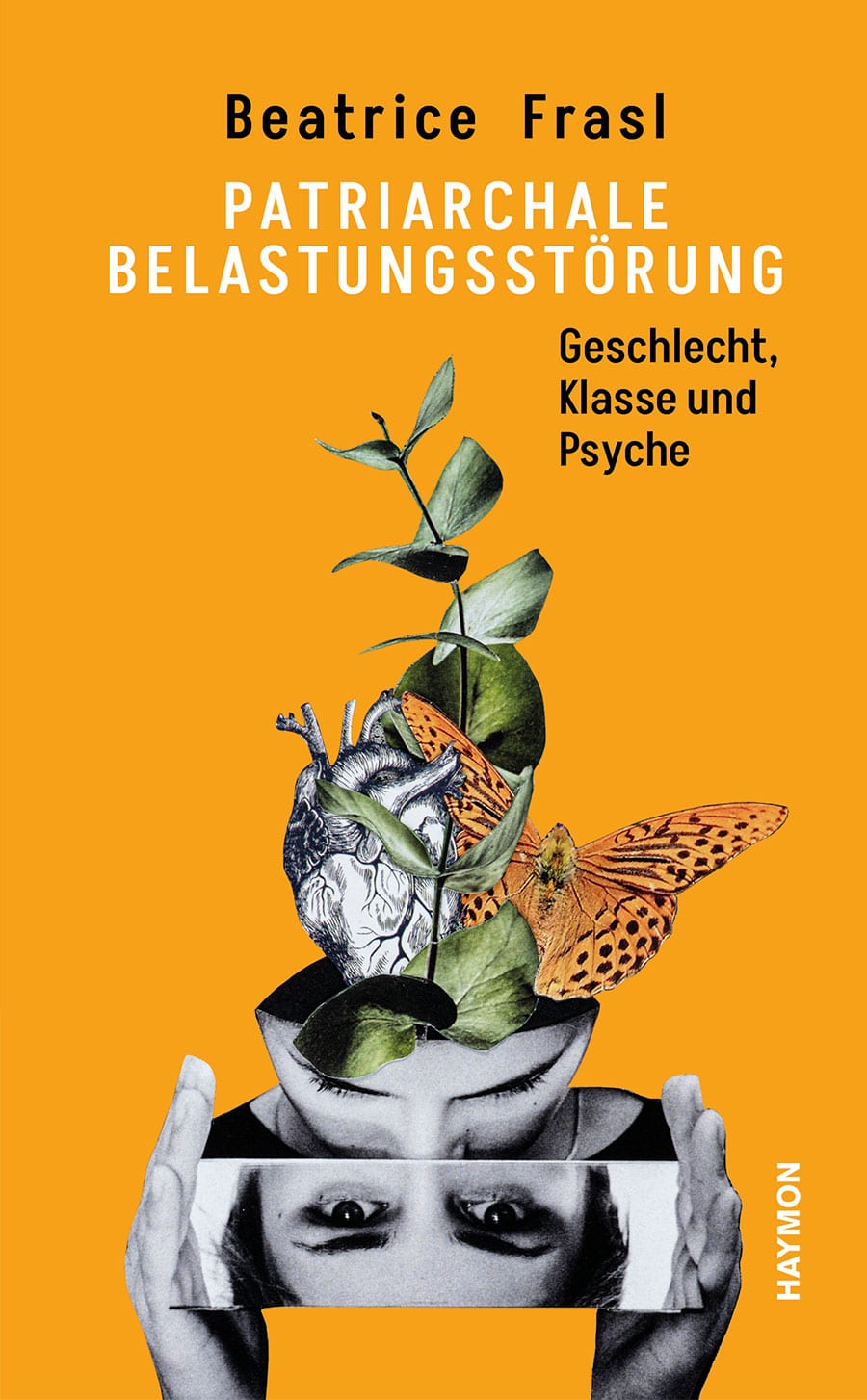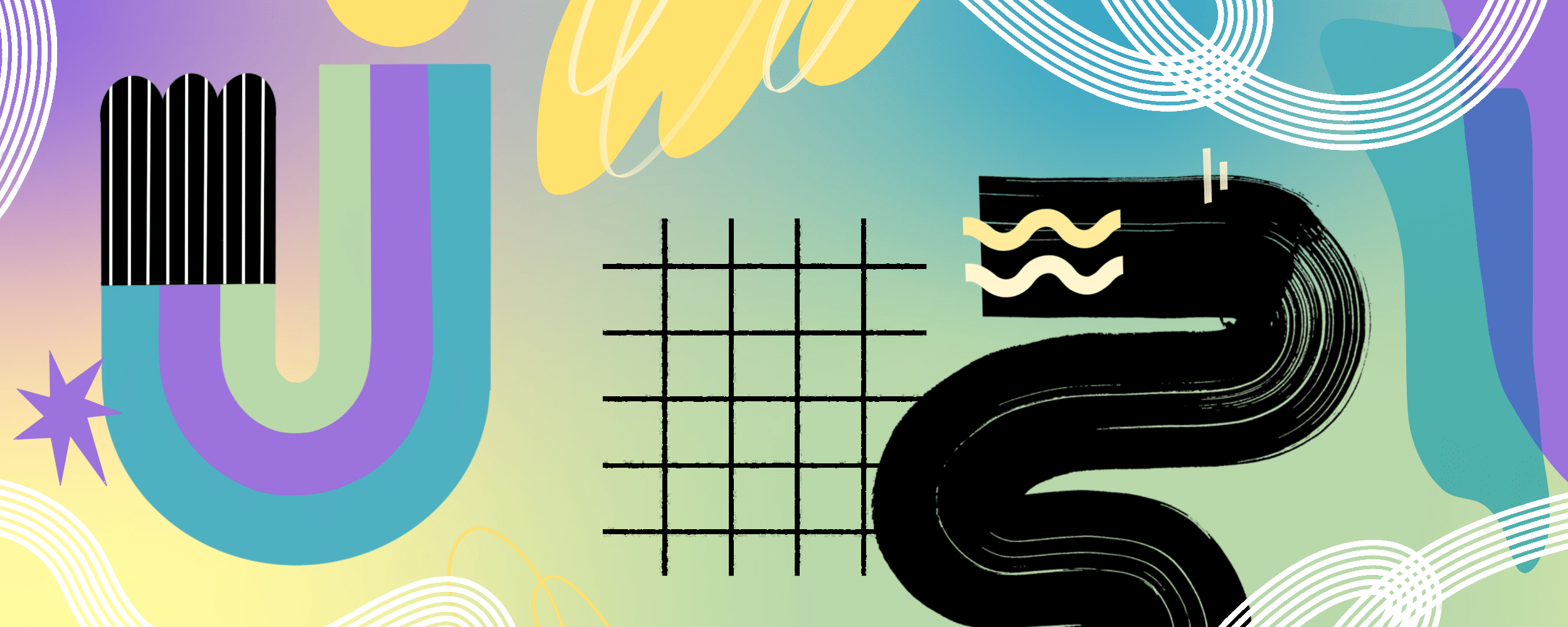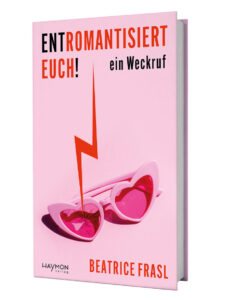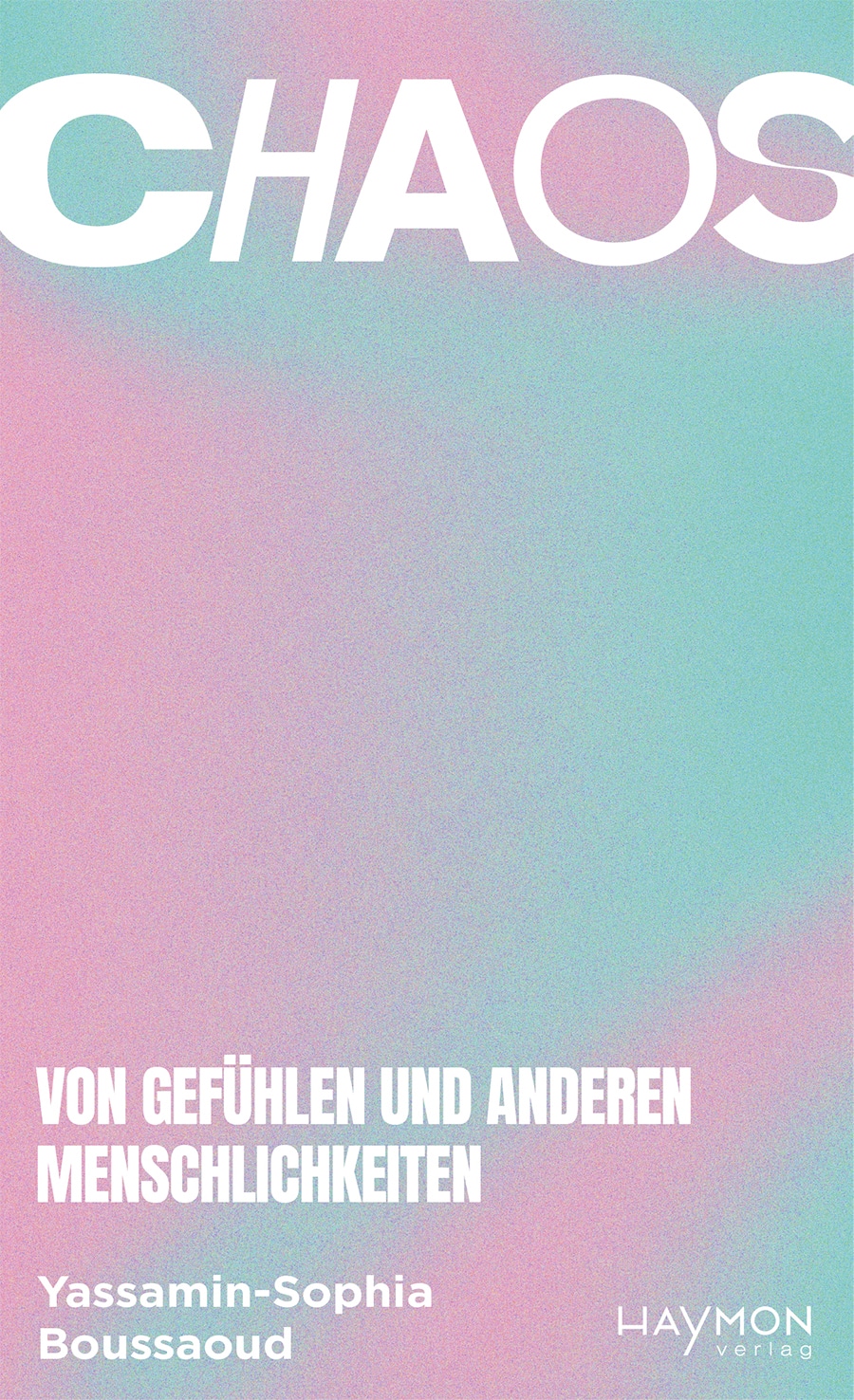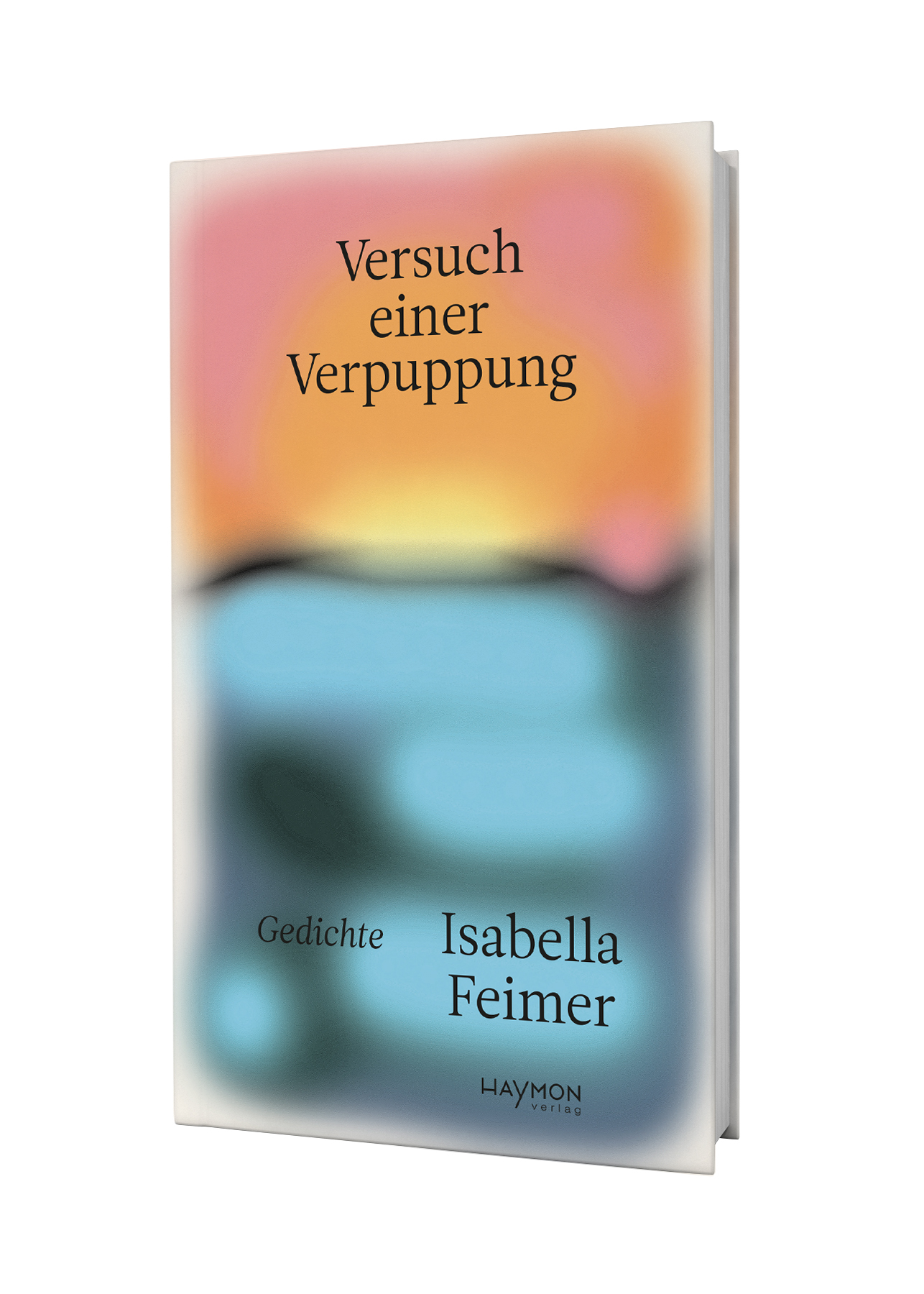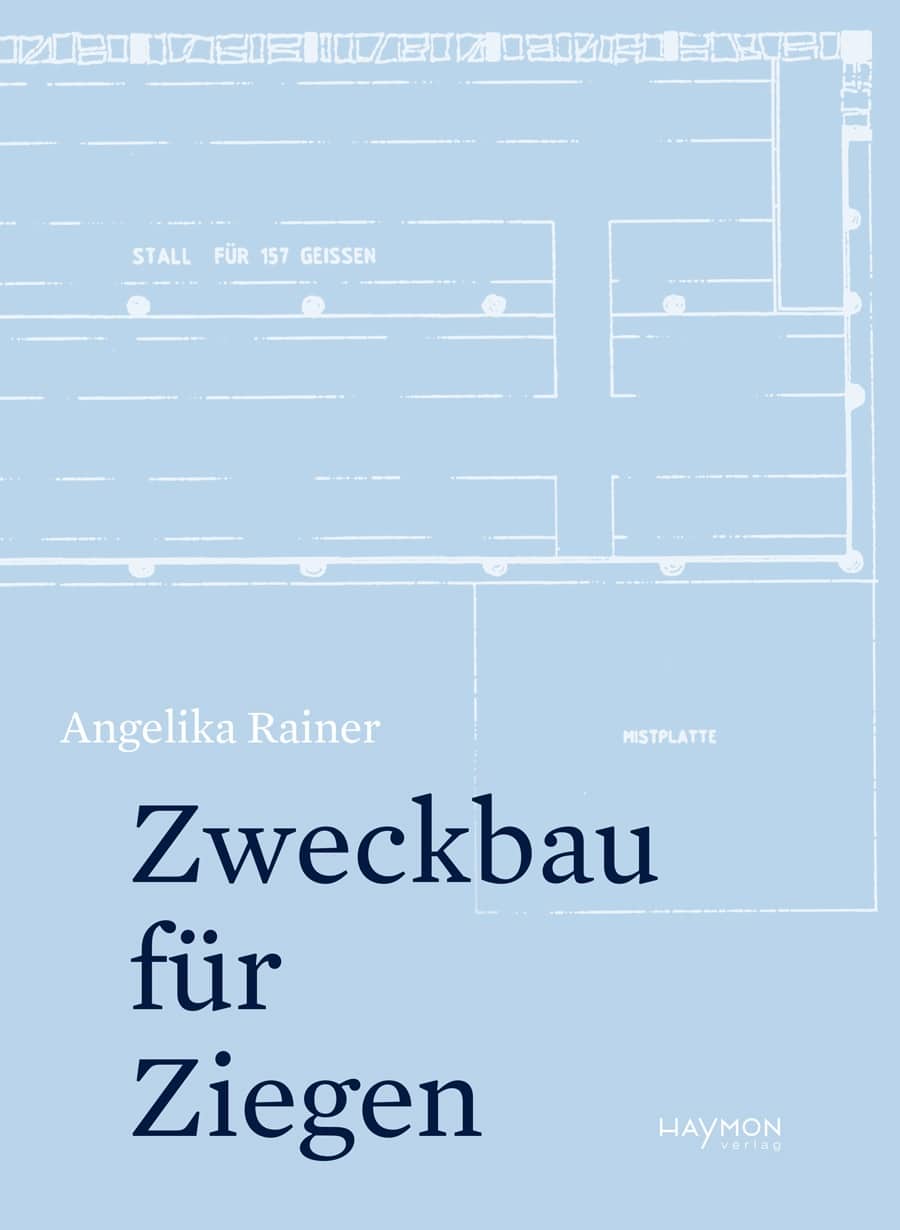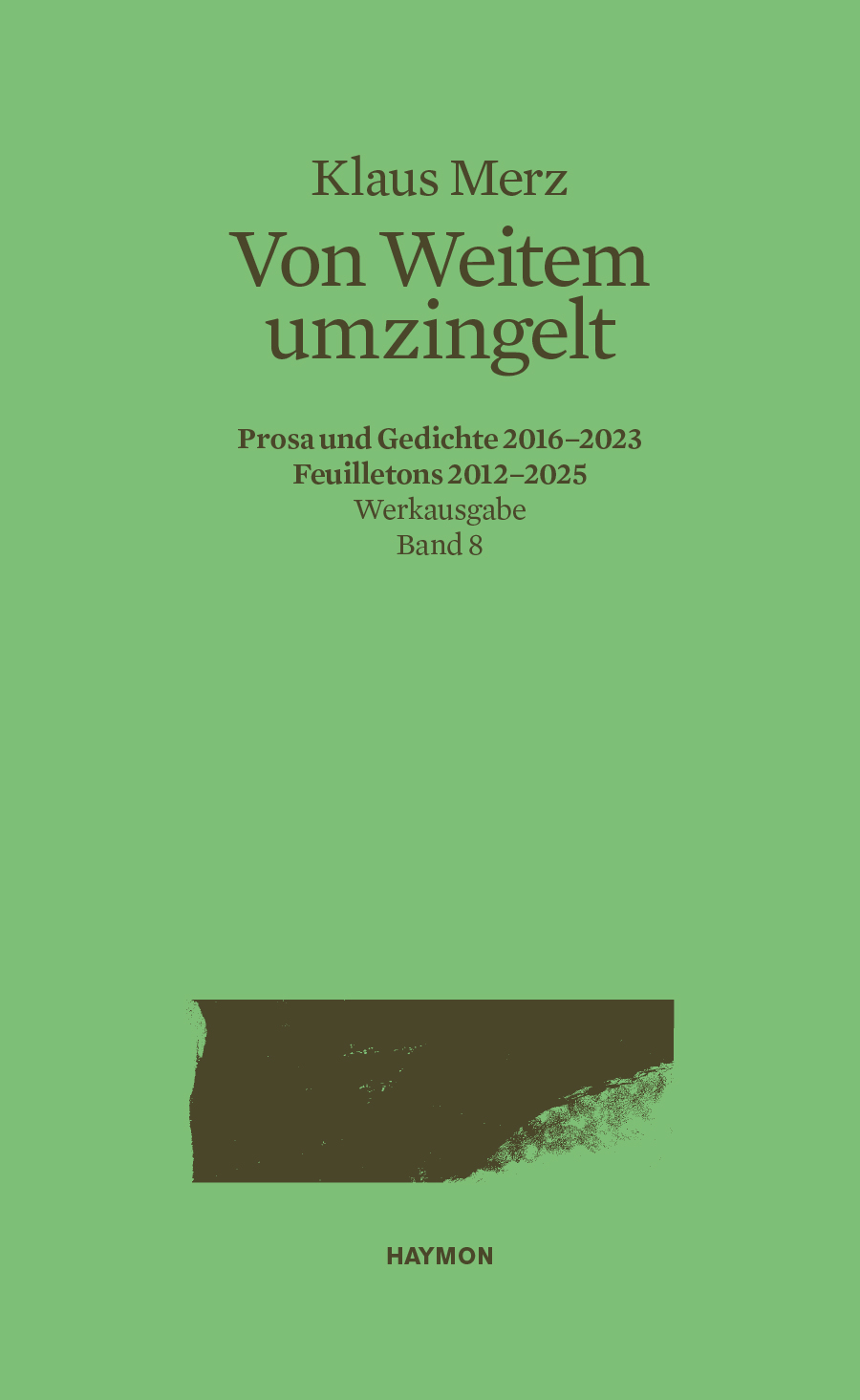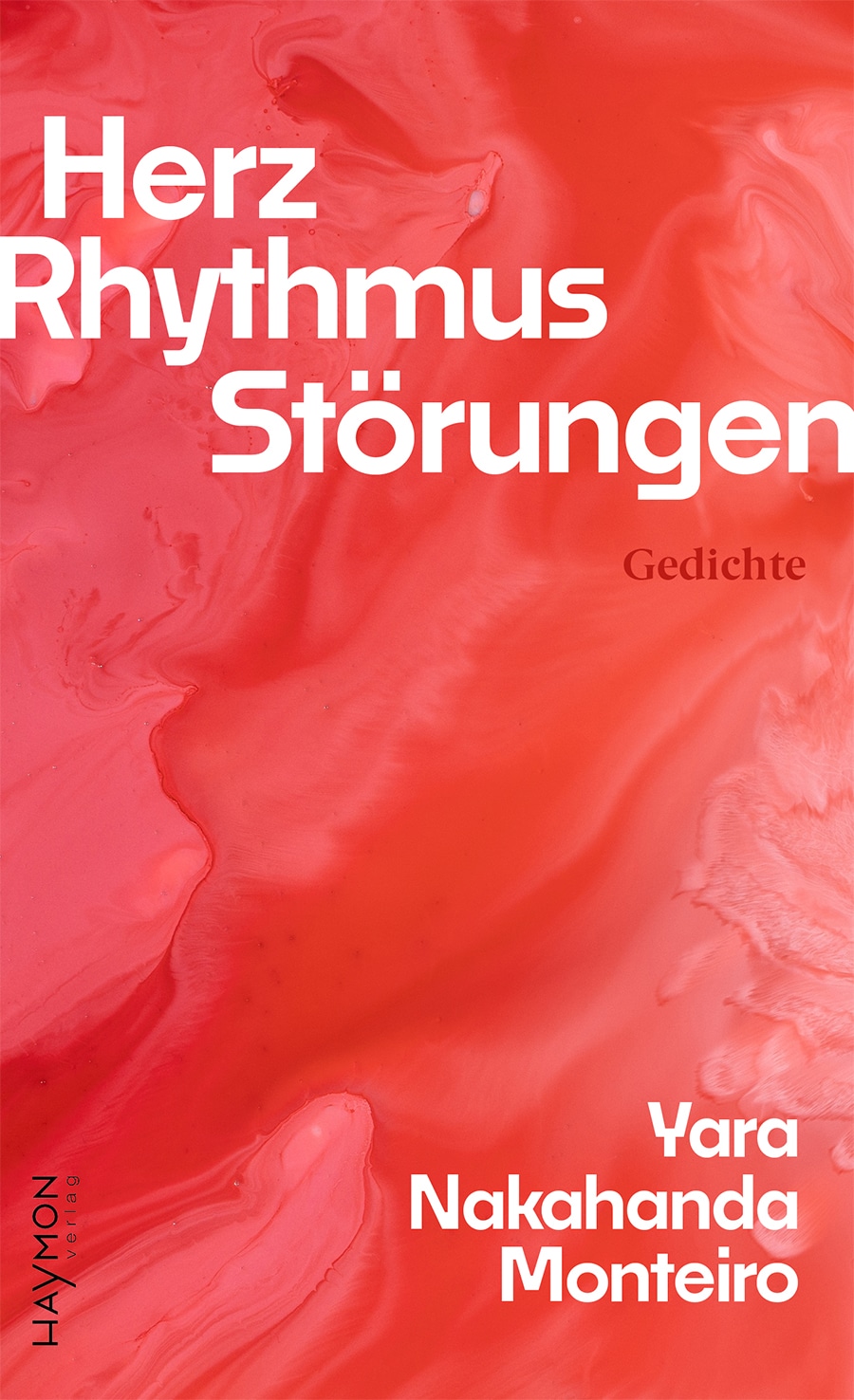Die Chefin will nicht verstehen, dass sie mich von der Leine lassen muss, wenn ich hier für Ordnung sorgen soll. Sie denkt, wir müssen auf Verstärkung warten. Fakt ist aber, diese schmutzigen kleinen Wolken haben die Autobahn lahmgelegt, und wir stehen hier einfach nur blöd herum.
Aspro, sitz, hat die Chefin befohlen, aber sie musste einsehen, dass ich auf diesem völlig versalzenen Streifen Asphalt fix kein „Sitz!“ machen werde. Da brennt mir der Po, als hätte Doktor Chili persönlich bei mir Fieber gemessen.
Die Menschen in den Autos schieben ihre Hintern hin und her und sehen mit ihren weißen Februargesichtern aus wie kleine Zombies. Hätte sicher praktische Aspekte, wenn die gestressten Leute im Frühverkehr diese Zeit jetzt für Atemyoga nutzen würden, machen sie aber nicht. Genauso wenig wie ich. Diese blökenden Filzknäuel machen mich nämlich fertig. Ihnen muss doch mittlerweile auch klar sein, dass das Projekt Süden gescheitert ist.
Unfassbar ist das alles. Mein Image leidet, weil ich nur herumstehe. Die Schafe traben immer wieder an uns vorbei und mischen sich unter die Lichter der Staufahrzeuge. Was für ein verrückter Anblick. Ein Fahrer steigt aus und rennt brüllend auf die blökenden Tiere zu, um sie von seinem Auto fernzuhalten.
Wie Popcorn springen sie herum und laufen im Kardiogrammstil vor ihm davon. Sanft ziehe ich an der Leine, wieder werde ich zurückgehalten.
Hallo Chefin, ich heiße Aspro und nicht Baldrian. Darf ich jetzt bitte hier endlich für Ordnung sorgen? Ich bin ein Hund, ich kann das.
Ich belle, renne herum, und zack, zack wären die Popcorn wieder in der Tüte. Wobei mir plötzlich klar wird, dass wir gar keine Tüte haben. Und dass genau aus diesem Grund hier nichts weitergeht. Wie deprimierend das ist.
Auch den Schafen schlägt das Ambiente aufs Gemüt, sie werden immer noch dämlicher. Eines kommt nervös auf mich zu und schnuppert an meinem Kopf, als wäre ich sein Onkel. Nur, weil ich weiß bin, bin ich noch lange kein Schaf, etwas mehr Respekt, bitte! Ich belle dreimal, tief und überzeugend. Es zuckt zusammen und galoppiert auf den Zaun hinter uns zu, um – Hokuspokus – zu verschwinden. Weg ist es, einfach so. Da waren es nur noch neun, denke ich mir überrascht und schaue lösungsschwanger der Chefin in die Augen. Da ist ein Loch im Zaun, morse ich ihr mit meinem Blick.
Das Autoradio spielt Eye of the Tiger, und sie versteht. Lautlos öffnet sich der Verschluss am Ende der Leine. Zu Hause hat das Baby dieses runde Ding, wo die passenden Klötze durch die Löcher müssen. Bei mir sind es Popcorn auf Beinen, die durch den Zaun müssen. Ich verschaffe mir einen Überblick und lege los.
Vergesst Lassie, Kommissar Rex und das Schweinchen namens Babe. Ta-ta-taaaaah! Ta-ta-taaaaah!
Ich fetze durch die Autogassen und treibe ein weiteres Schaf in Richtung Loch, den Rest erledigt die Chefin. Noch acht. Ein phänomenaler Spaß. Die Schafe springen und blöken und stellen sich unglaublich kompliziert an. Lassen sich extralang Zeit und schimpfen mit mir. Aber Ausdauer ist mein zweiter Vorname.
Und da waren es nur noch sechs.
An mir ist ein Elitehütehund verlorengegangen, alles könnte ich in Pferche treiben: Rinder, Strauße, Kängurus. Schon wieder verschwindet eines im Loch, und ein zweites läuft freiwillig hinterher. Auch einige der Autofahrer haben das Prinzip verstanden. Sie bilden an zwei Stellen eine Mauer, und so gelingt es ruck, zuck, die letzten Mitglieder der Popcornfamilie auf der Wiese hinter dem Zaun zu versammeln.
Hechelnd stehen wir da und bestaunen unser Werk.
Schmutziges Weiß auf schmutzigem Weiß nennt sich das Kunstwerk. Technik: entlaufene Schafe auf schneebedeckter Wiese, 2021.
Künstler: Aspro von Chefin.
Ich werde gestreichelt und gelobt.
Glücklich kehren alle zu ihren Wägen zurück.
Der Stau macht sich auf in den Tag.
Zufrieden rolle ich mich im Kofferraum zusammen. Die Chefin singt gleich beim Losfahren mit dem Autoradio im Chor.
Leider habe ich eines vergessen. Ich hätte den nutzlosen Februar auch noch durch das Loch stecken sollen. Dieses schwarze Schaf unter meinen Monaten.