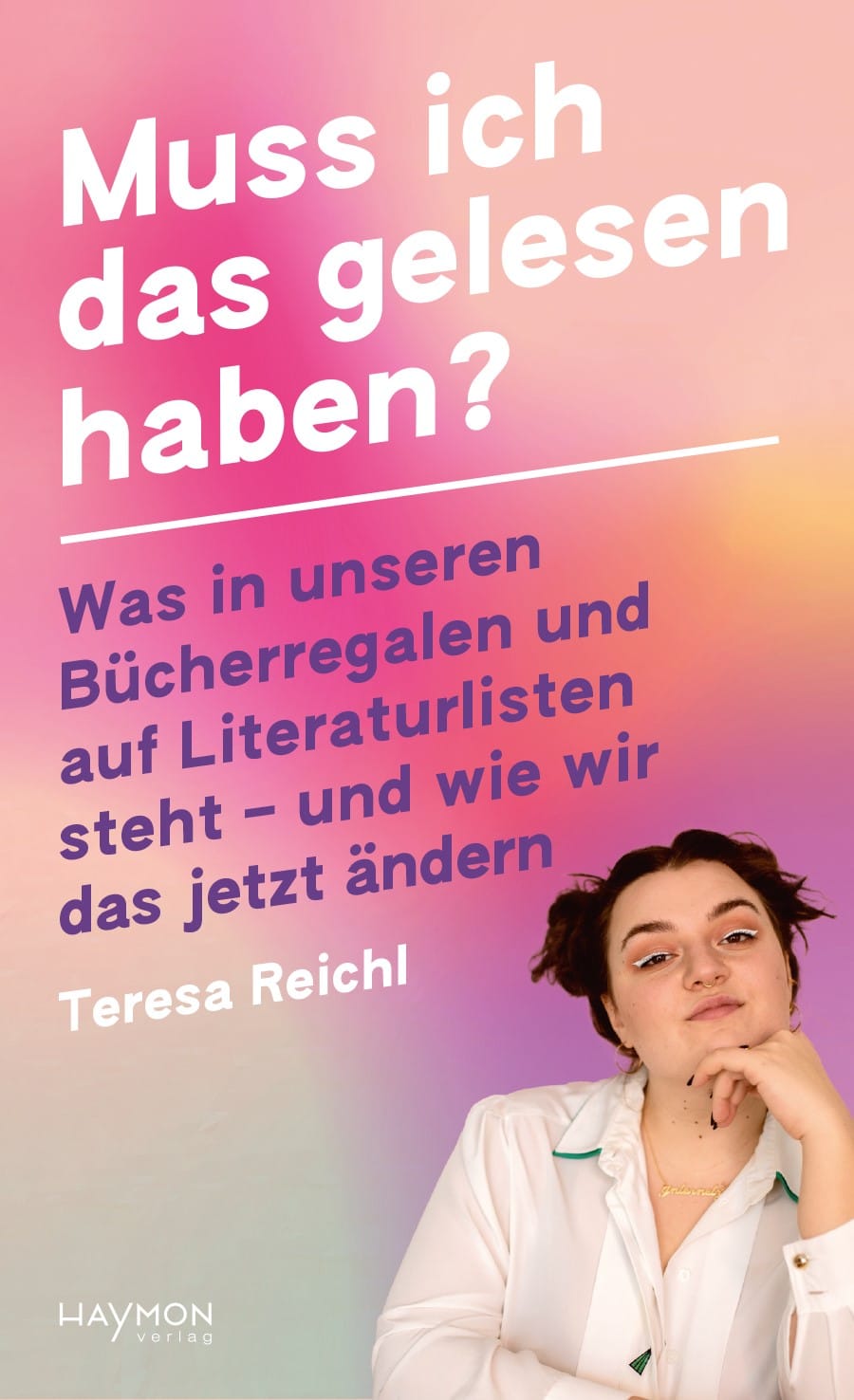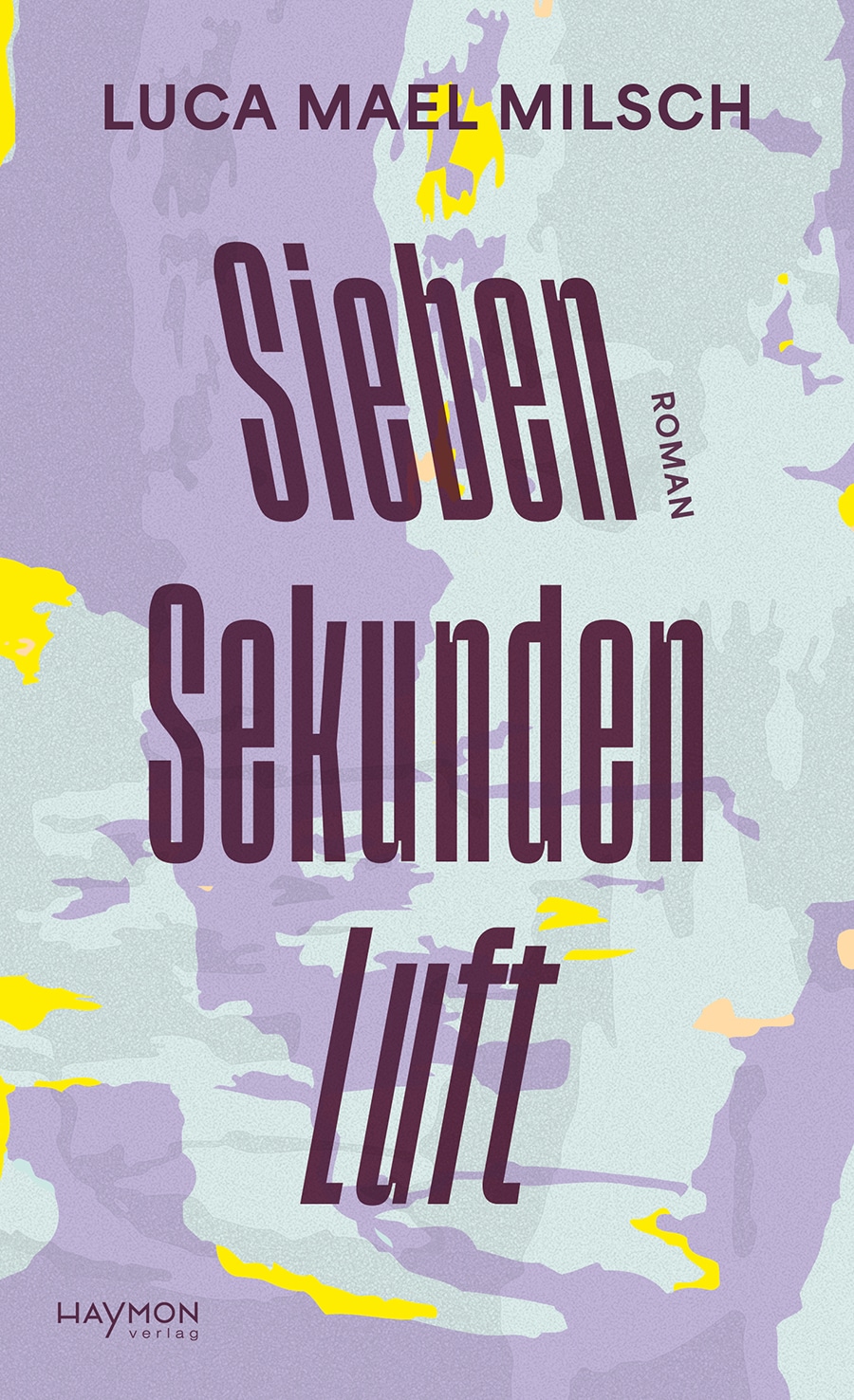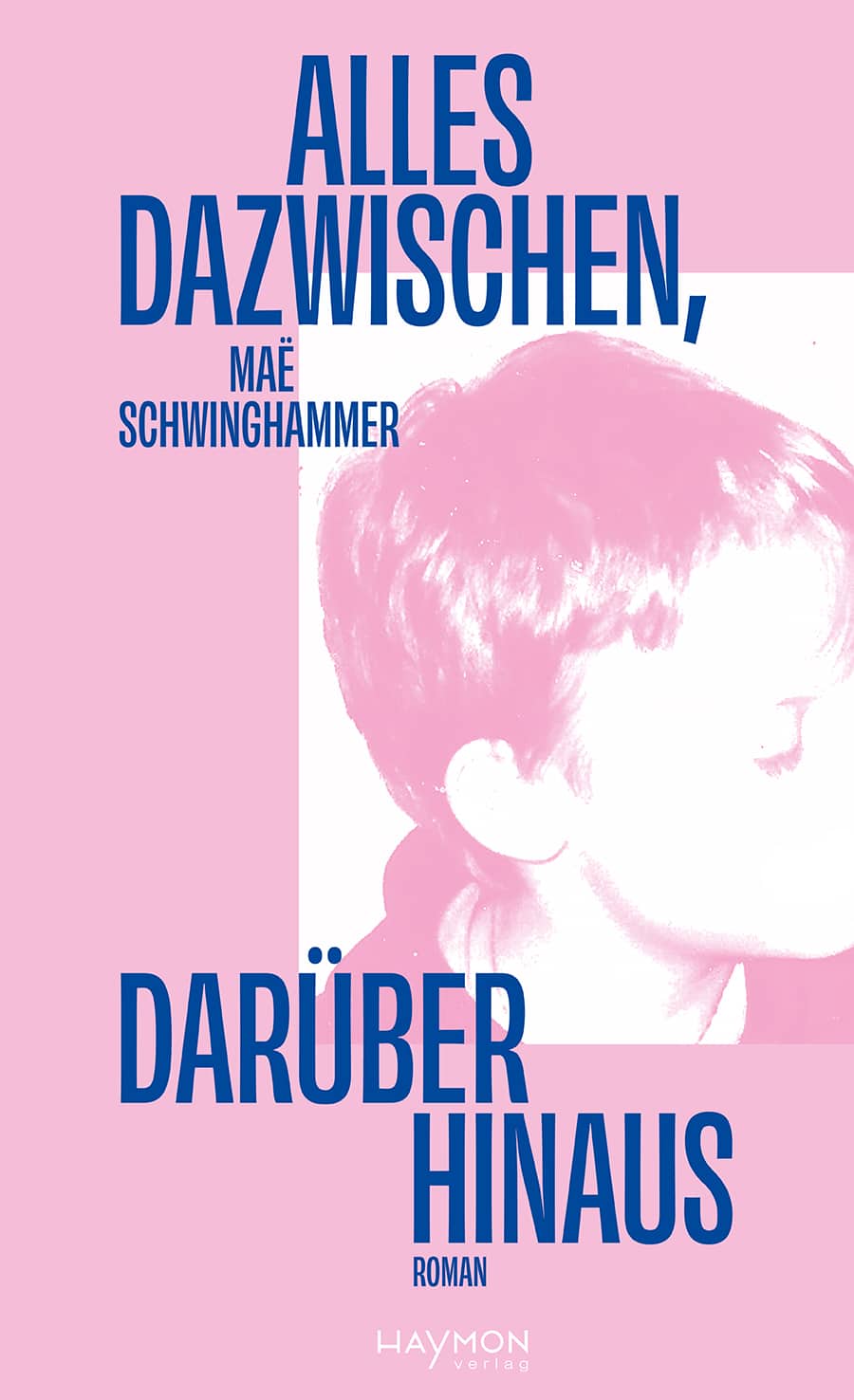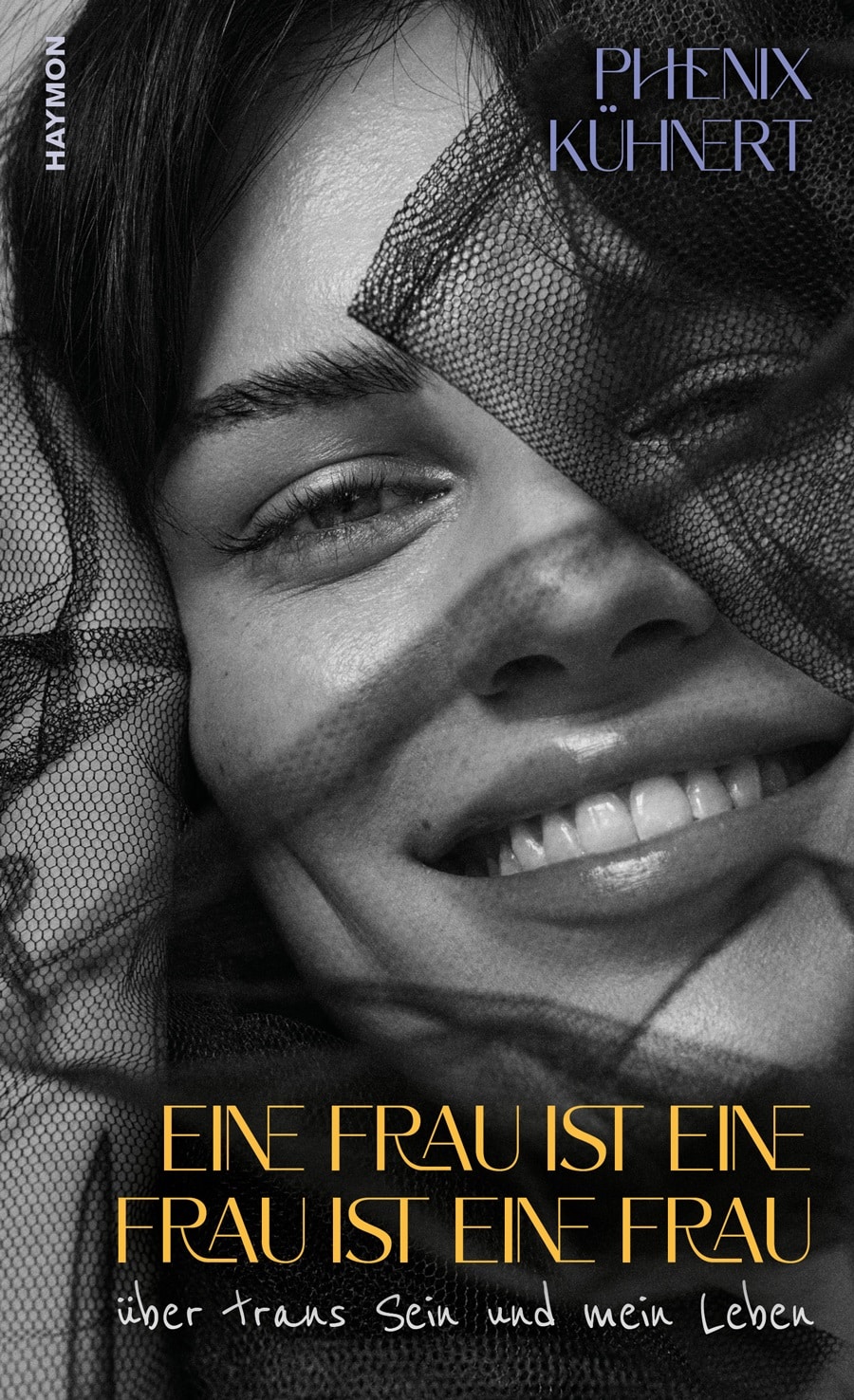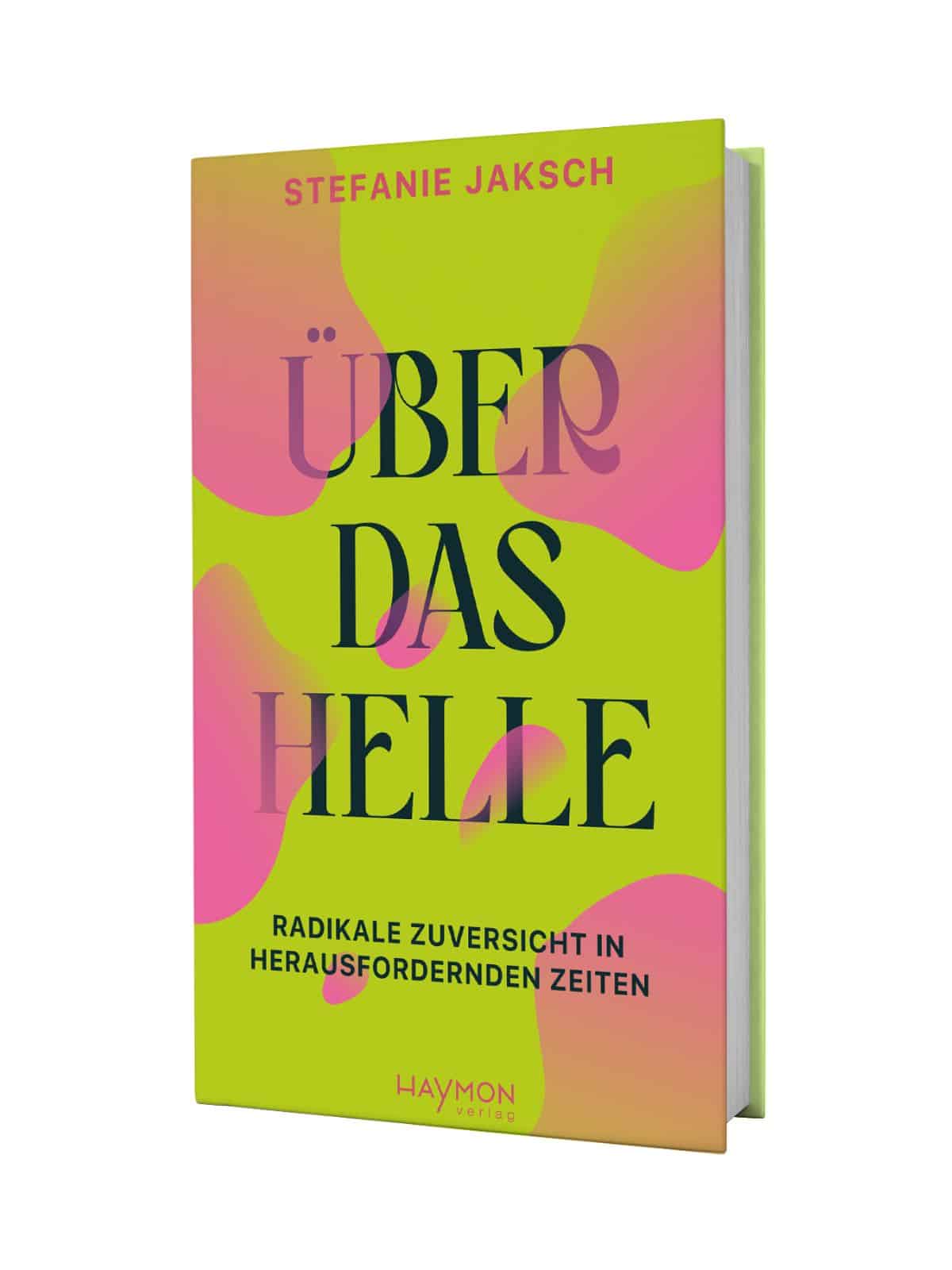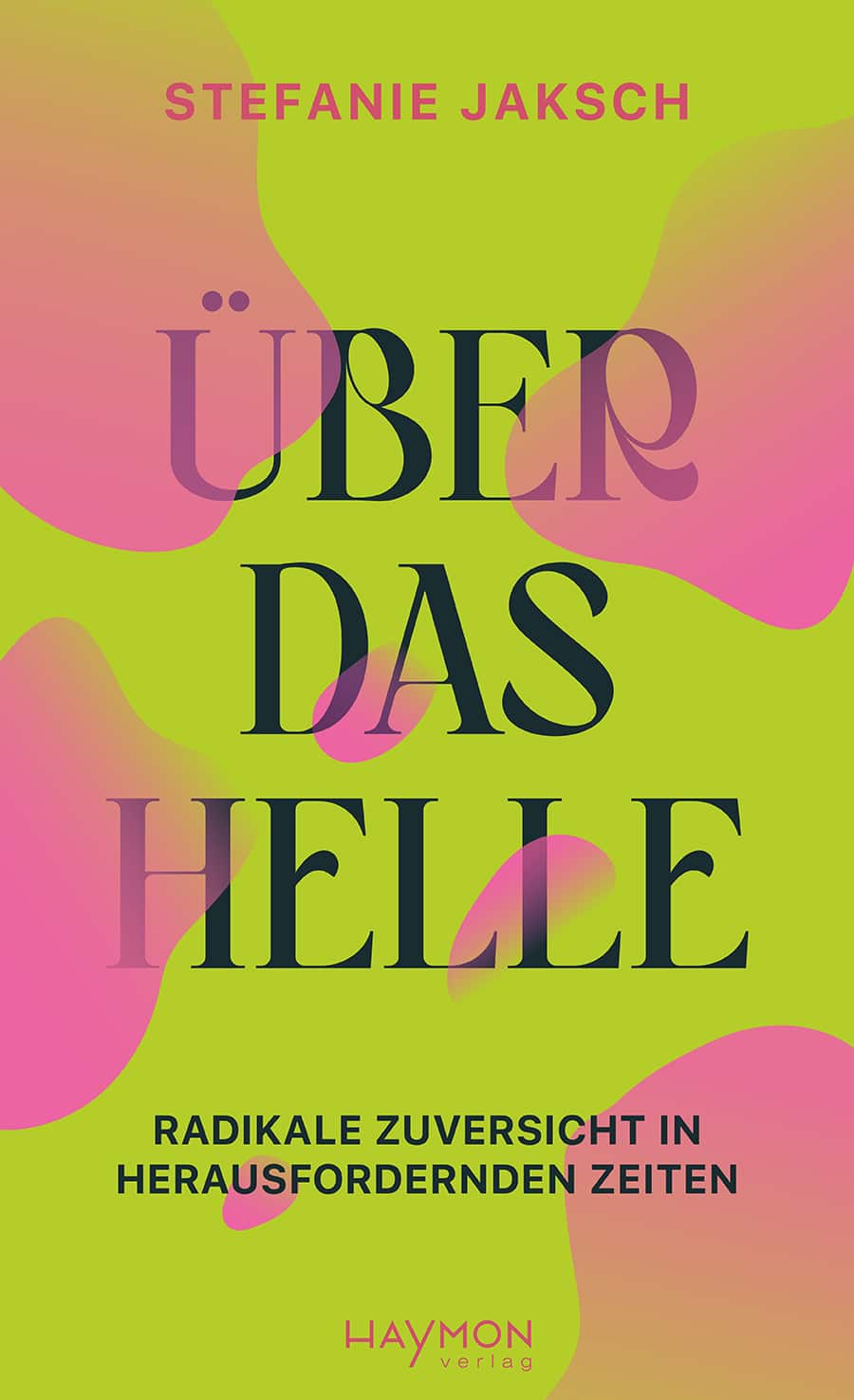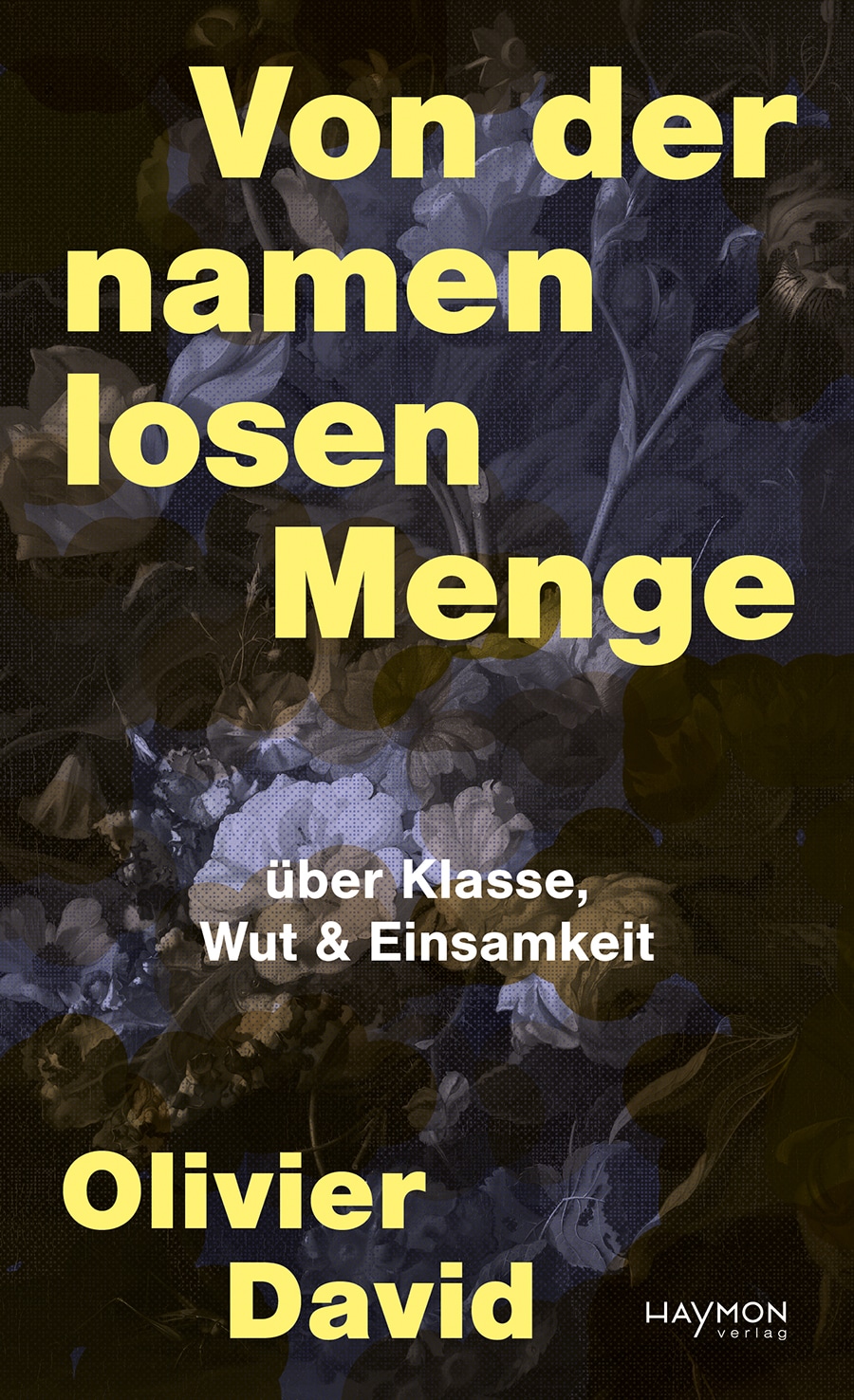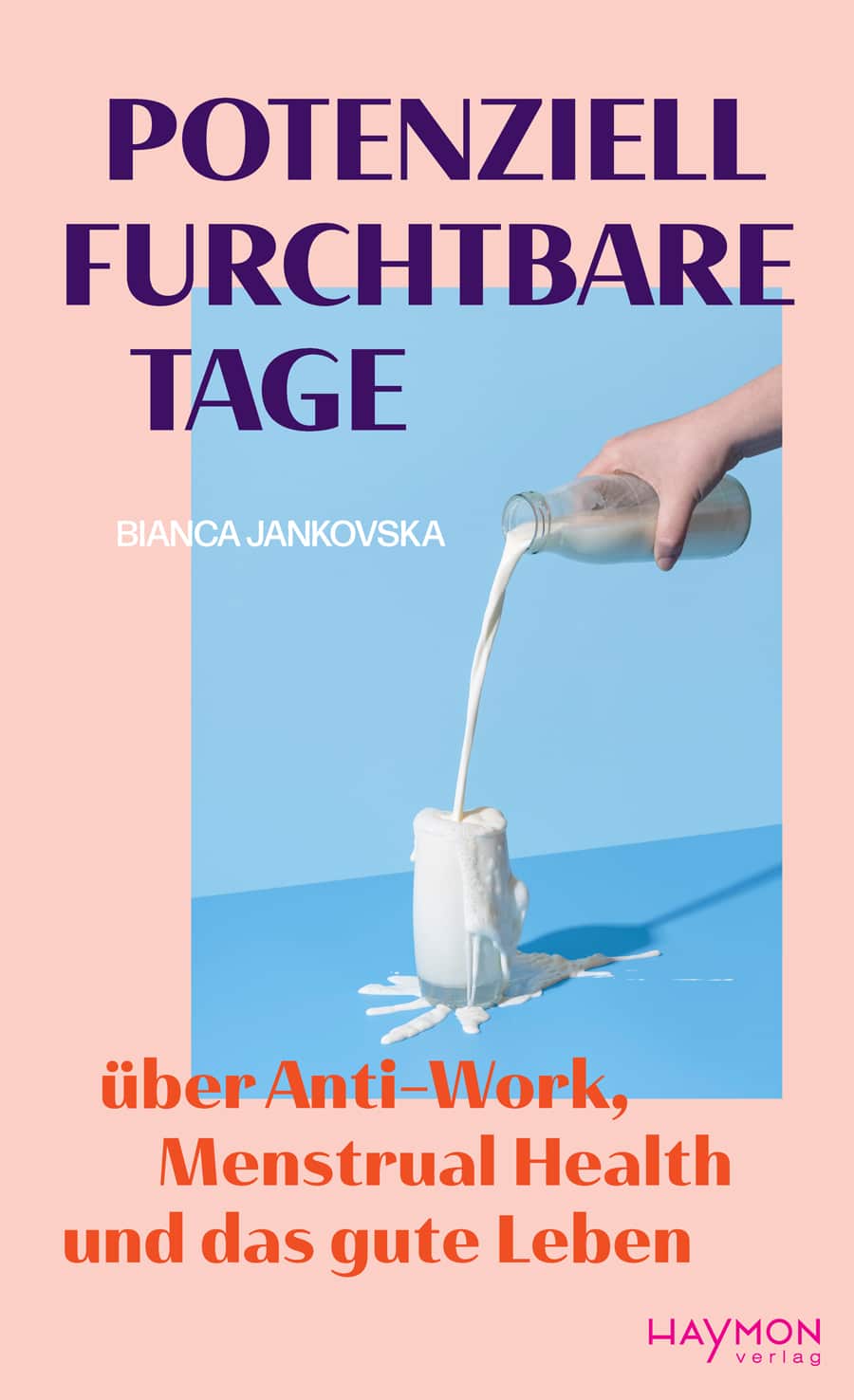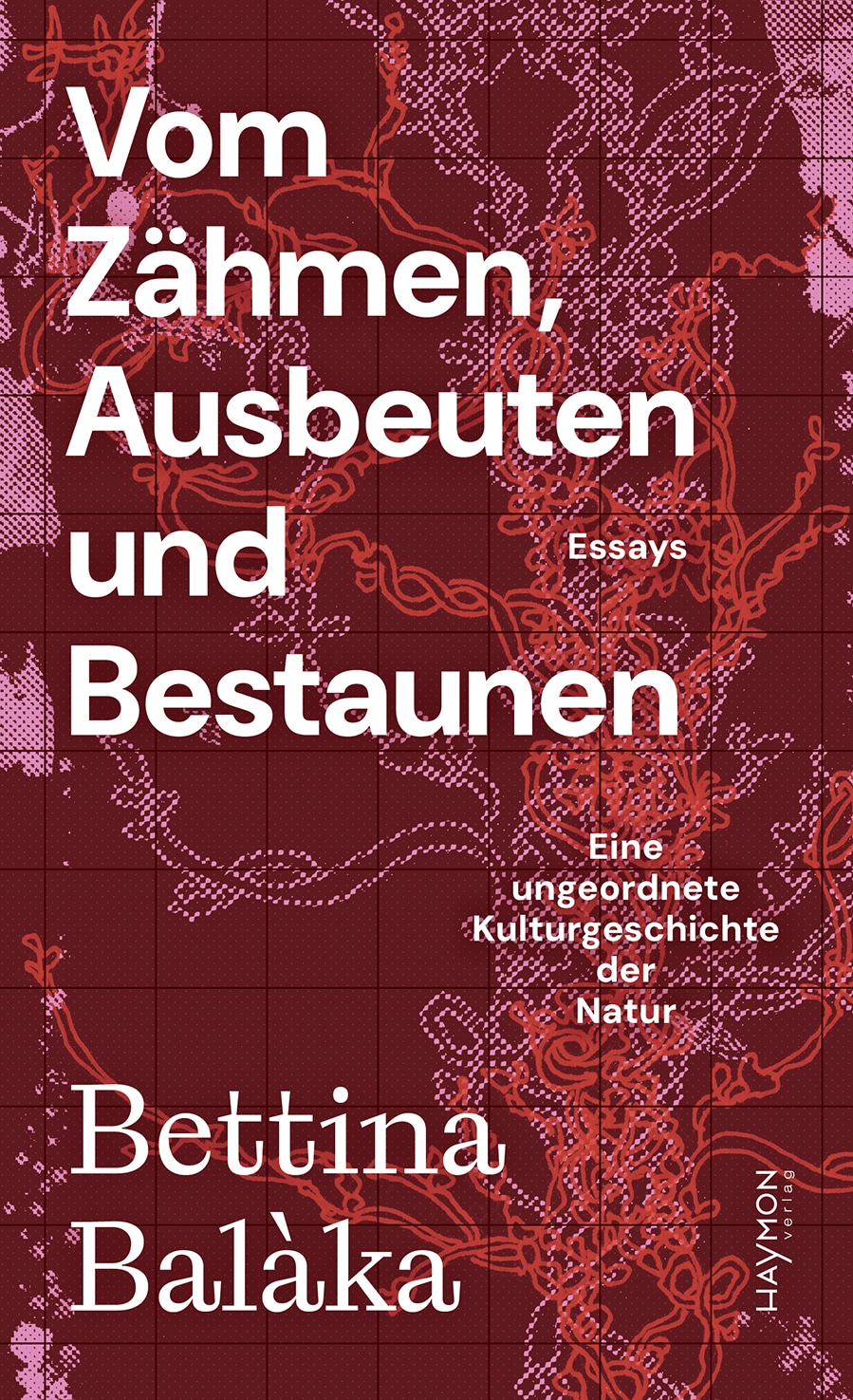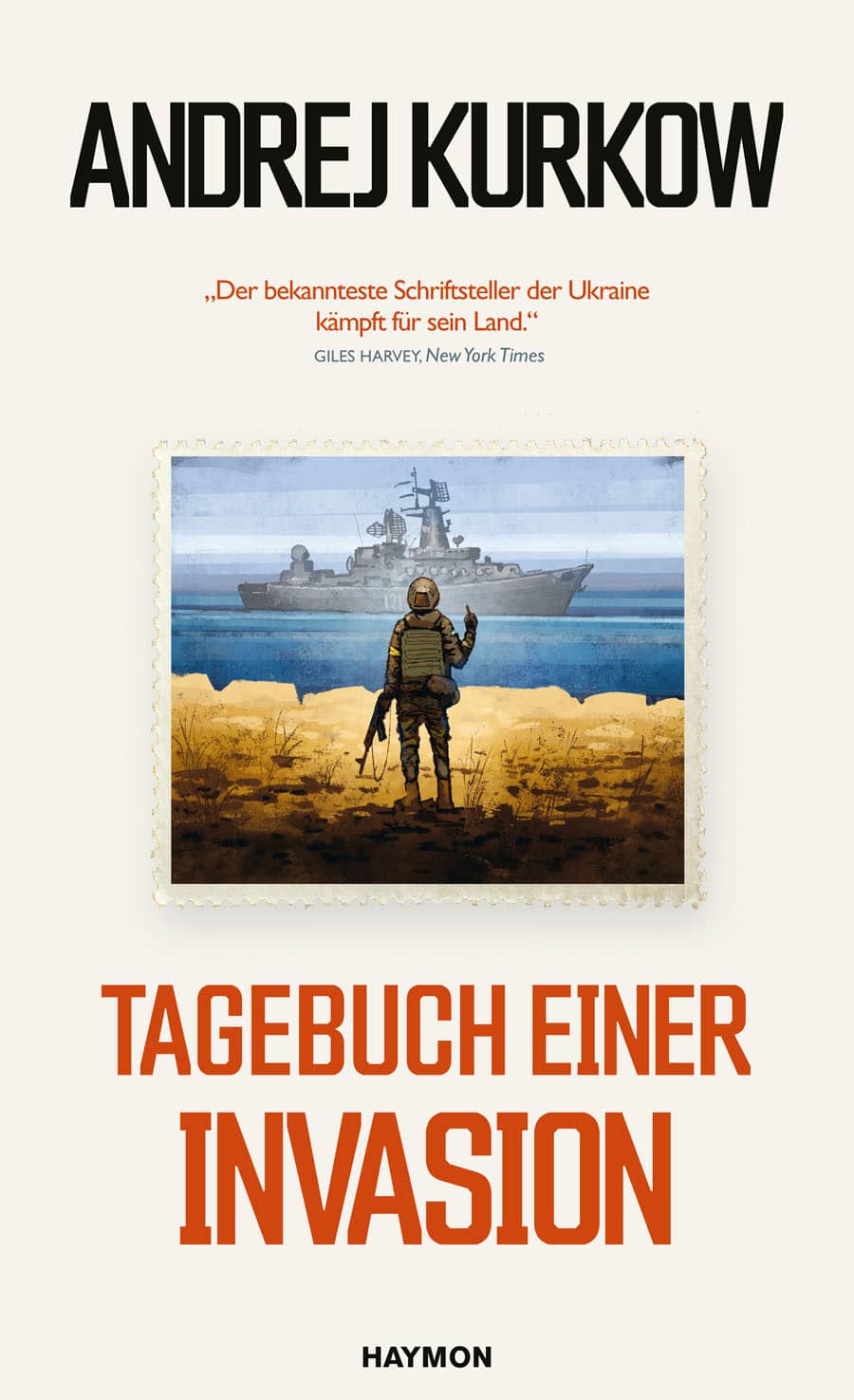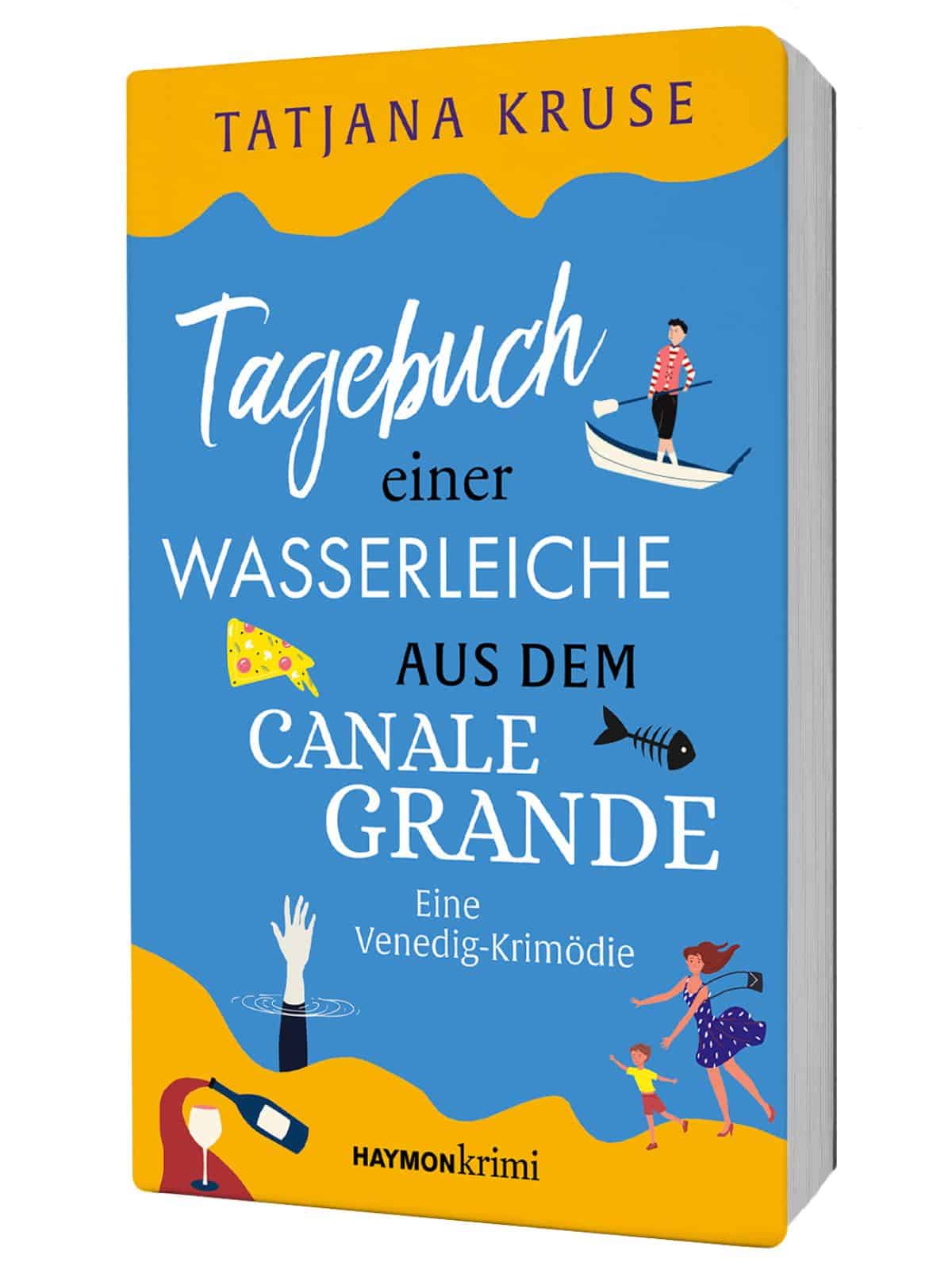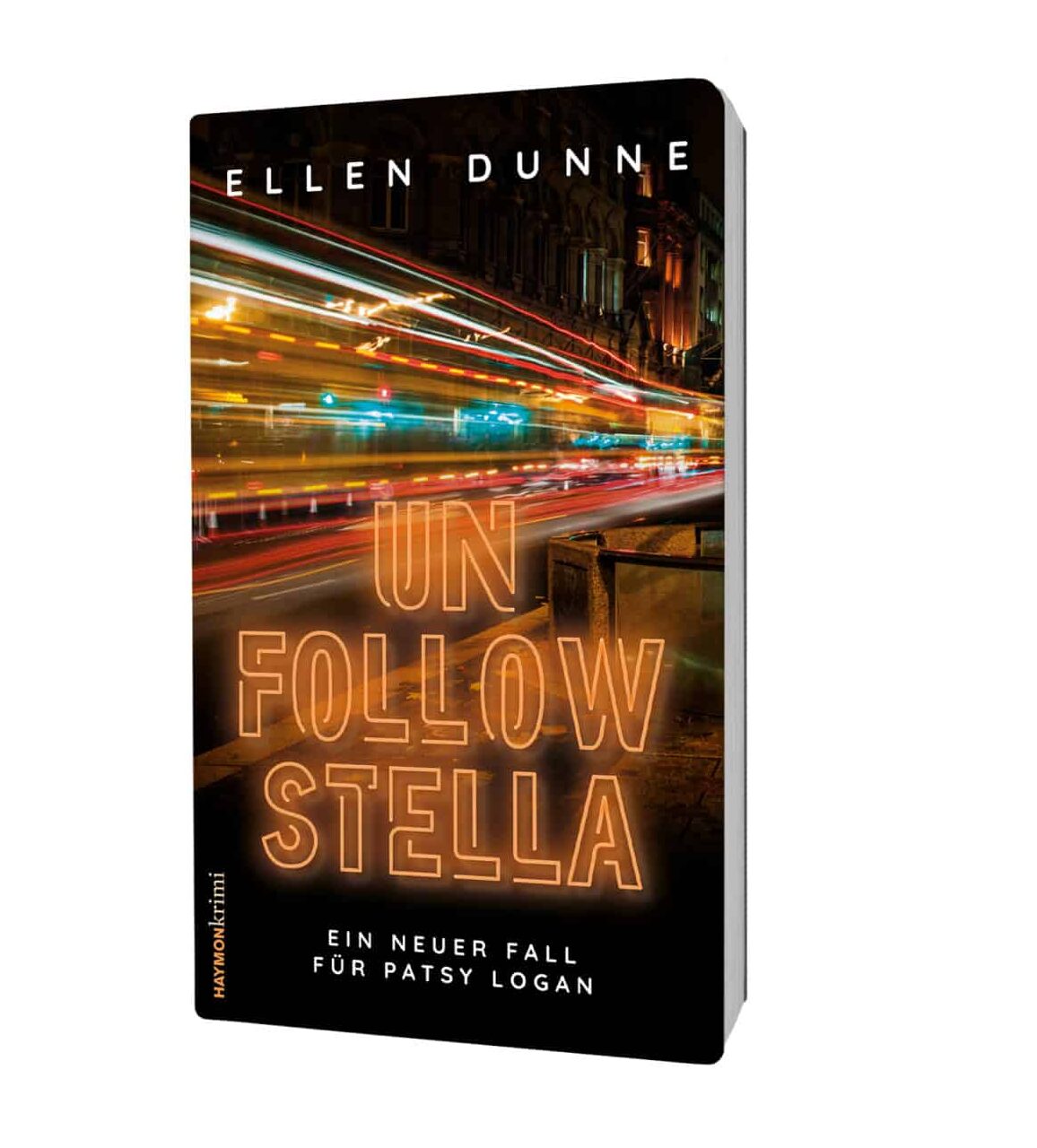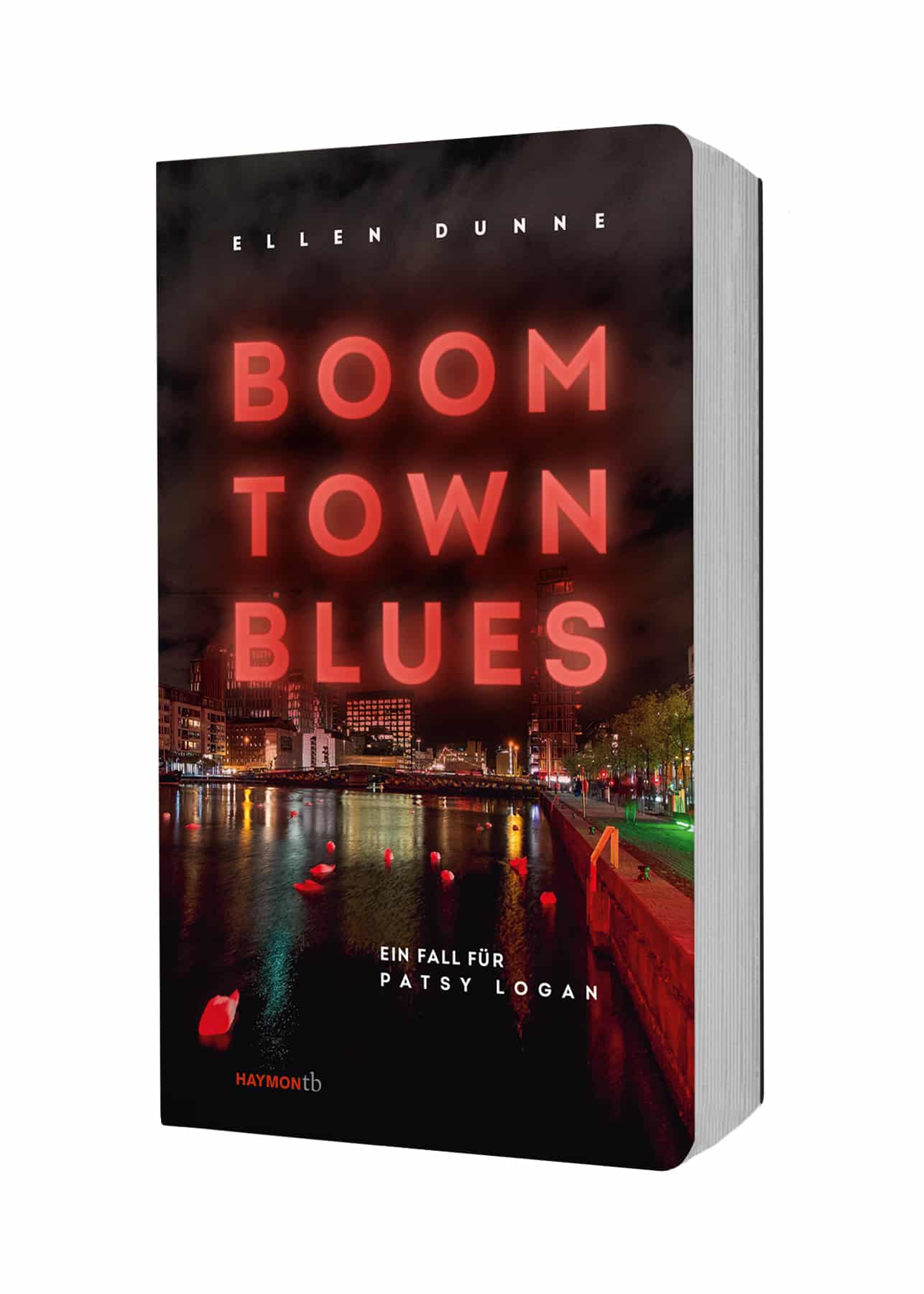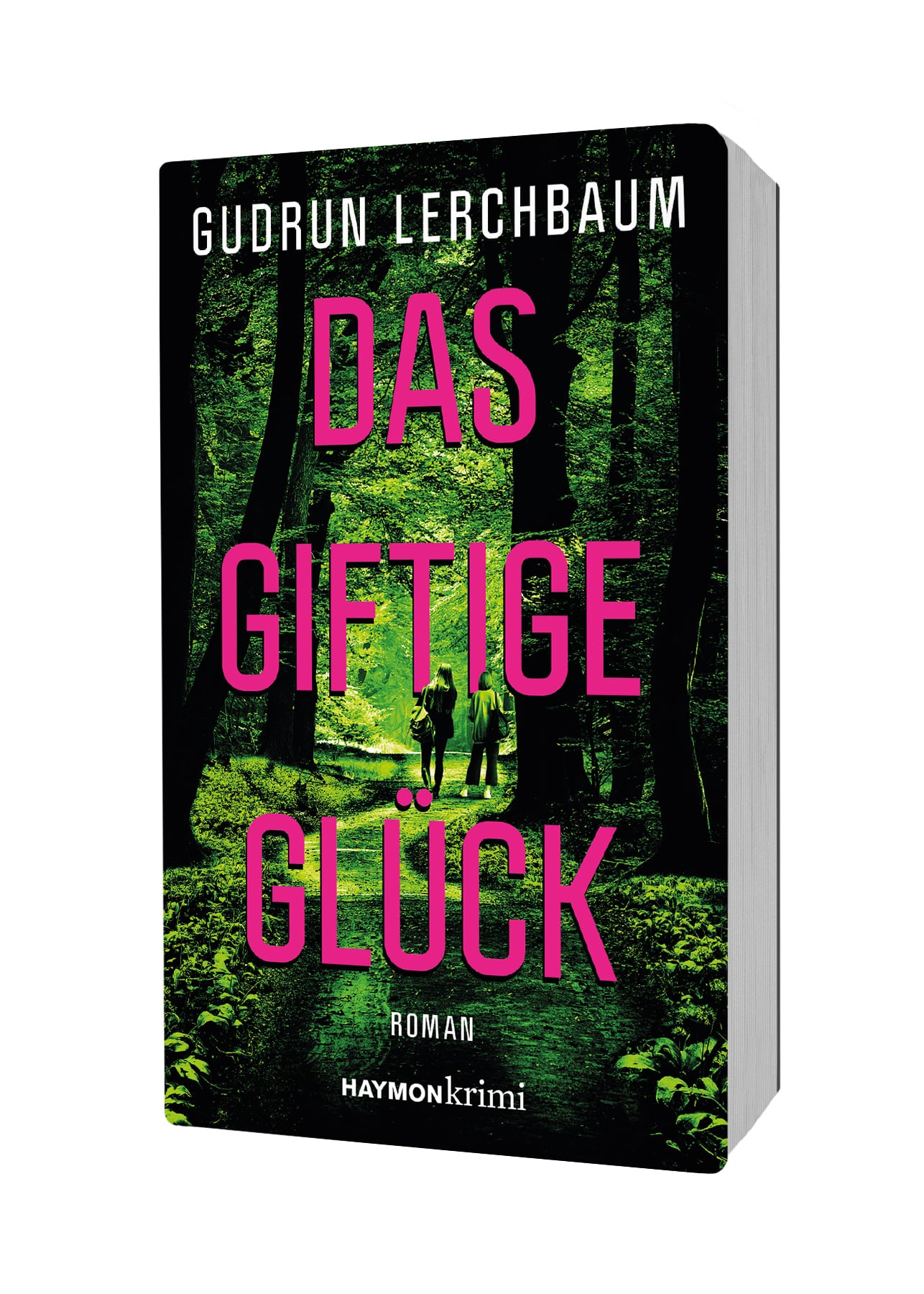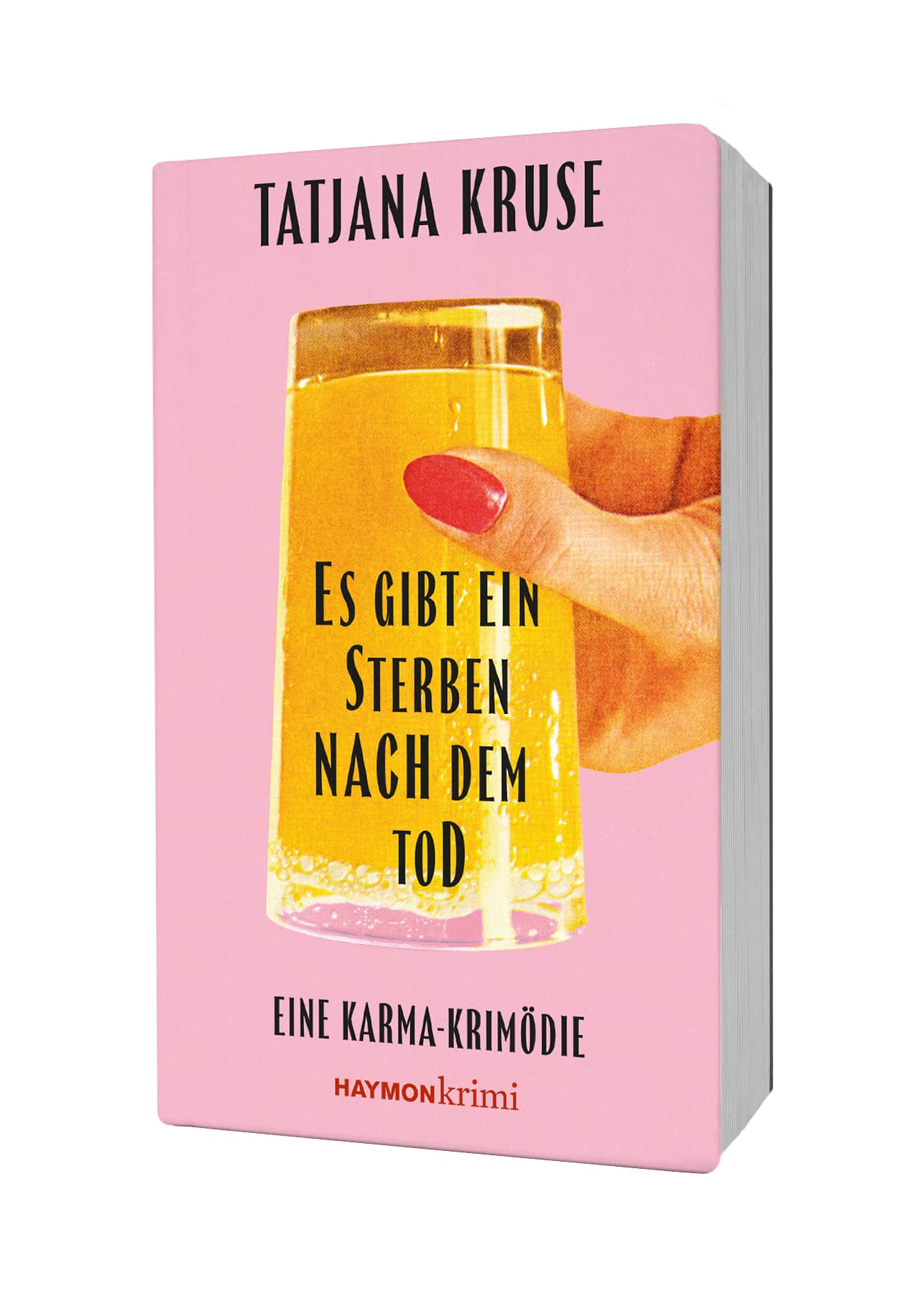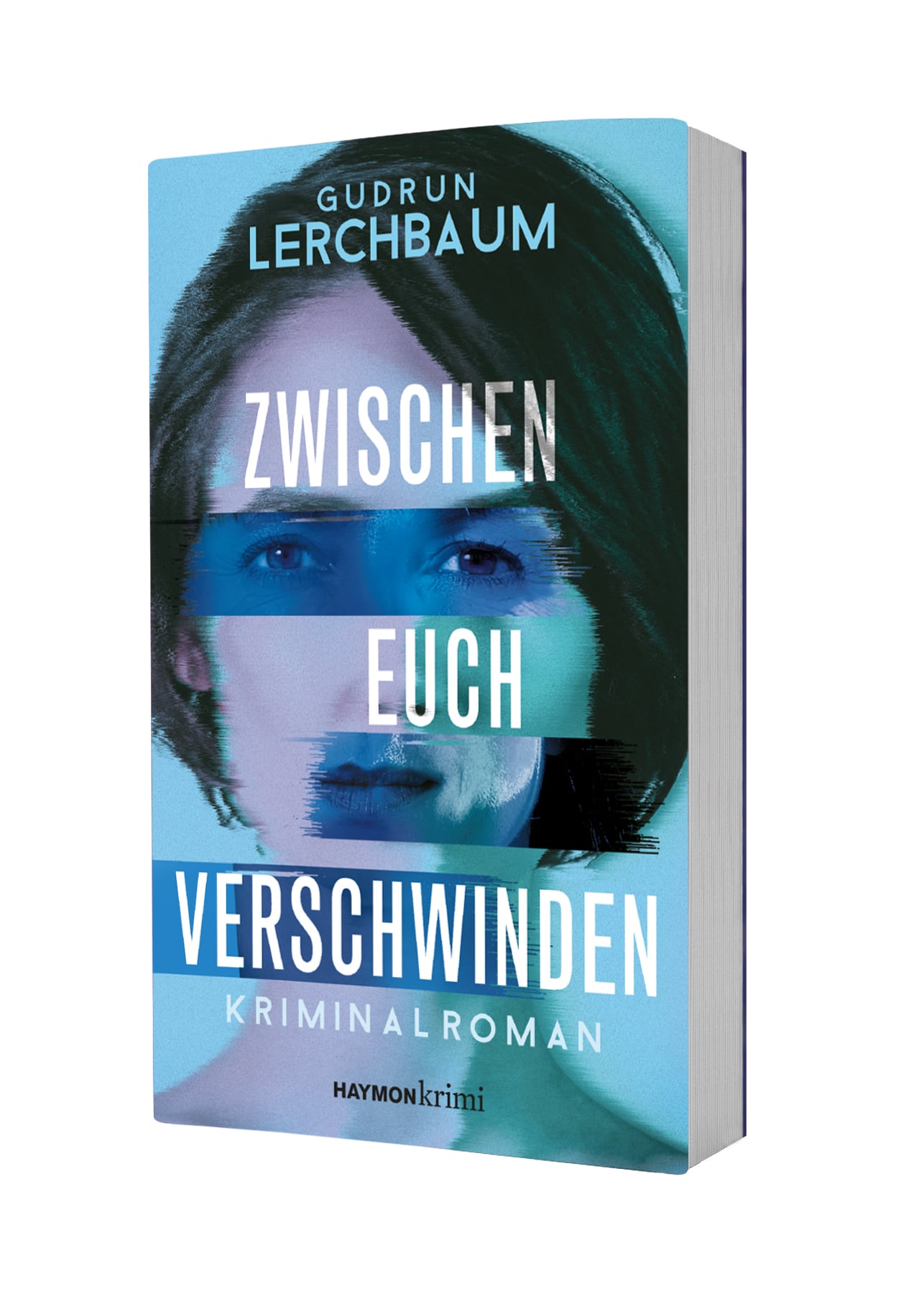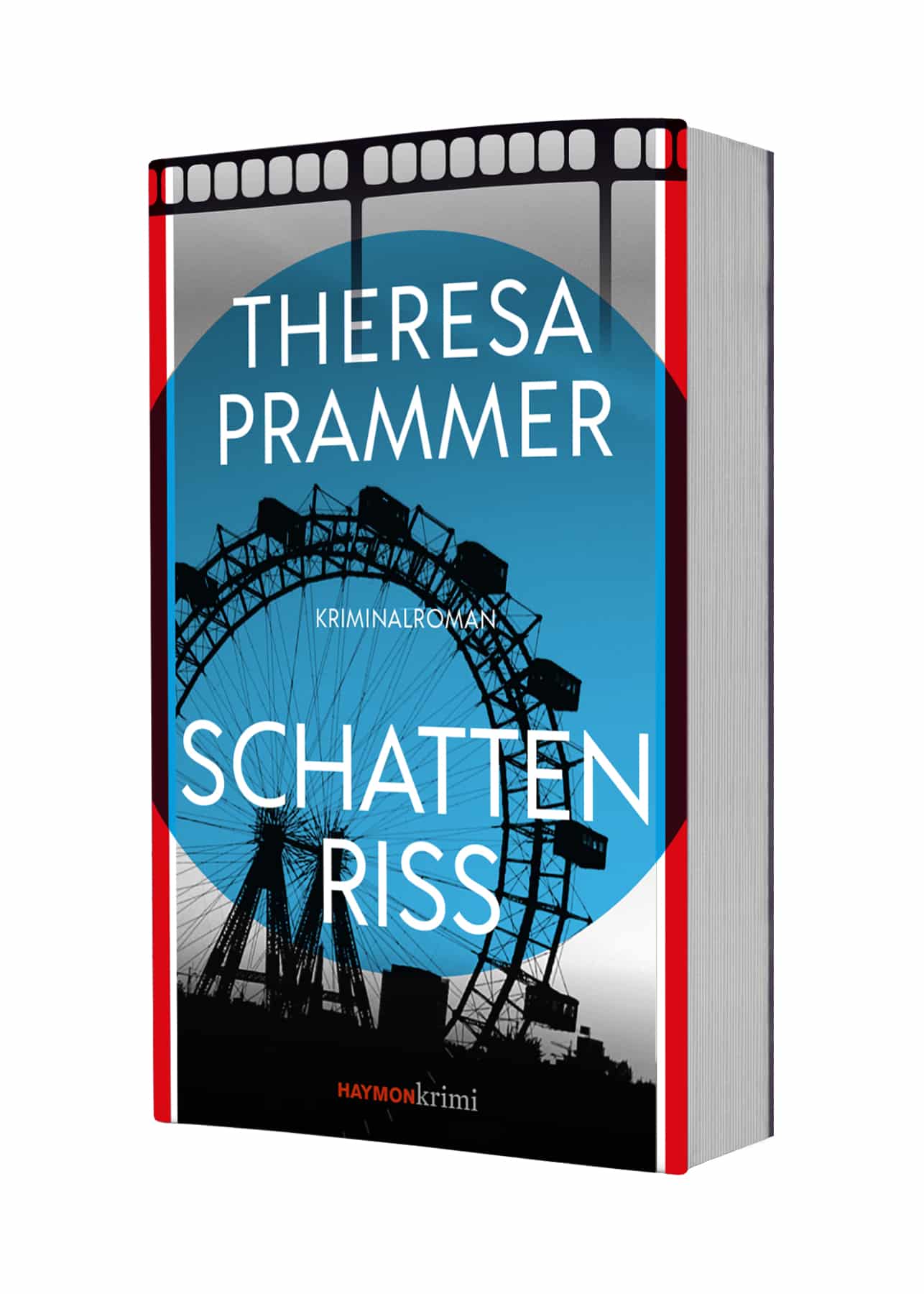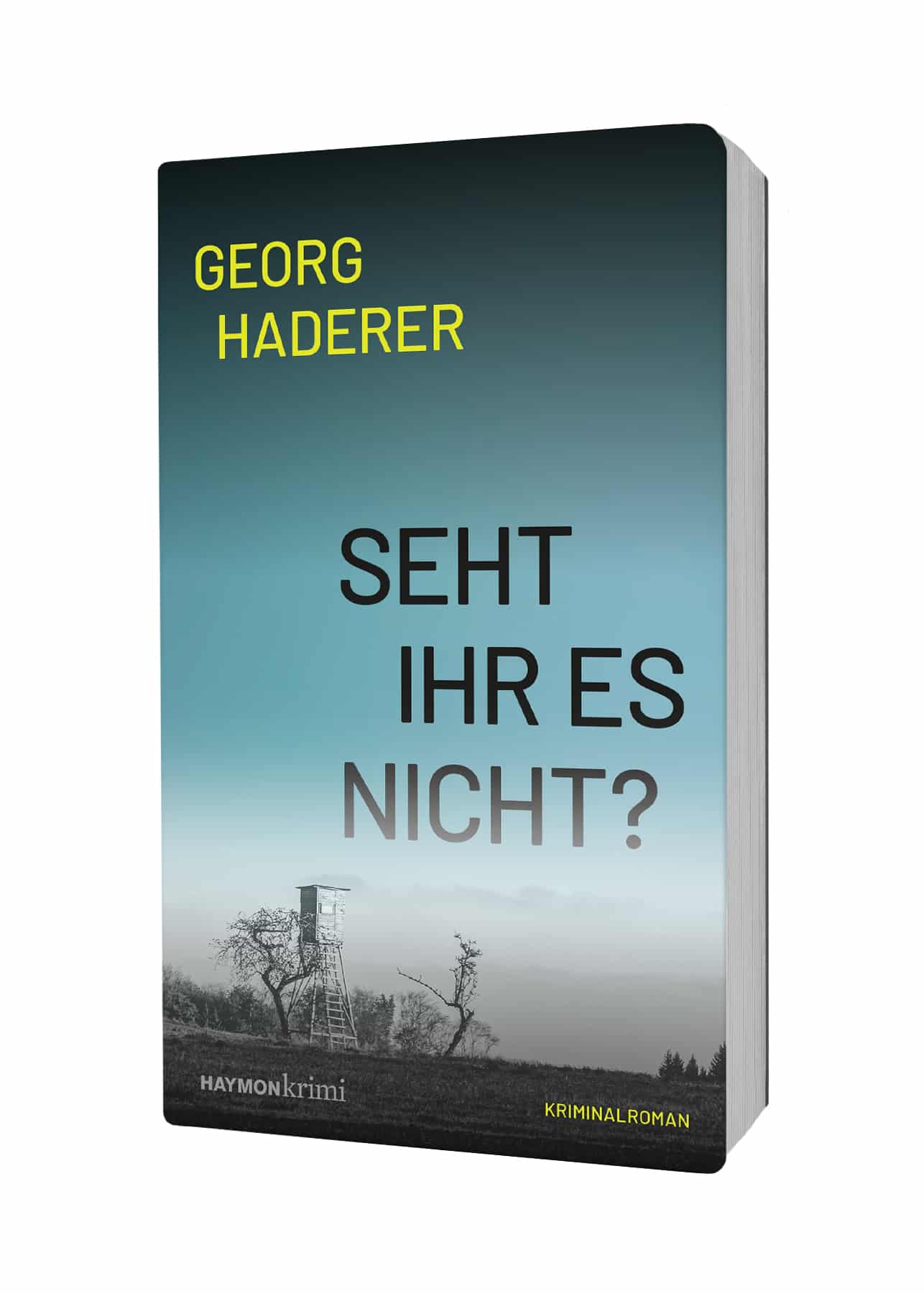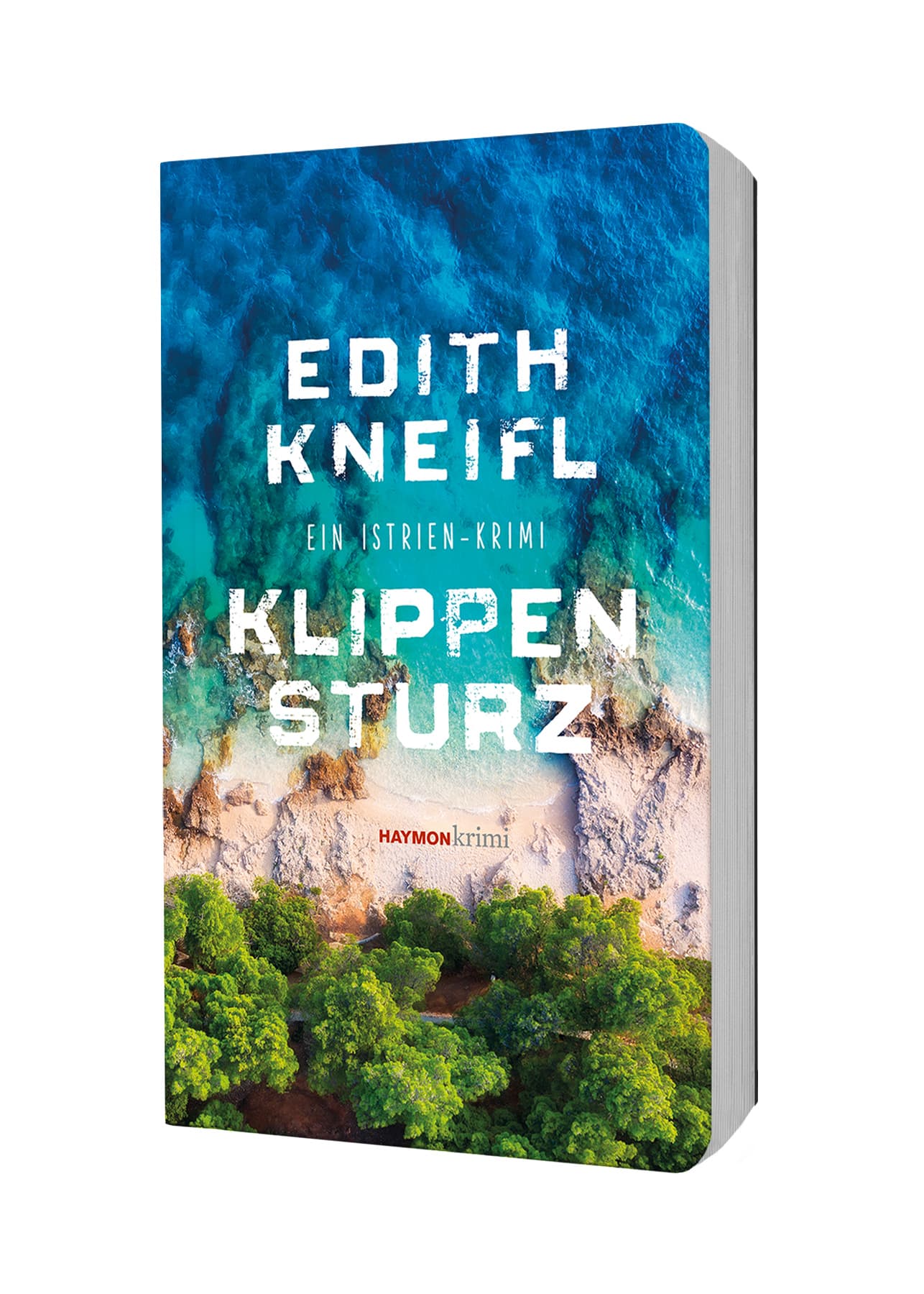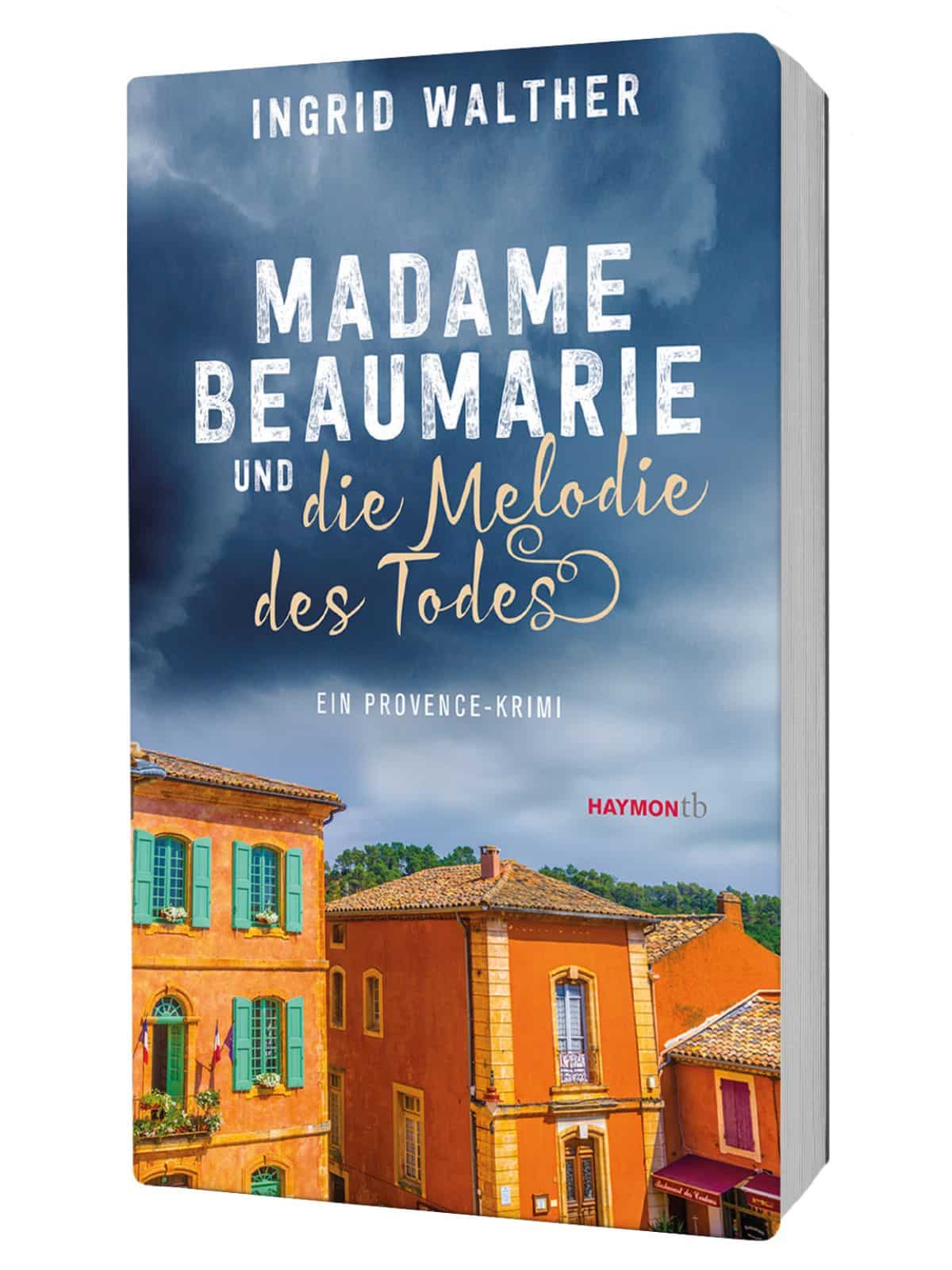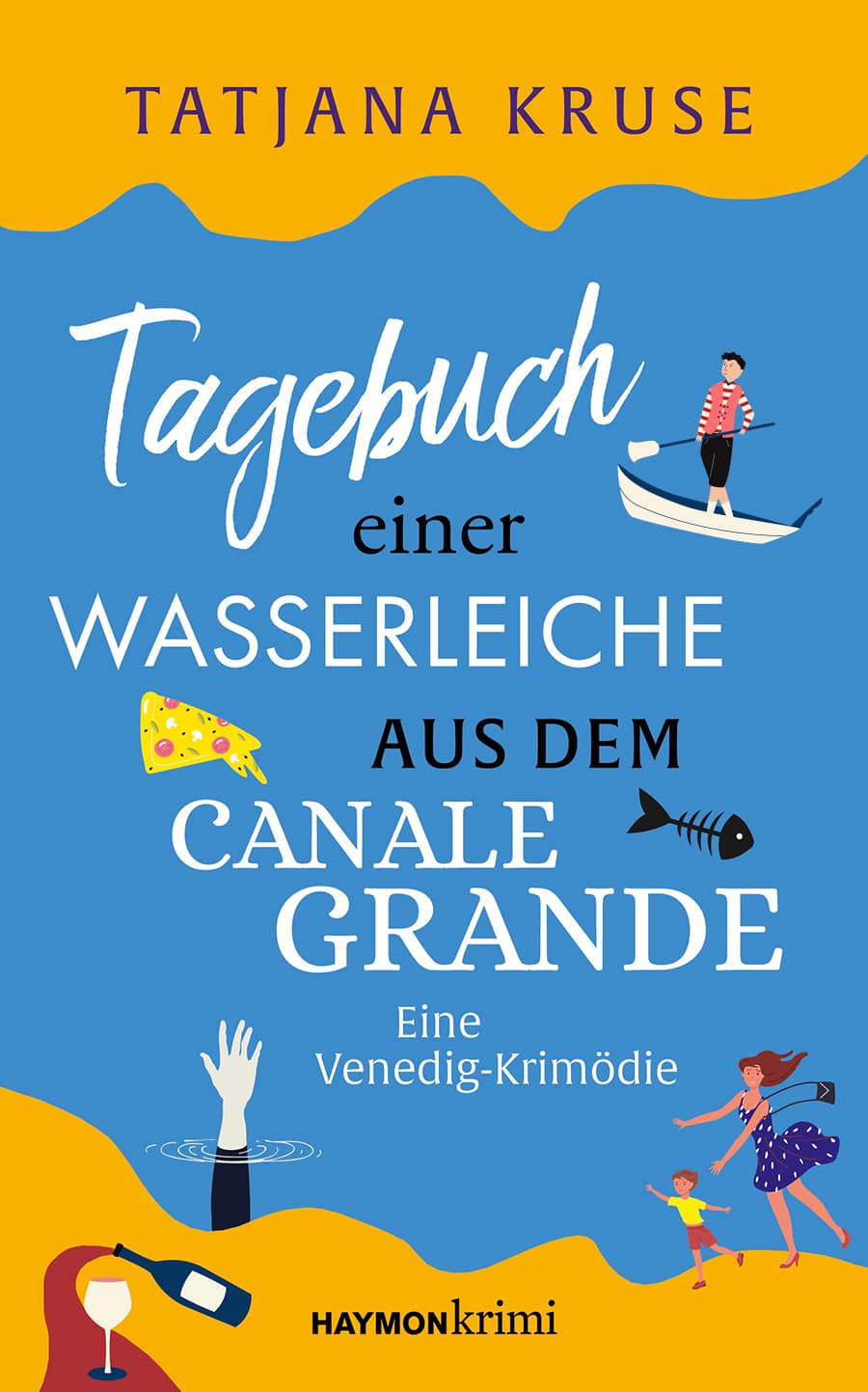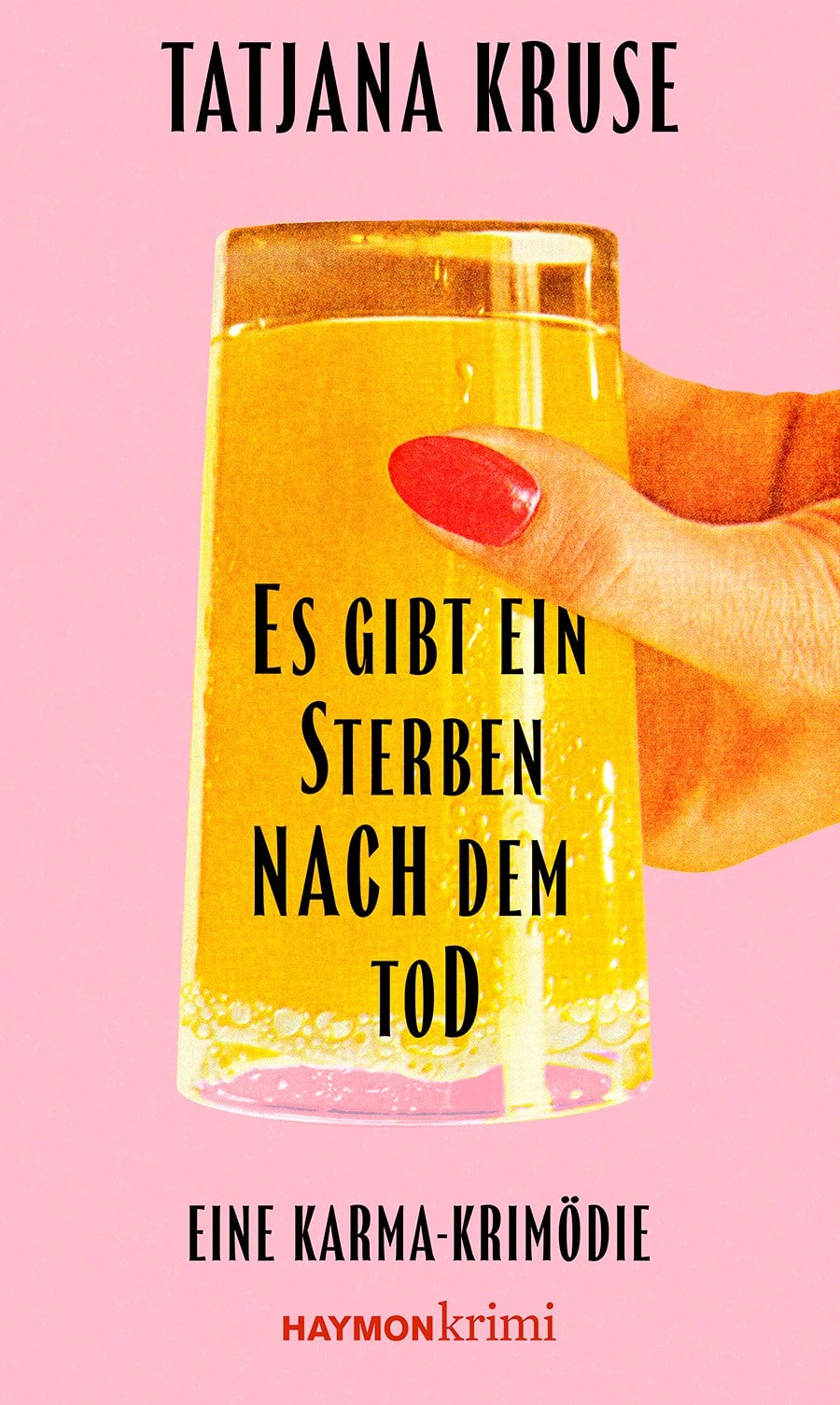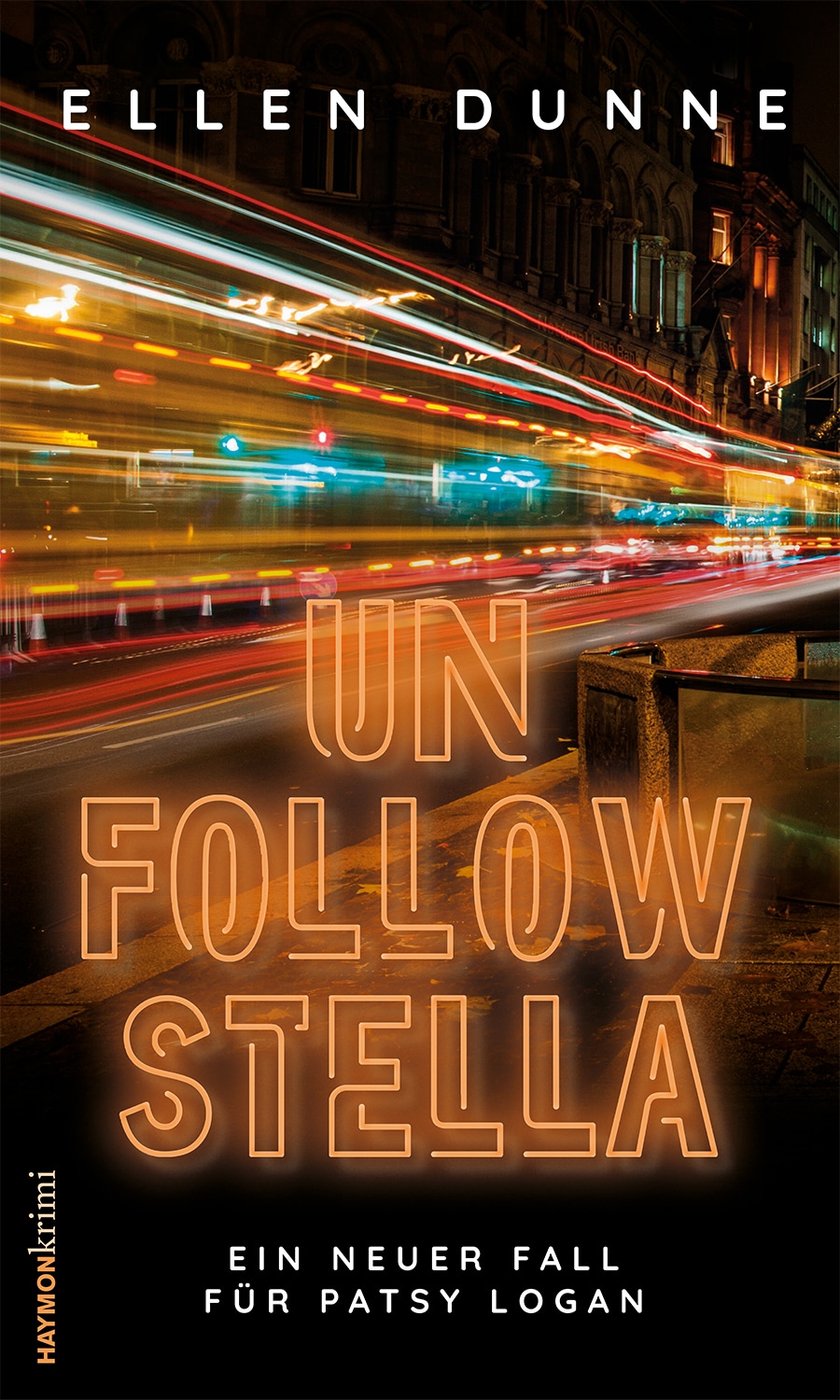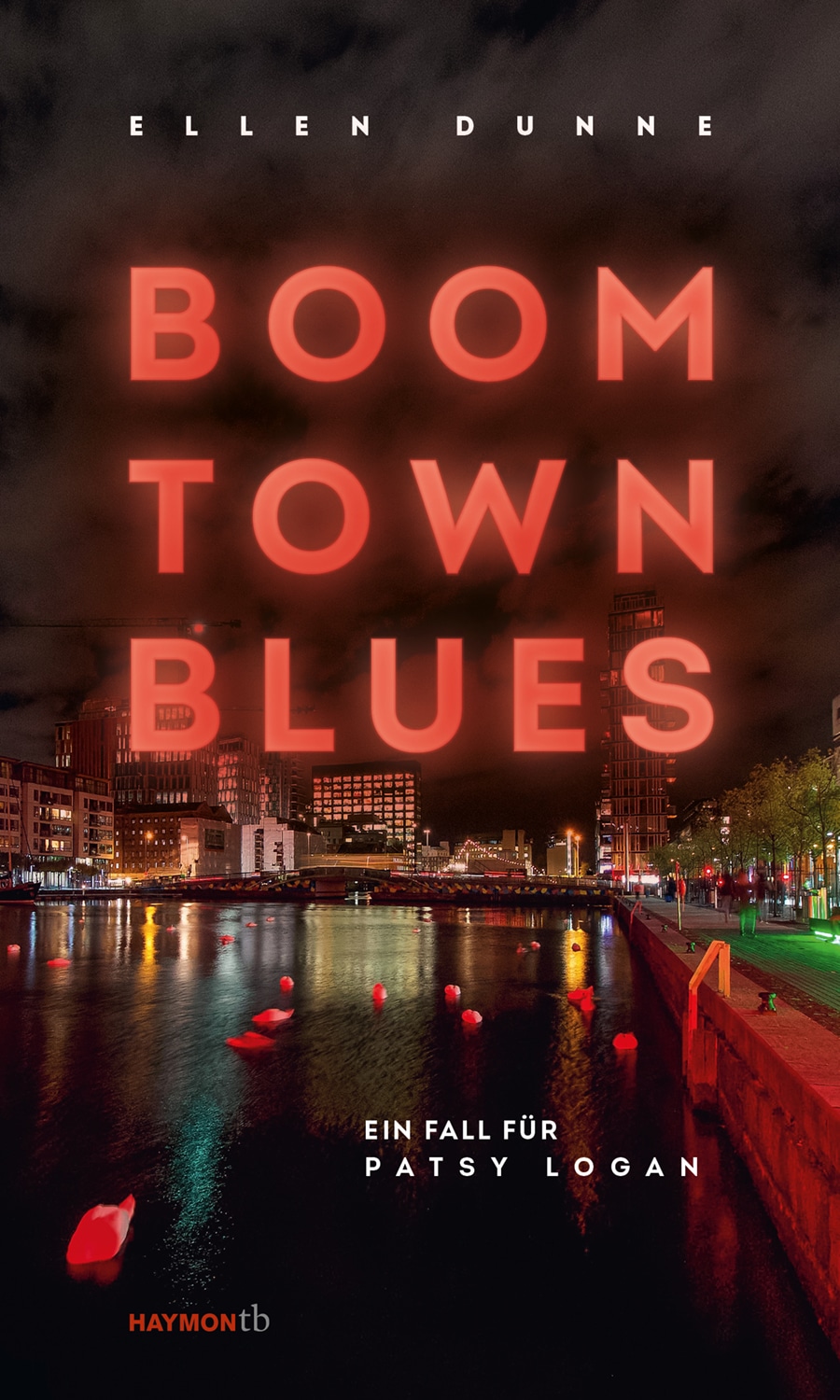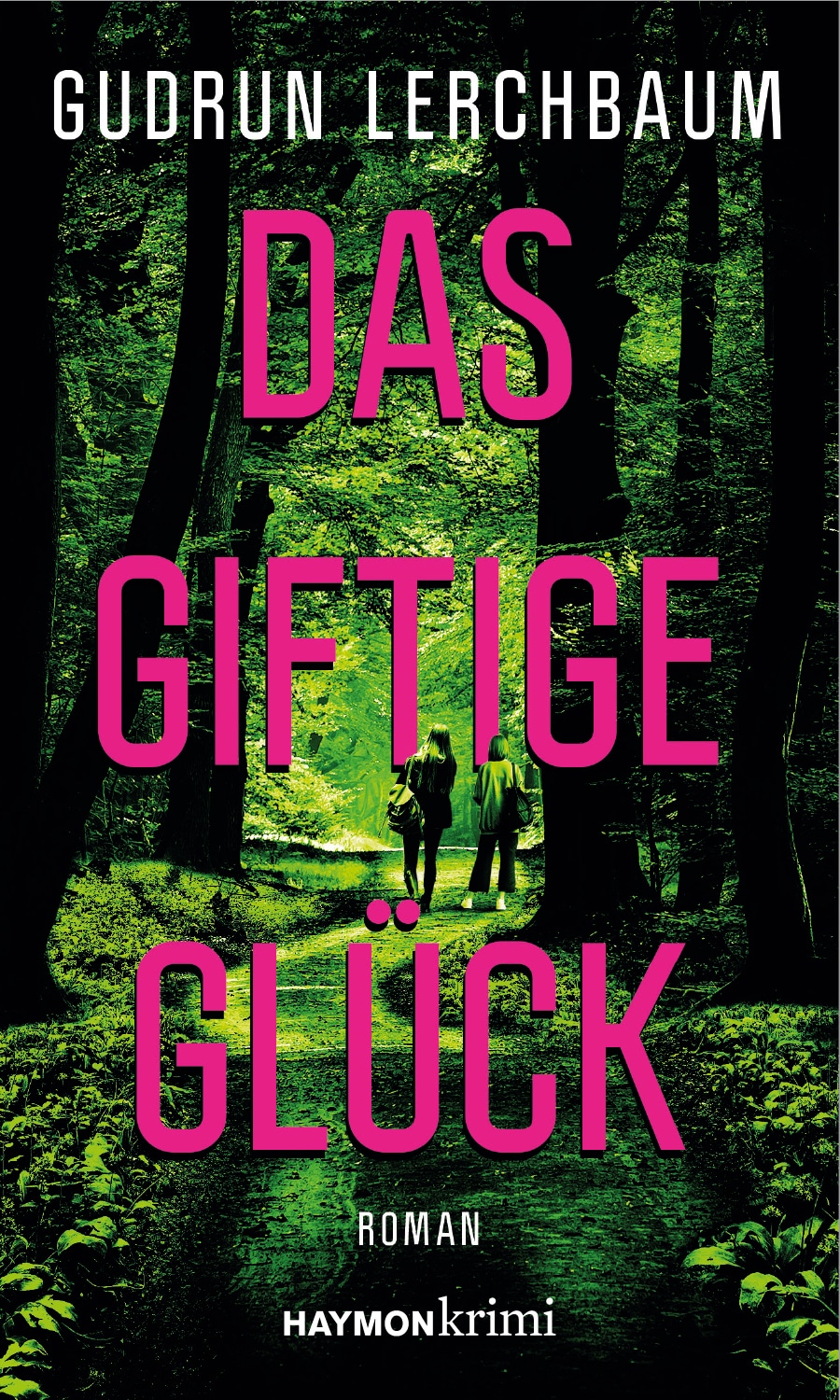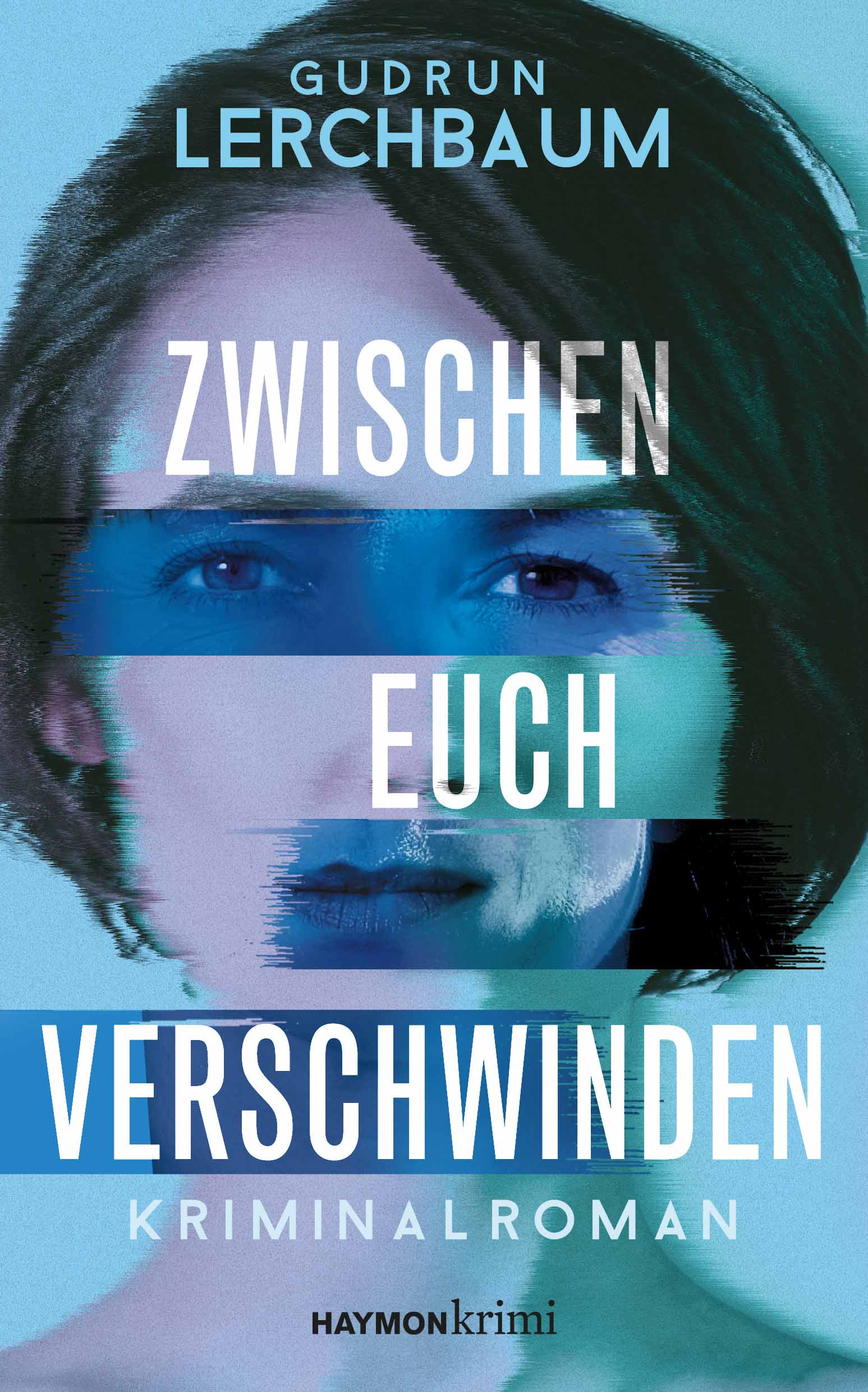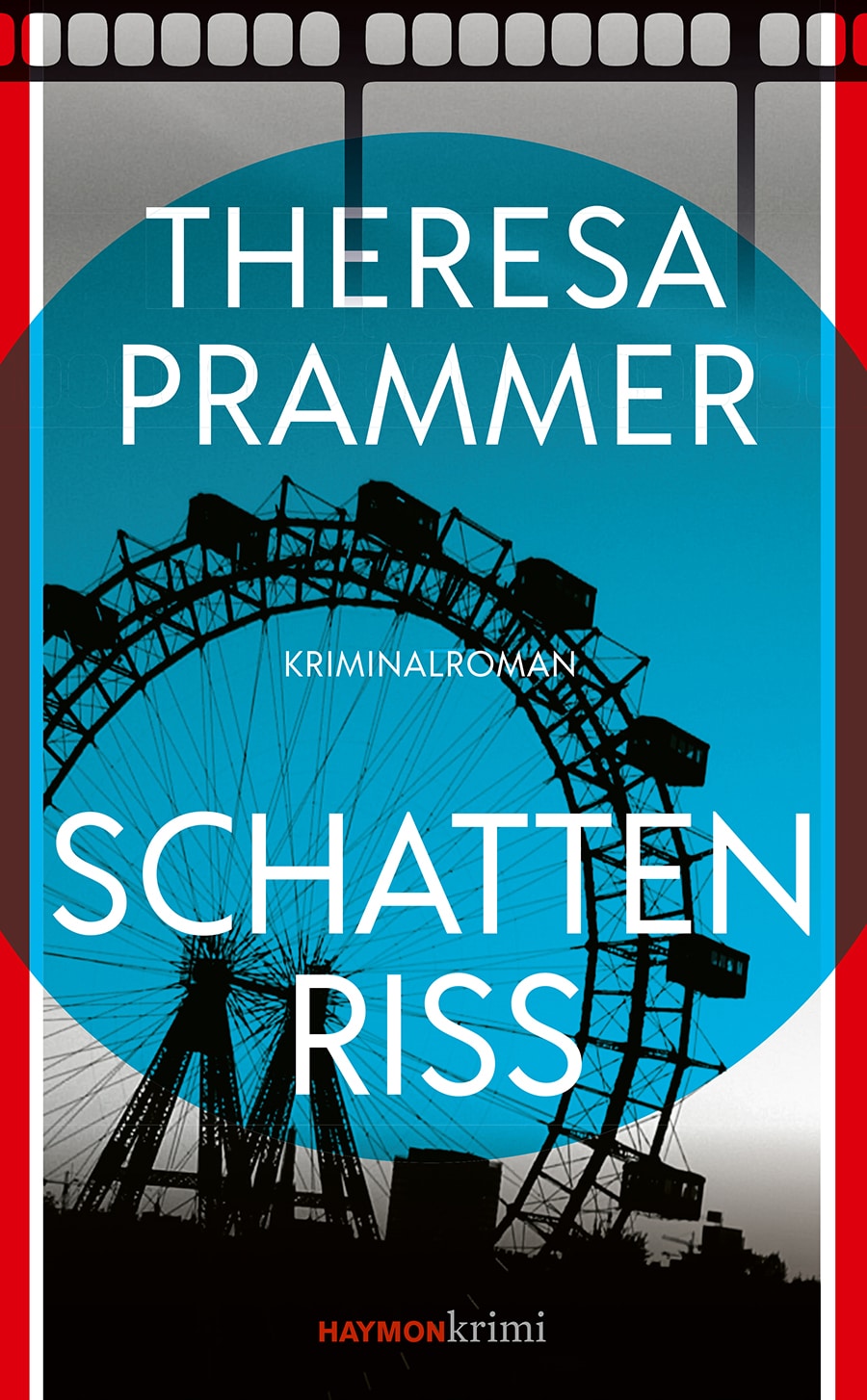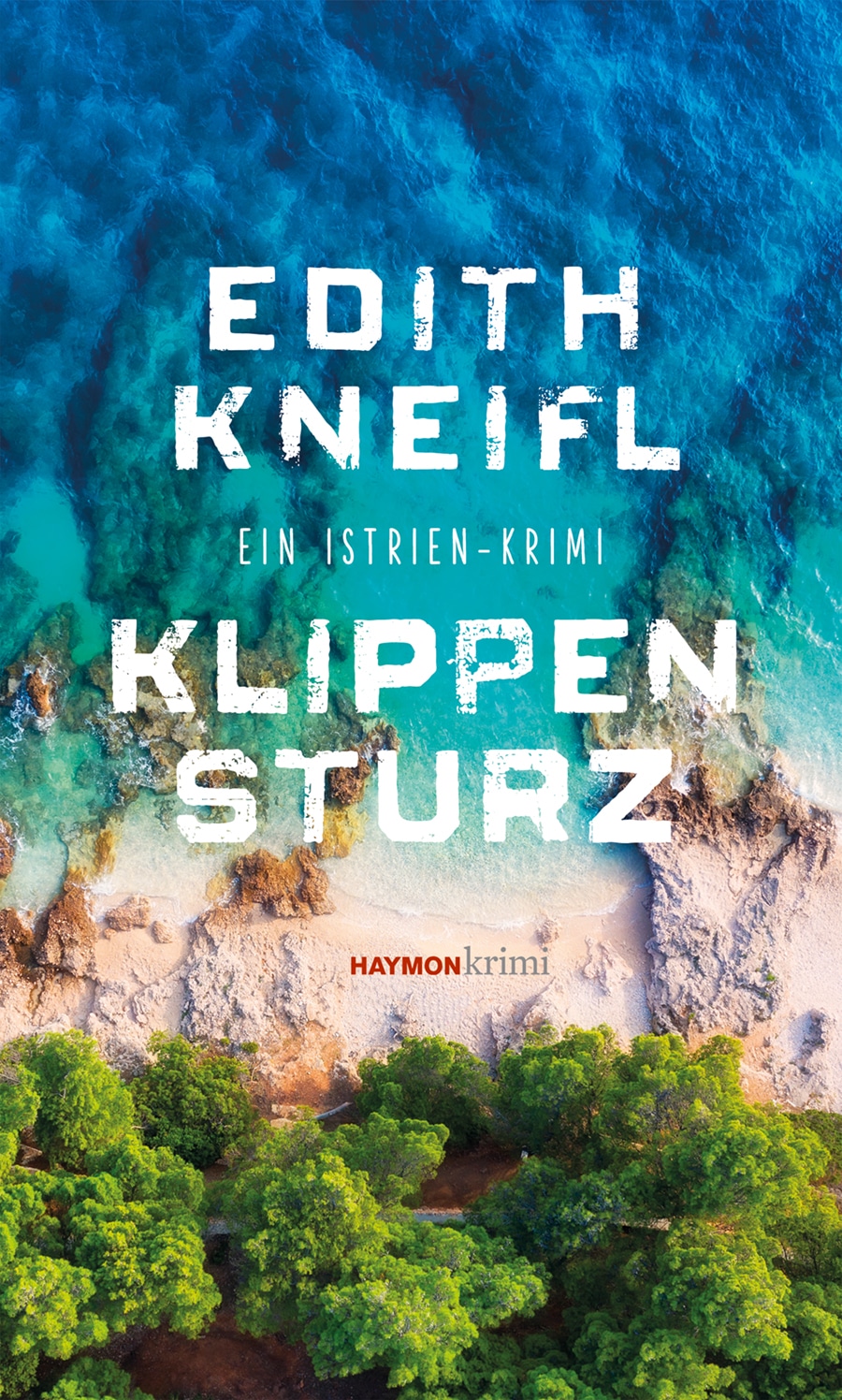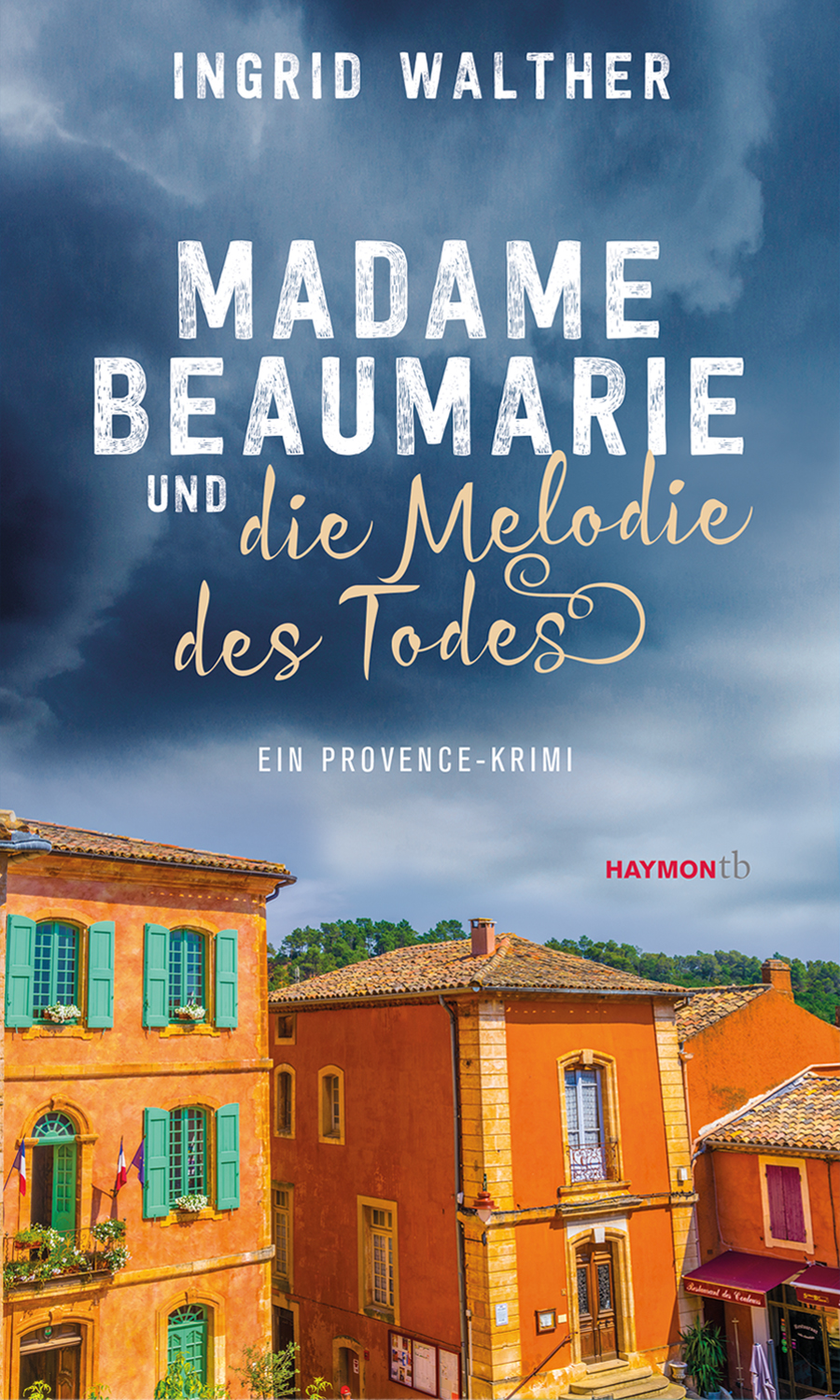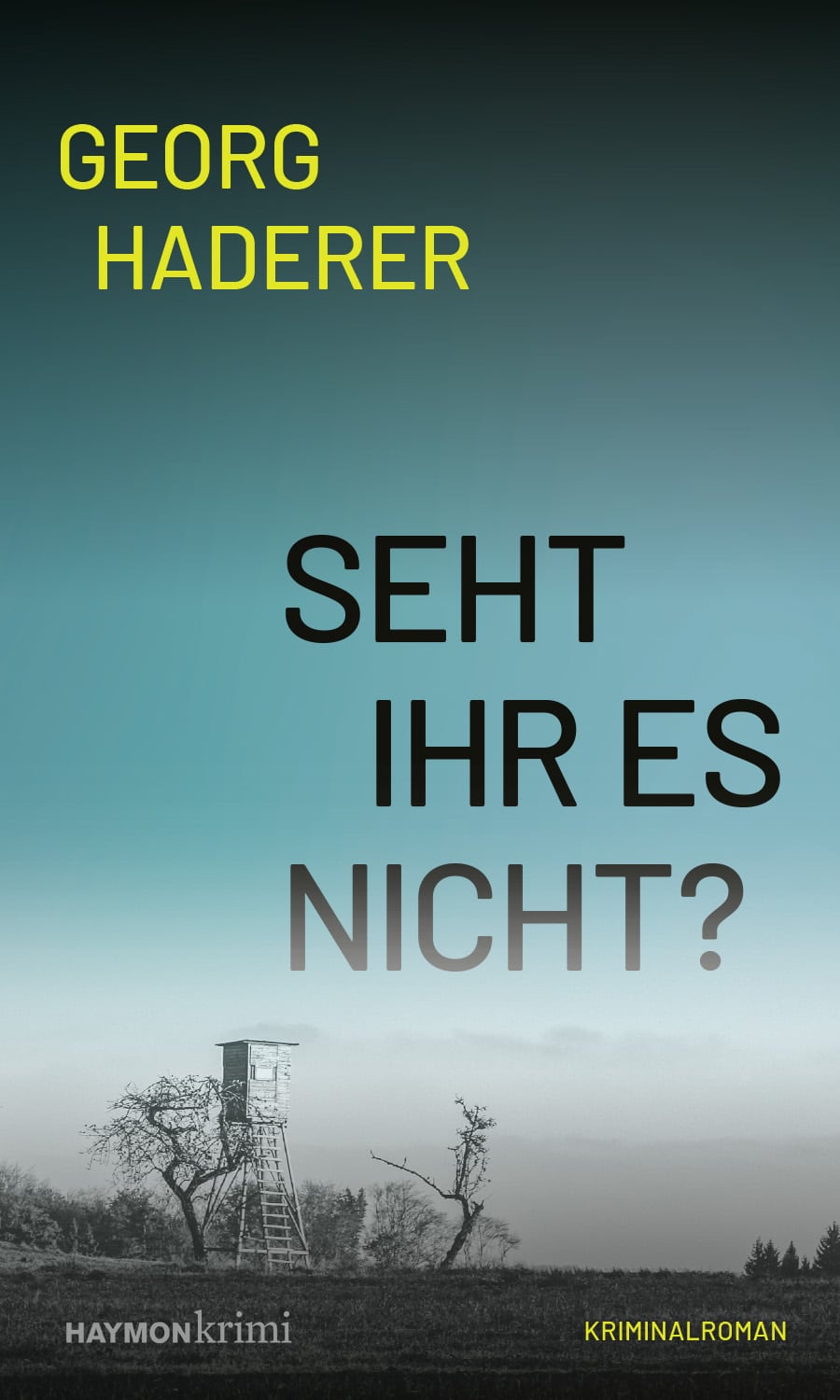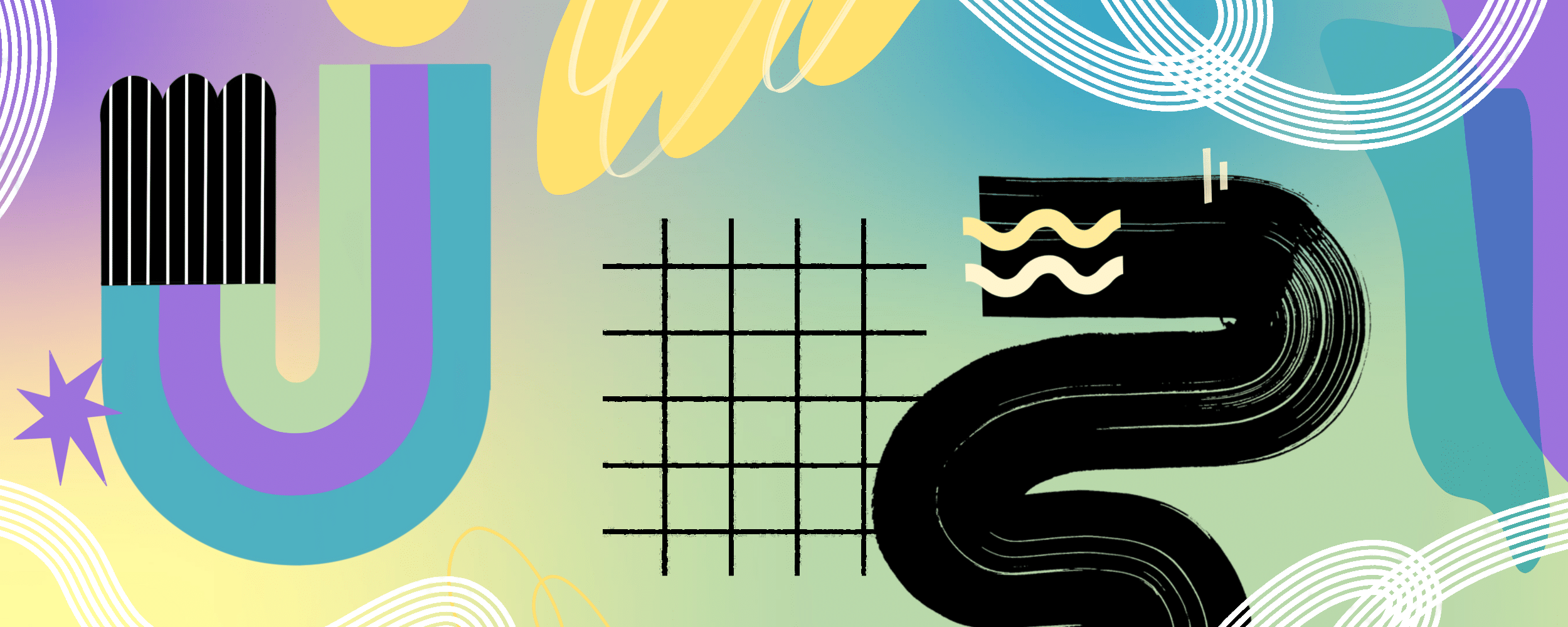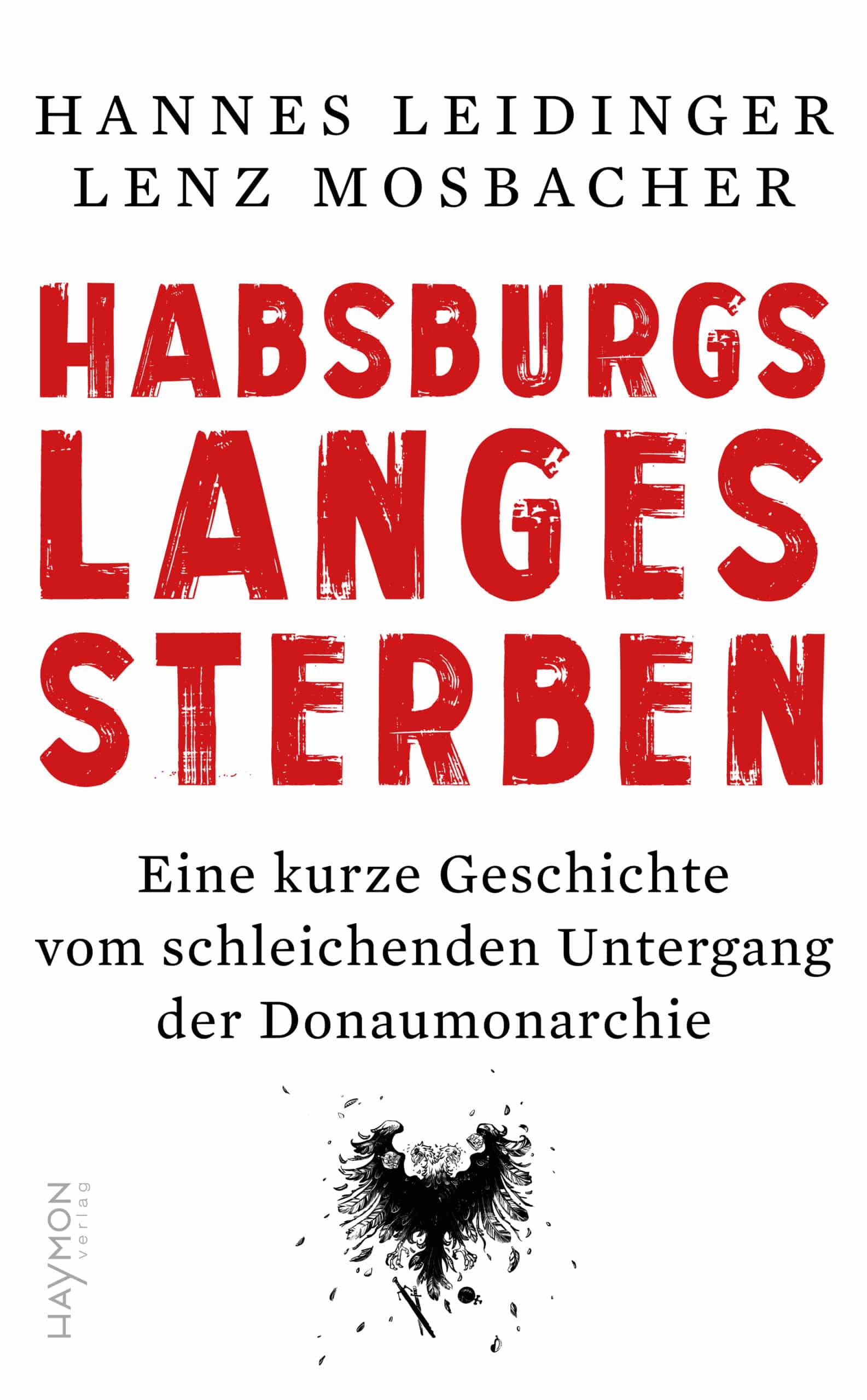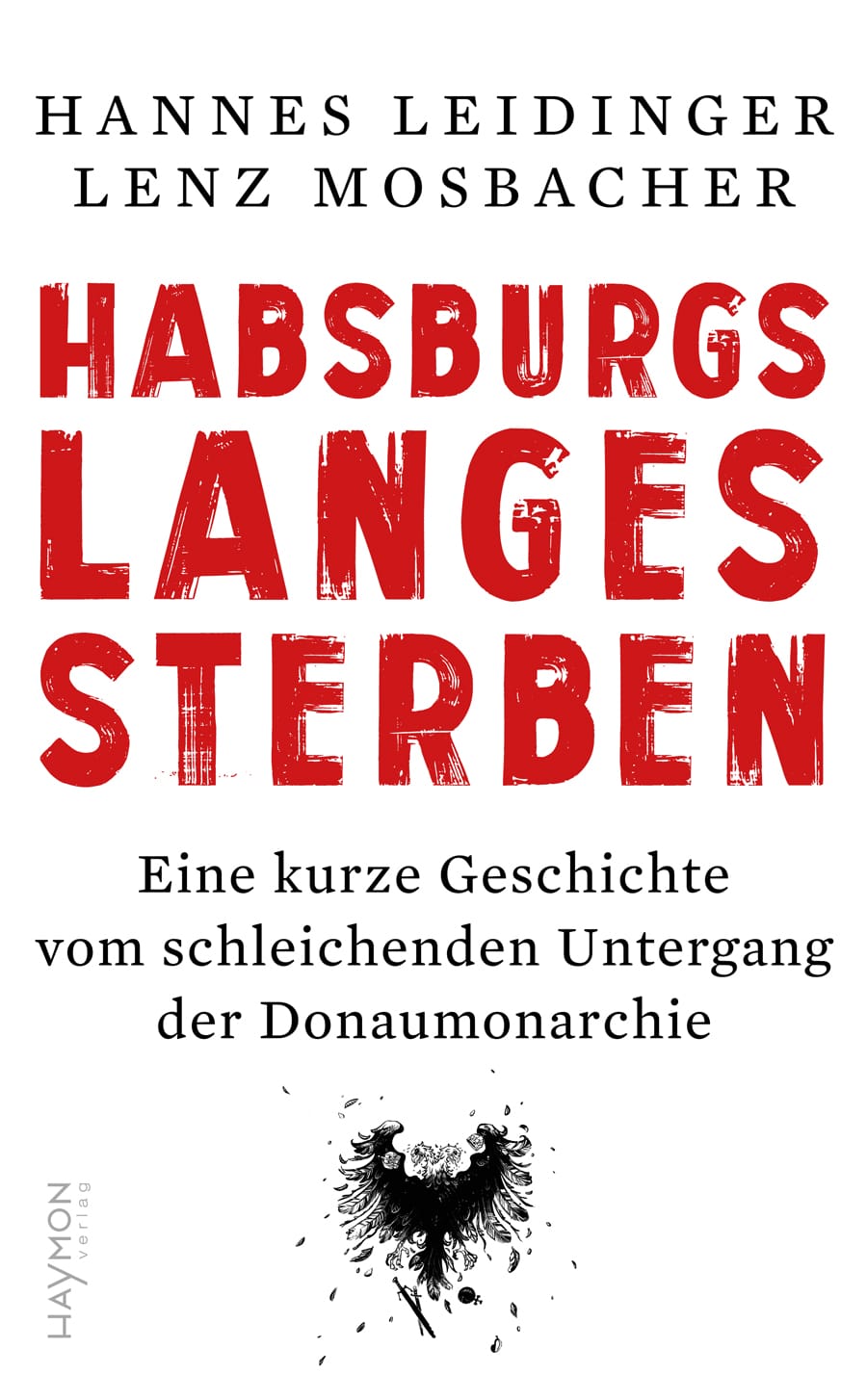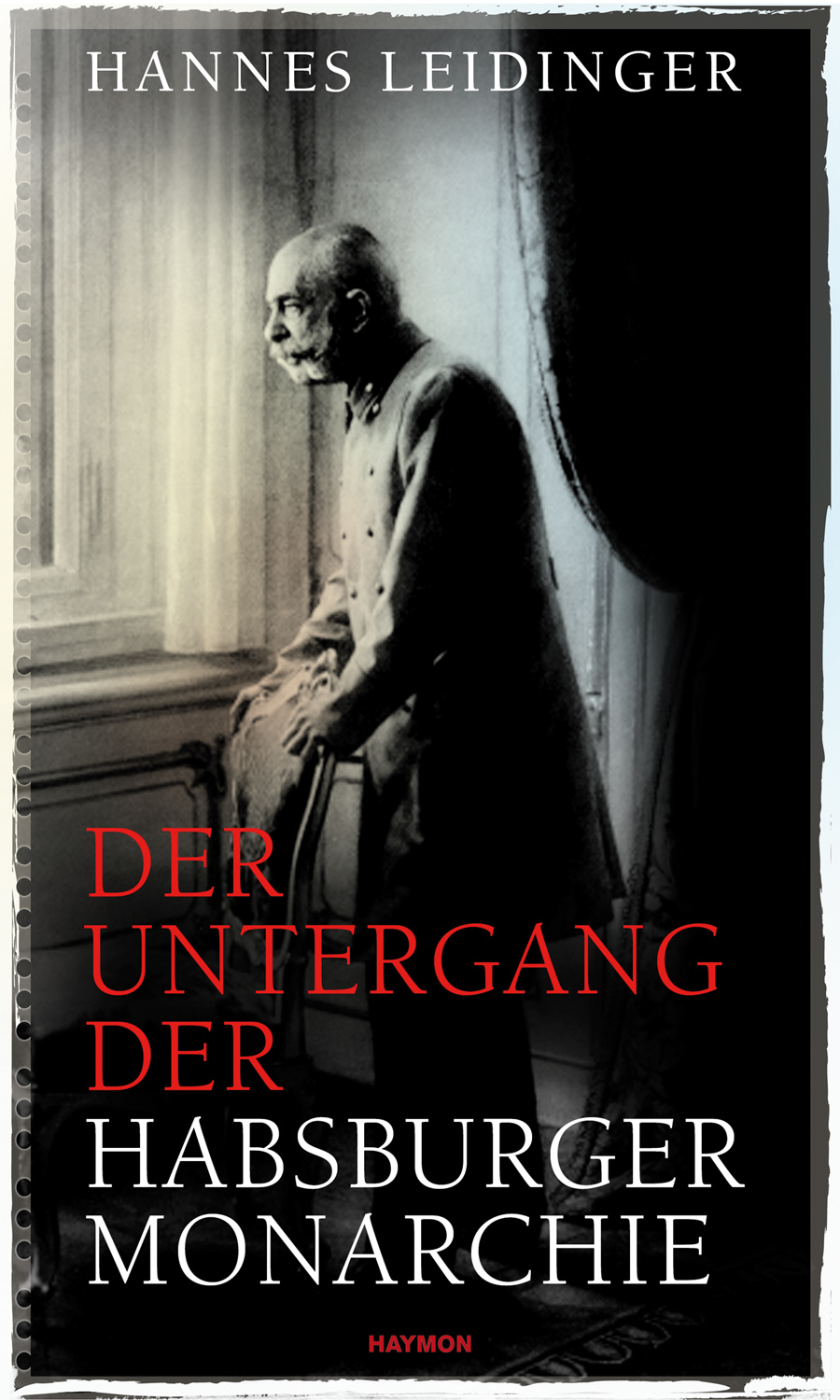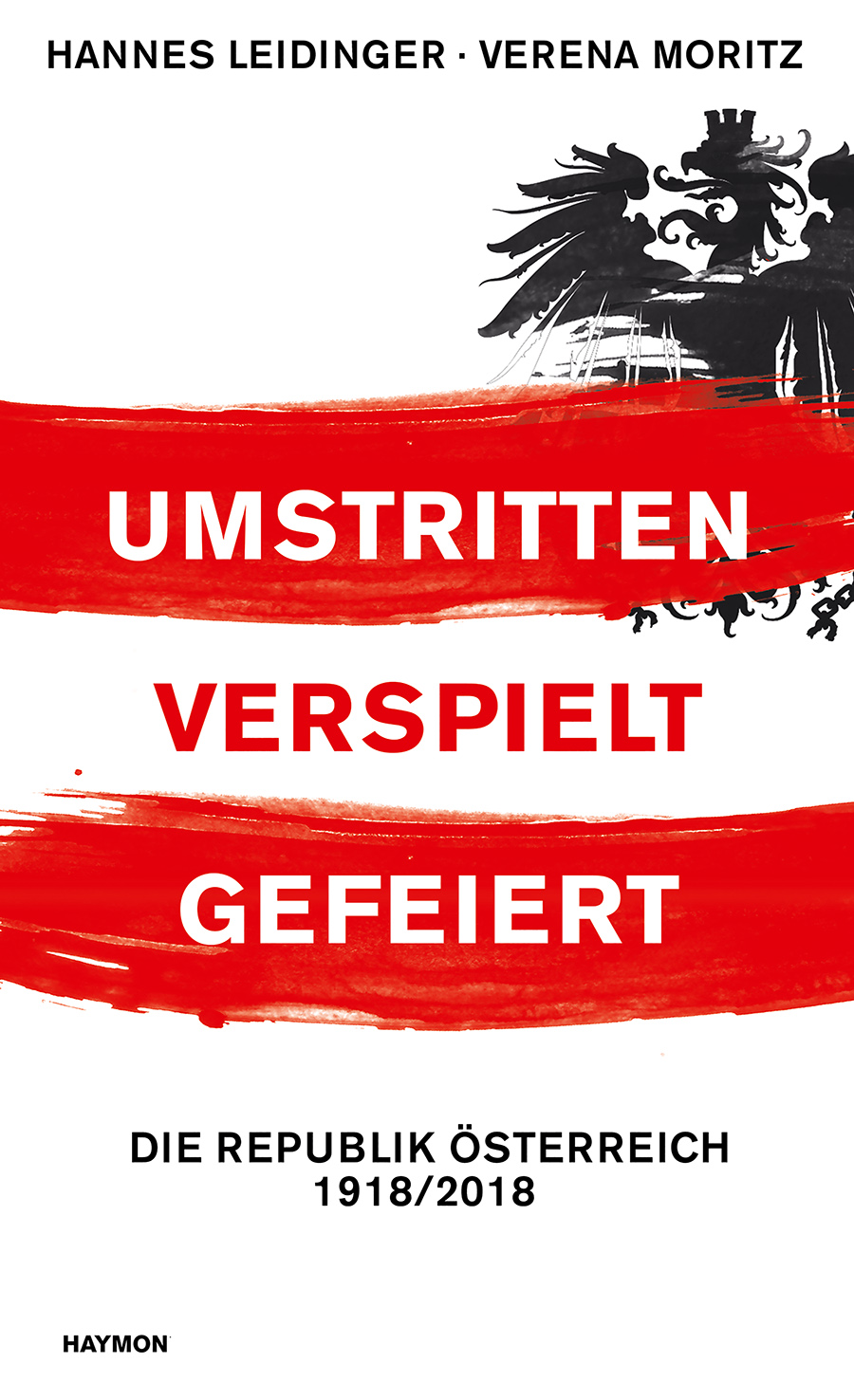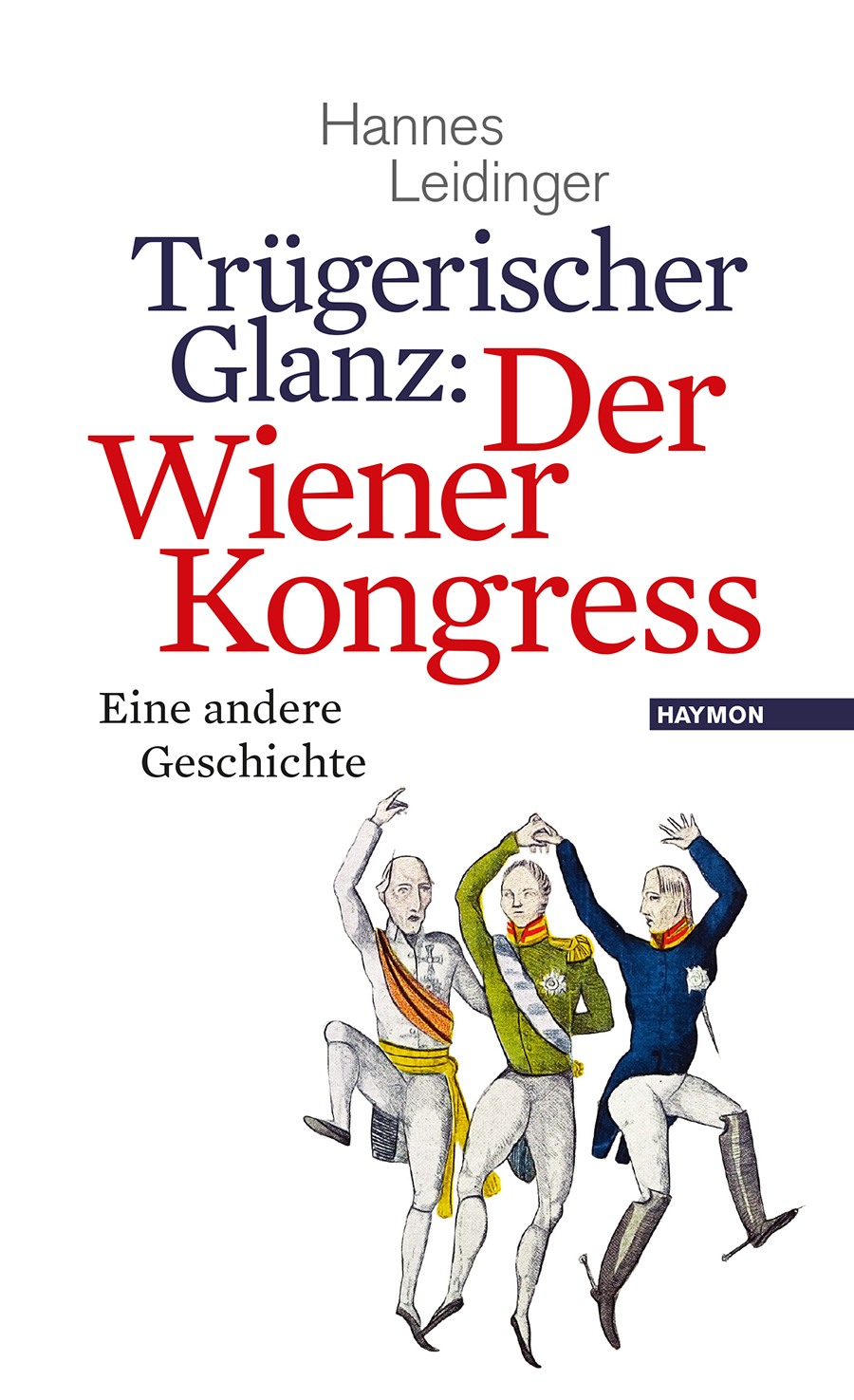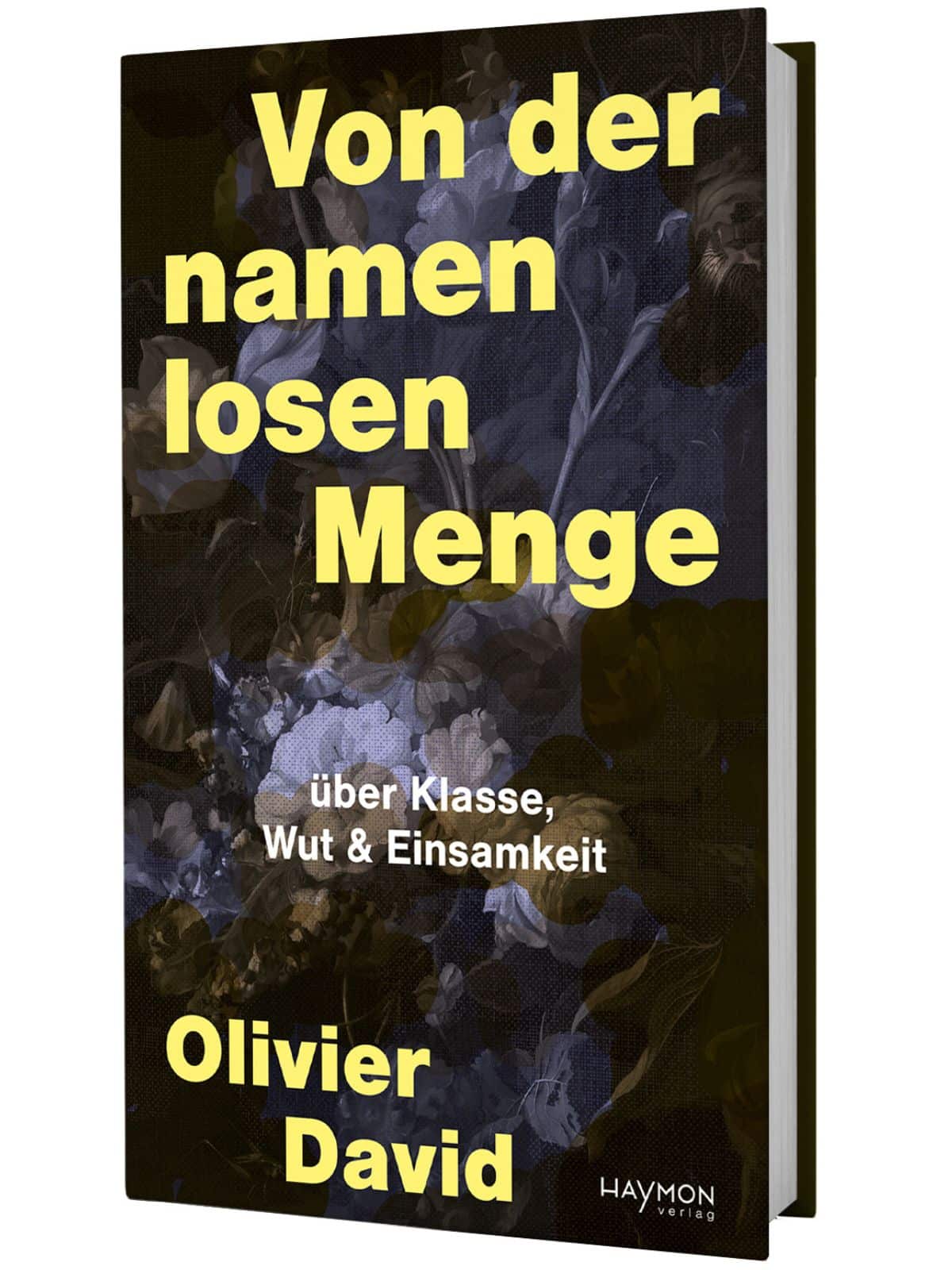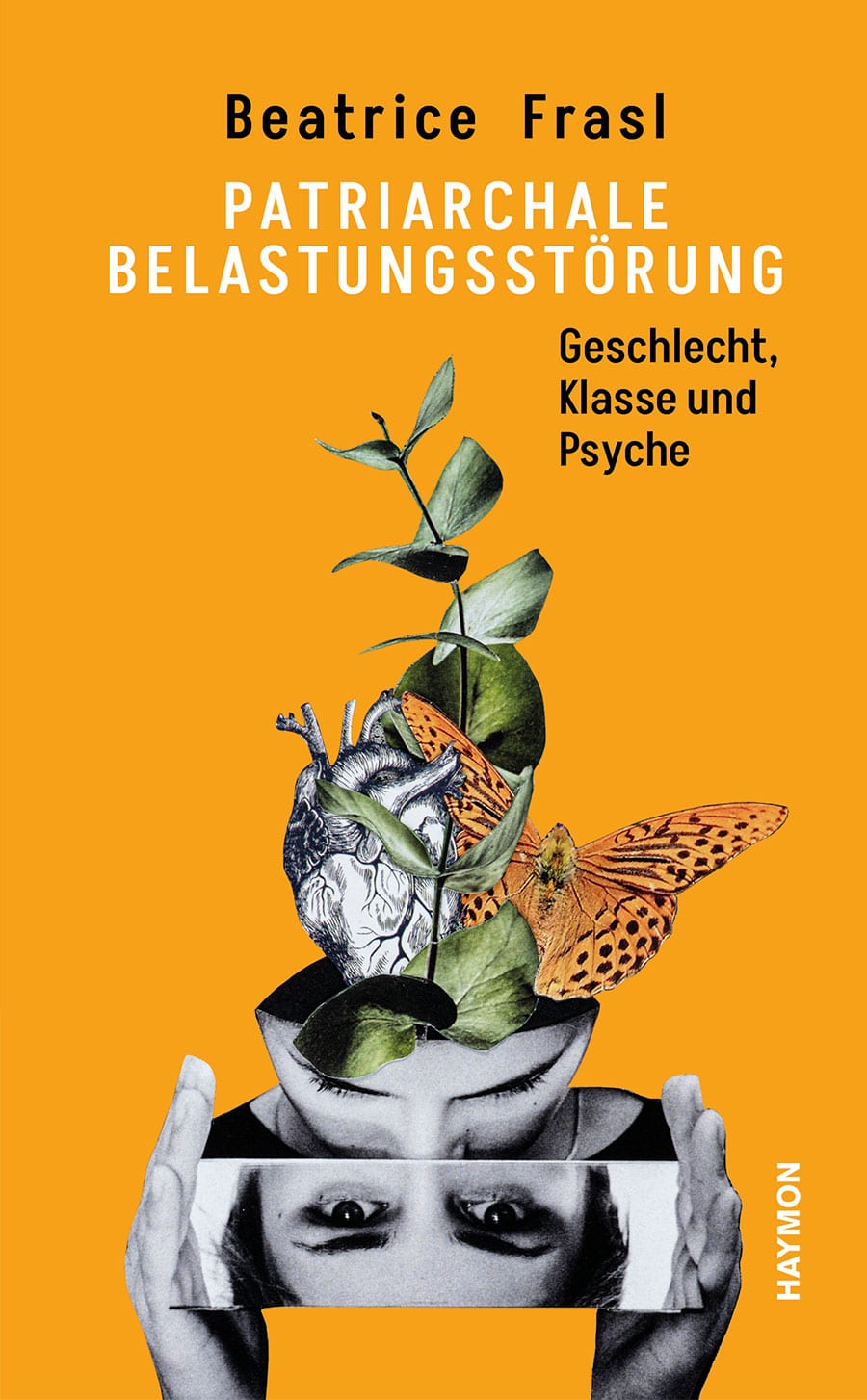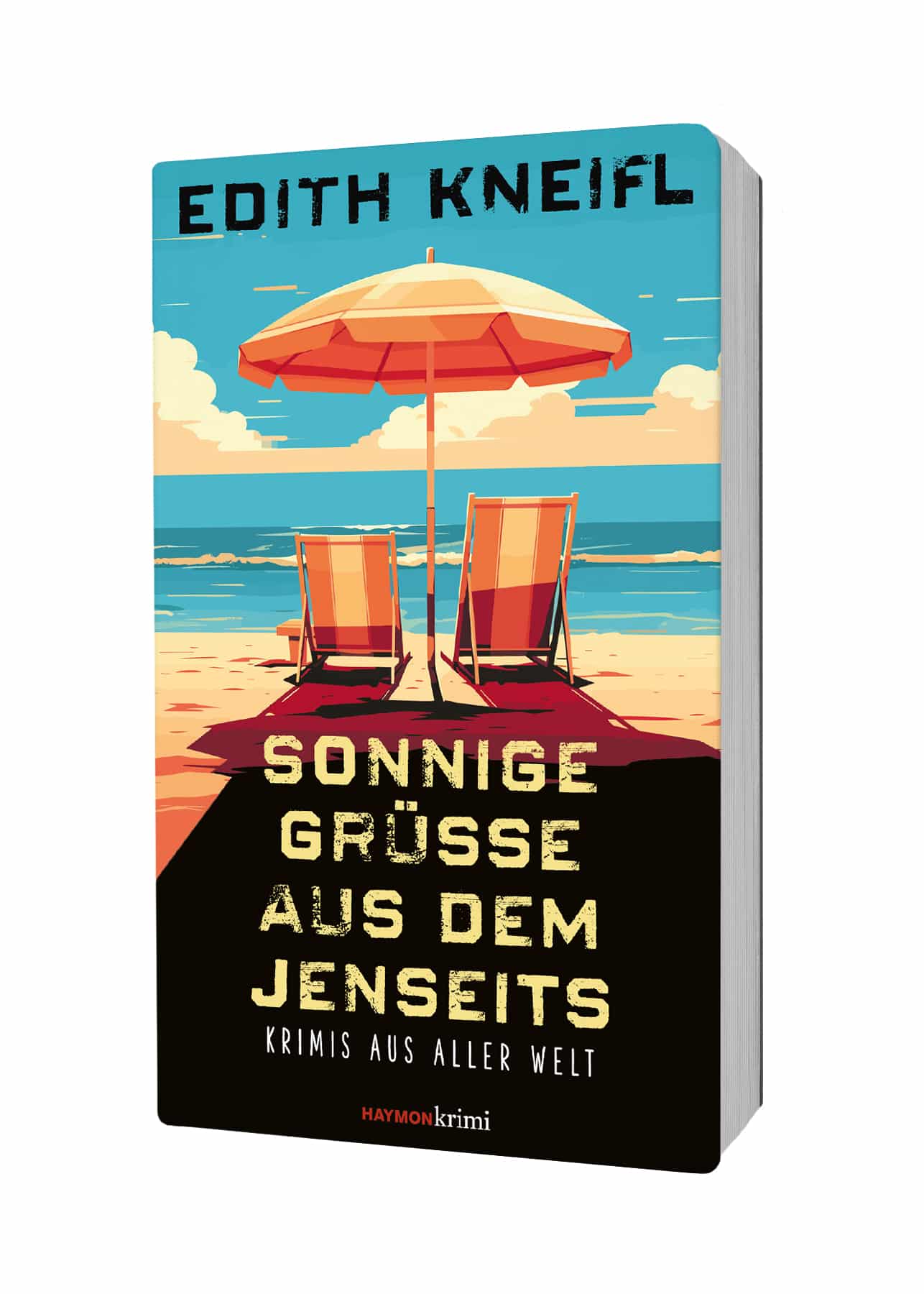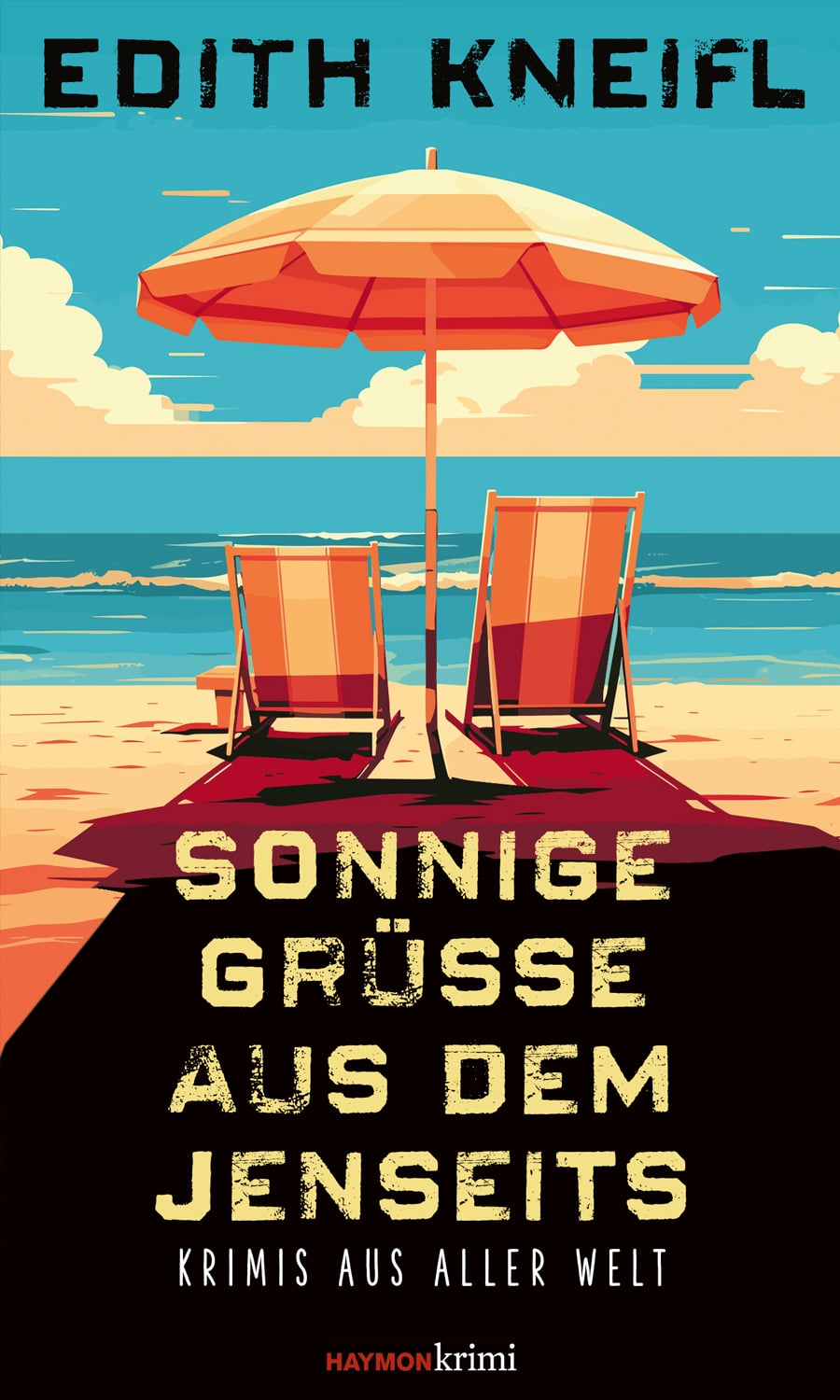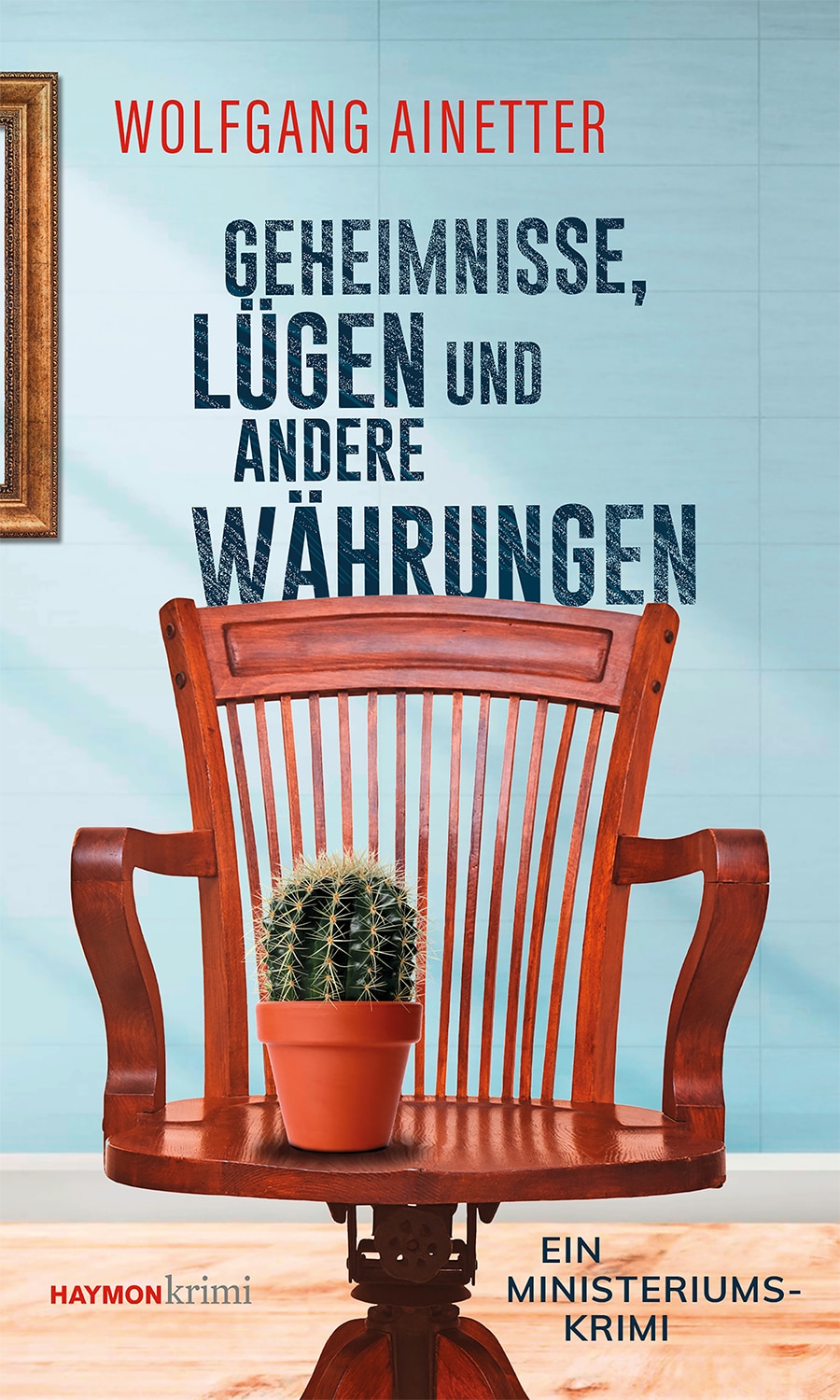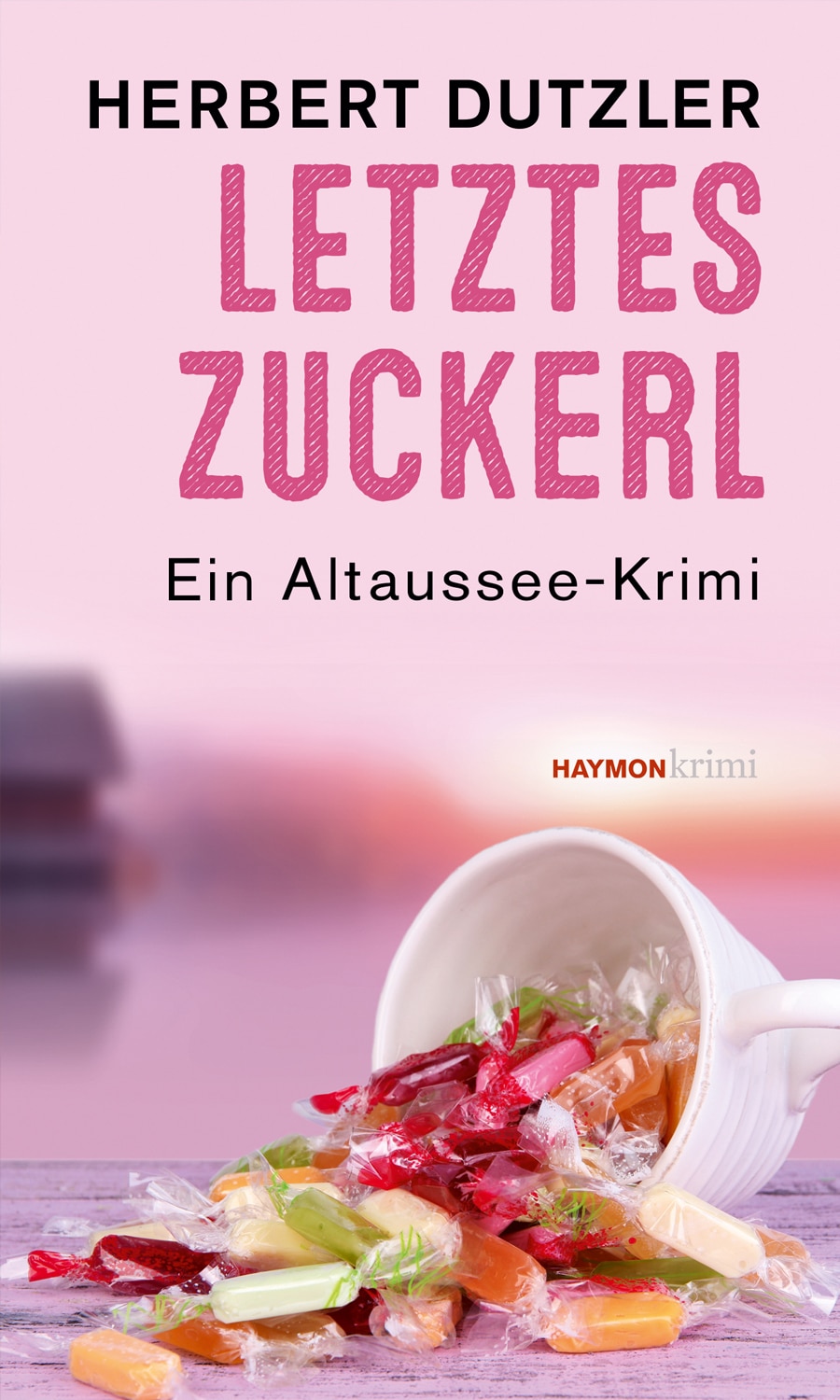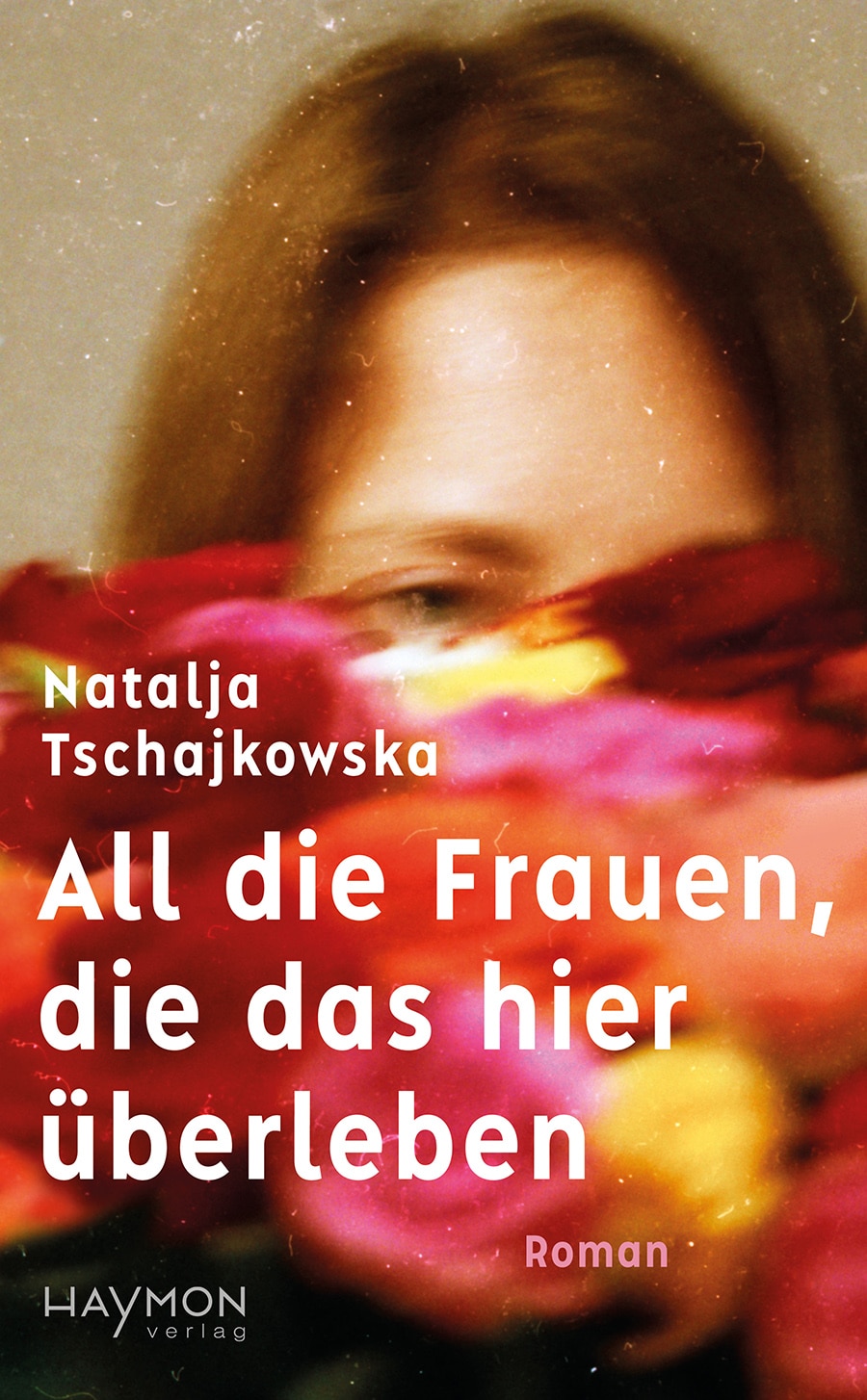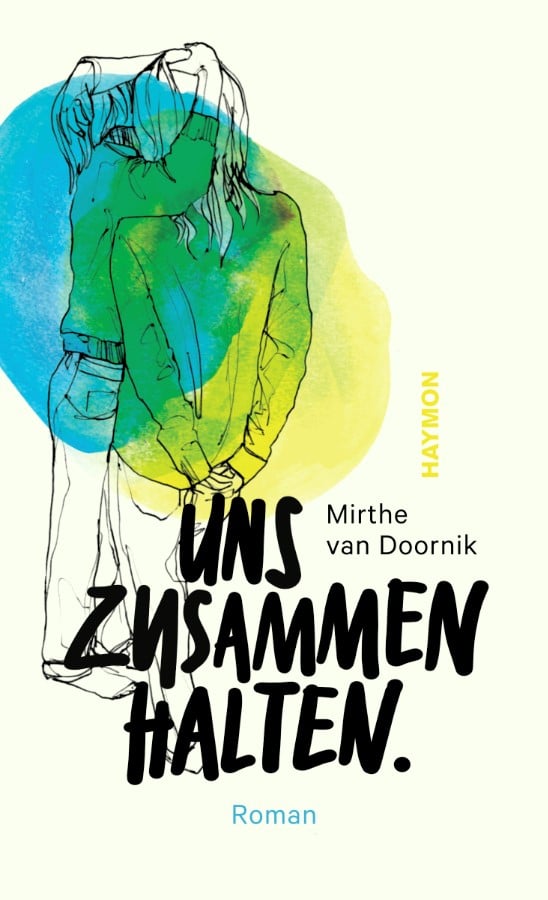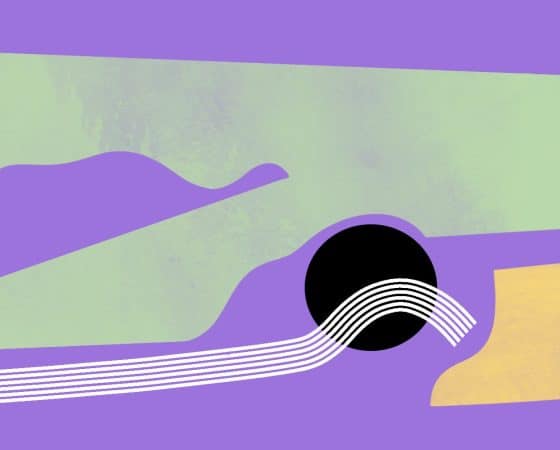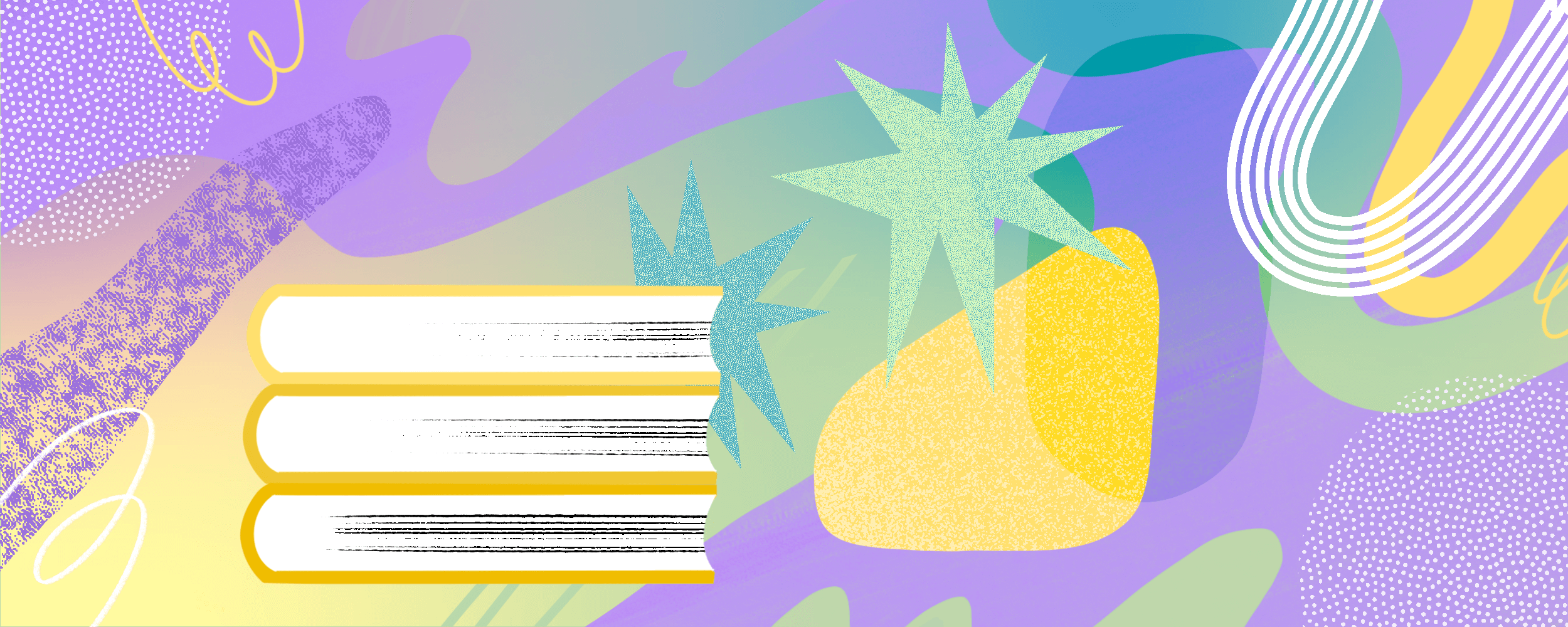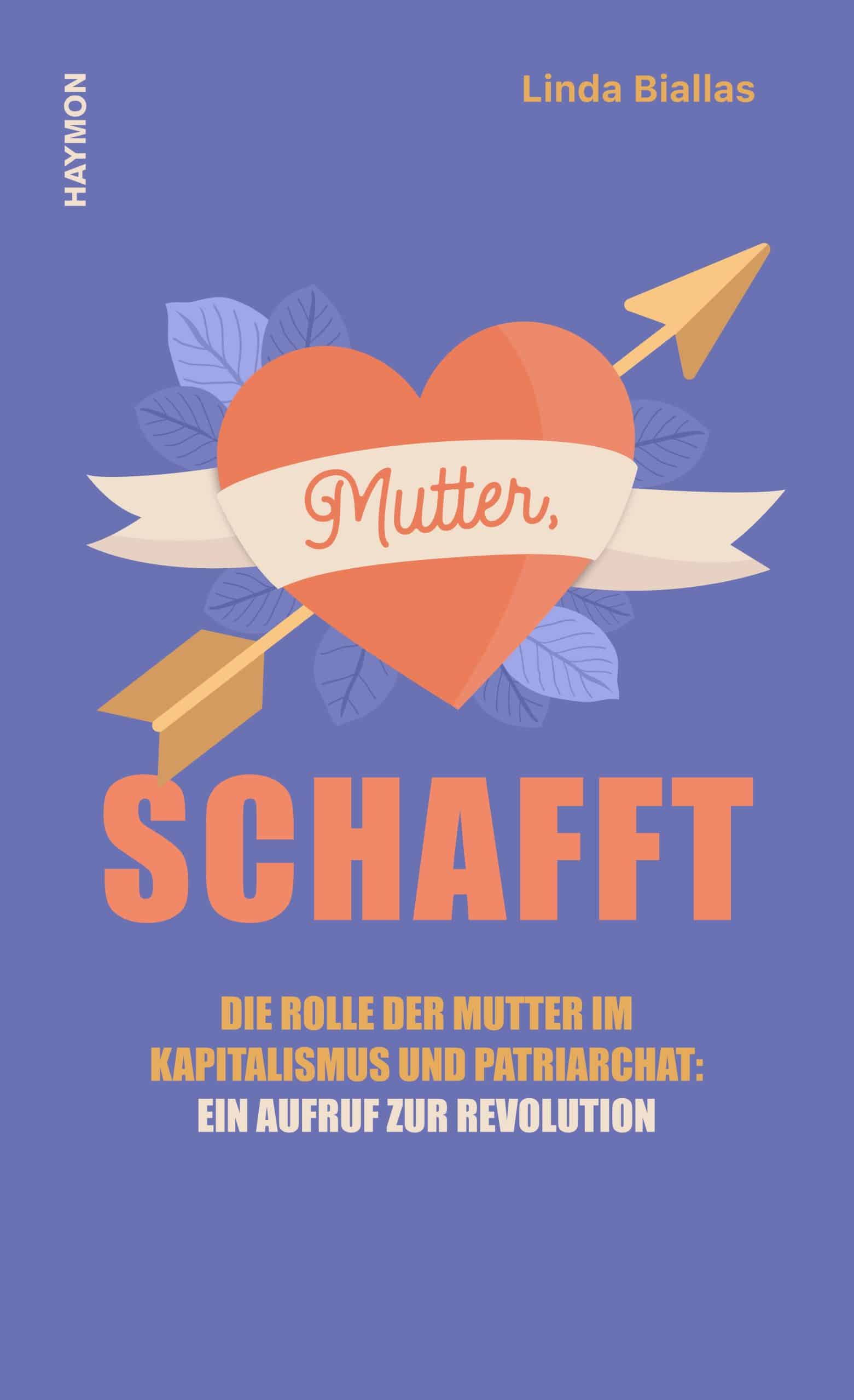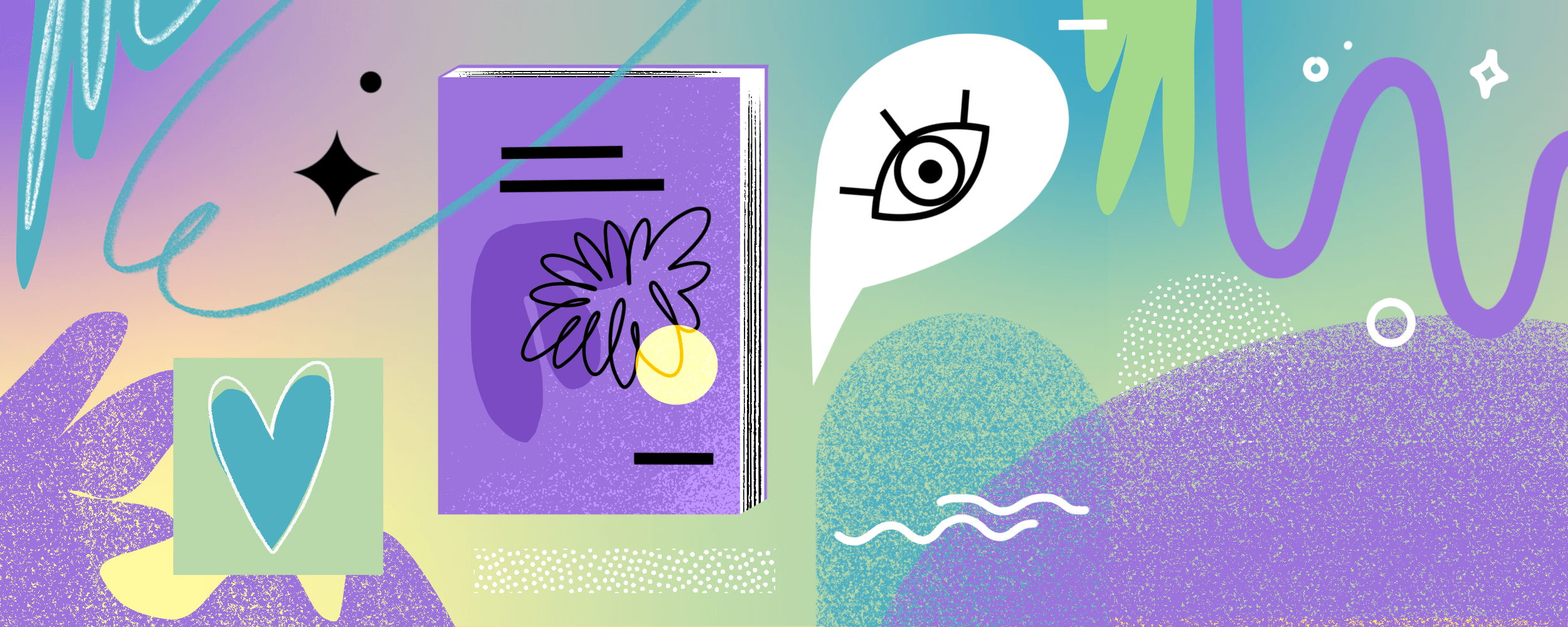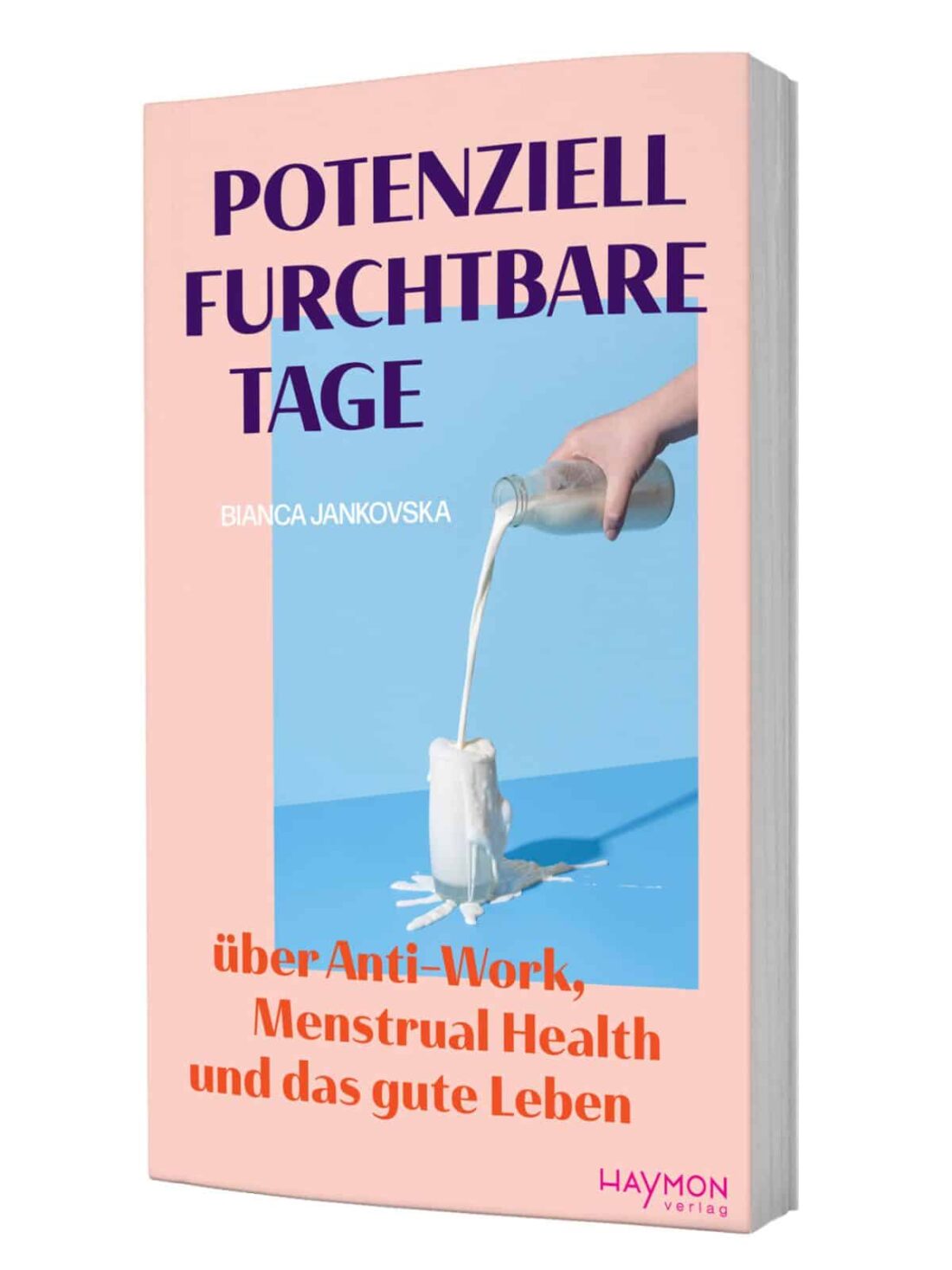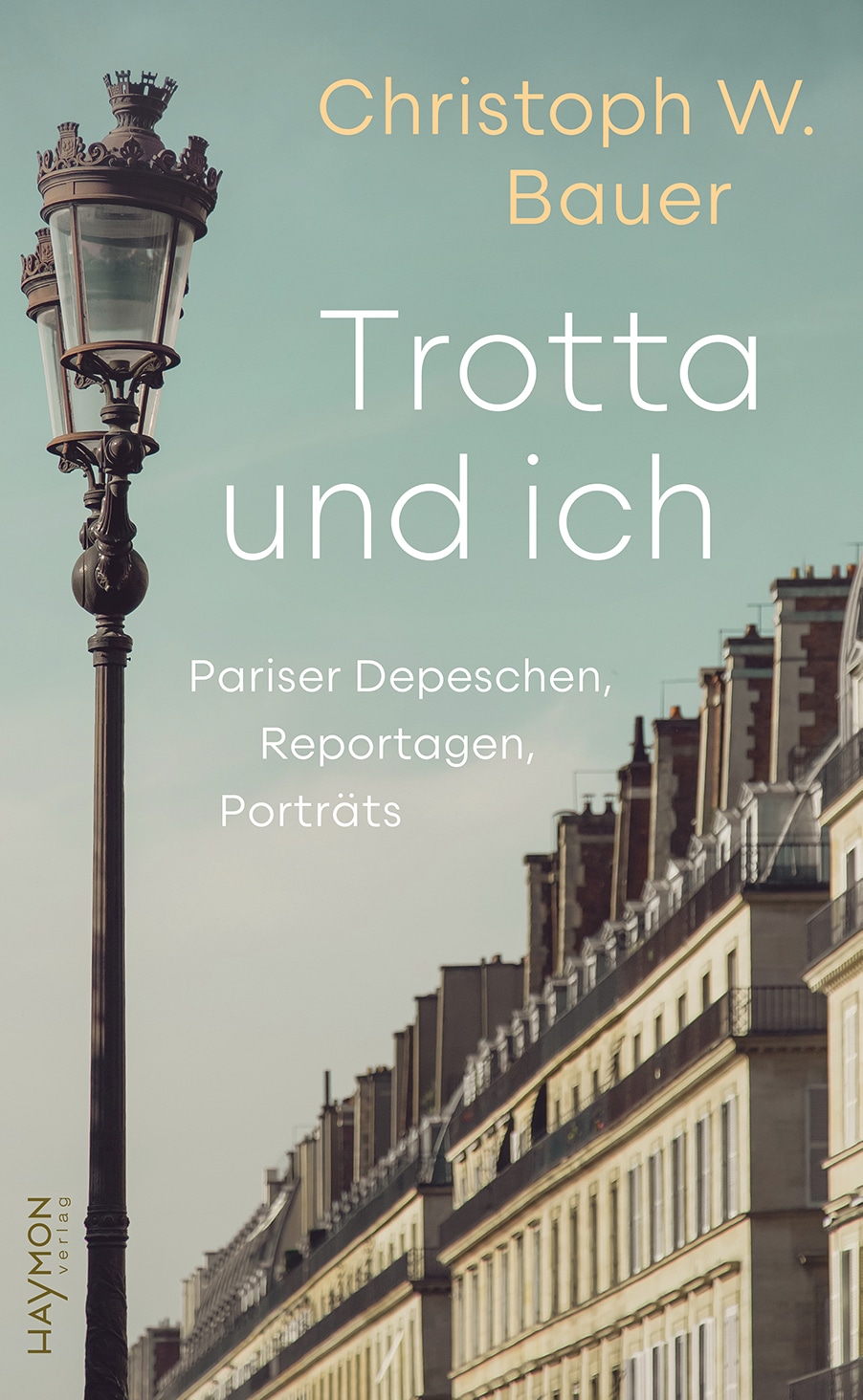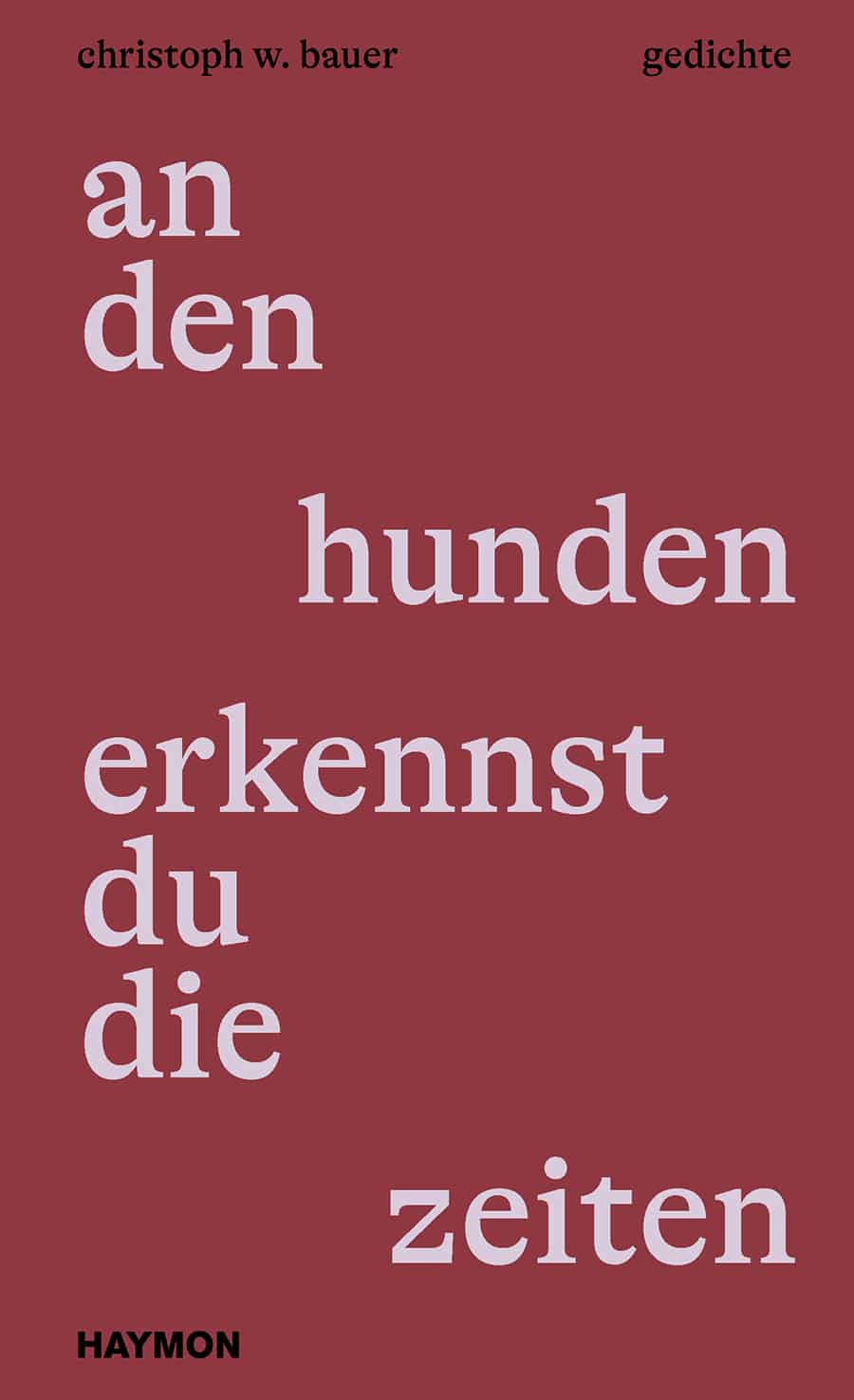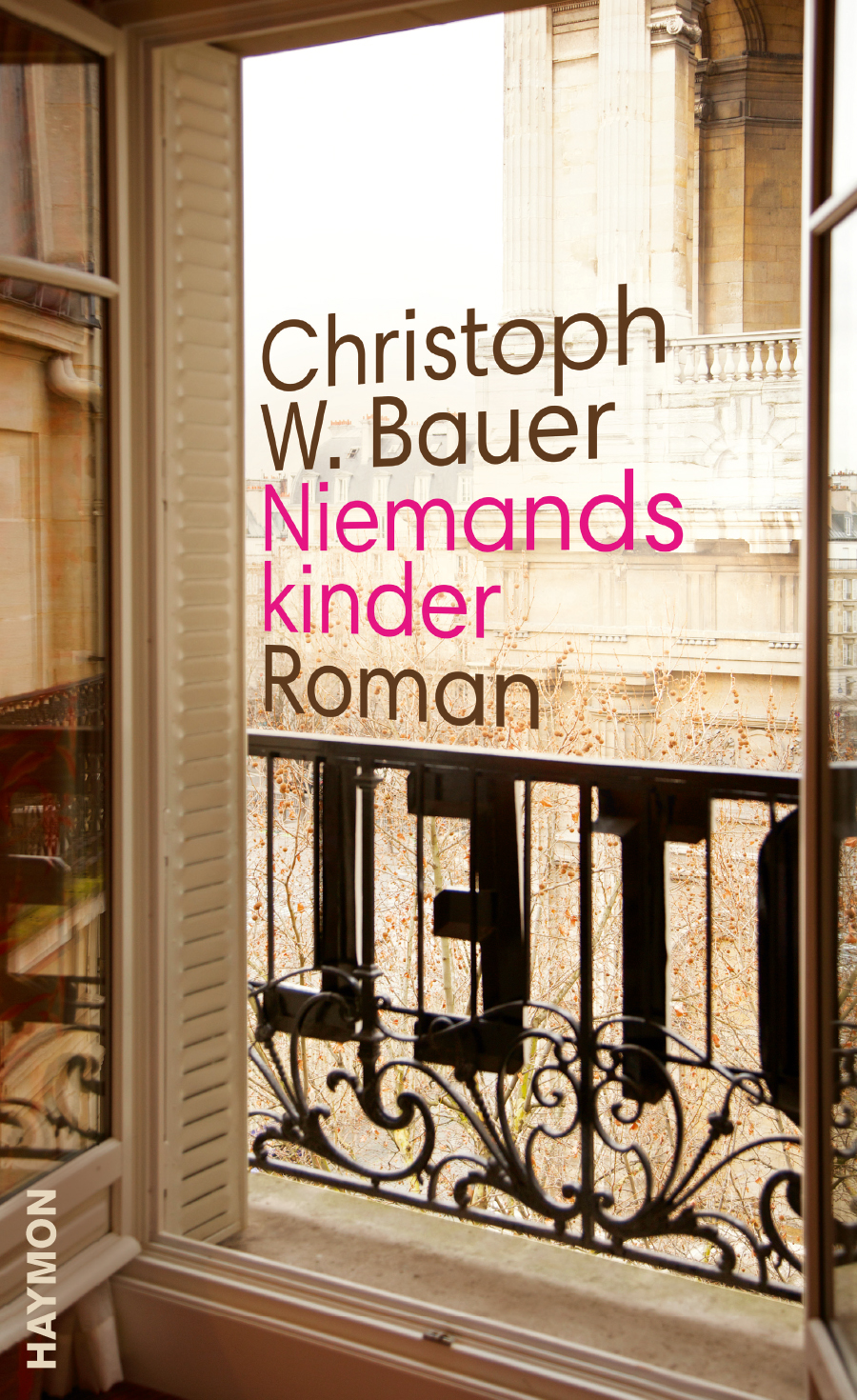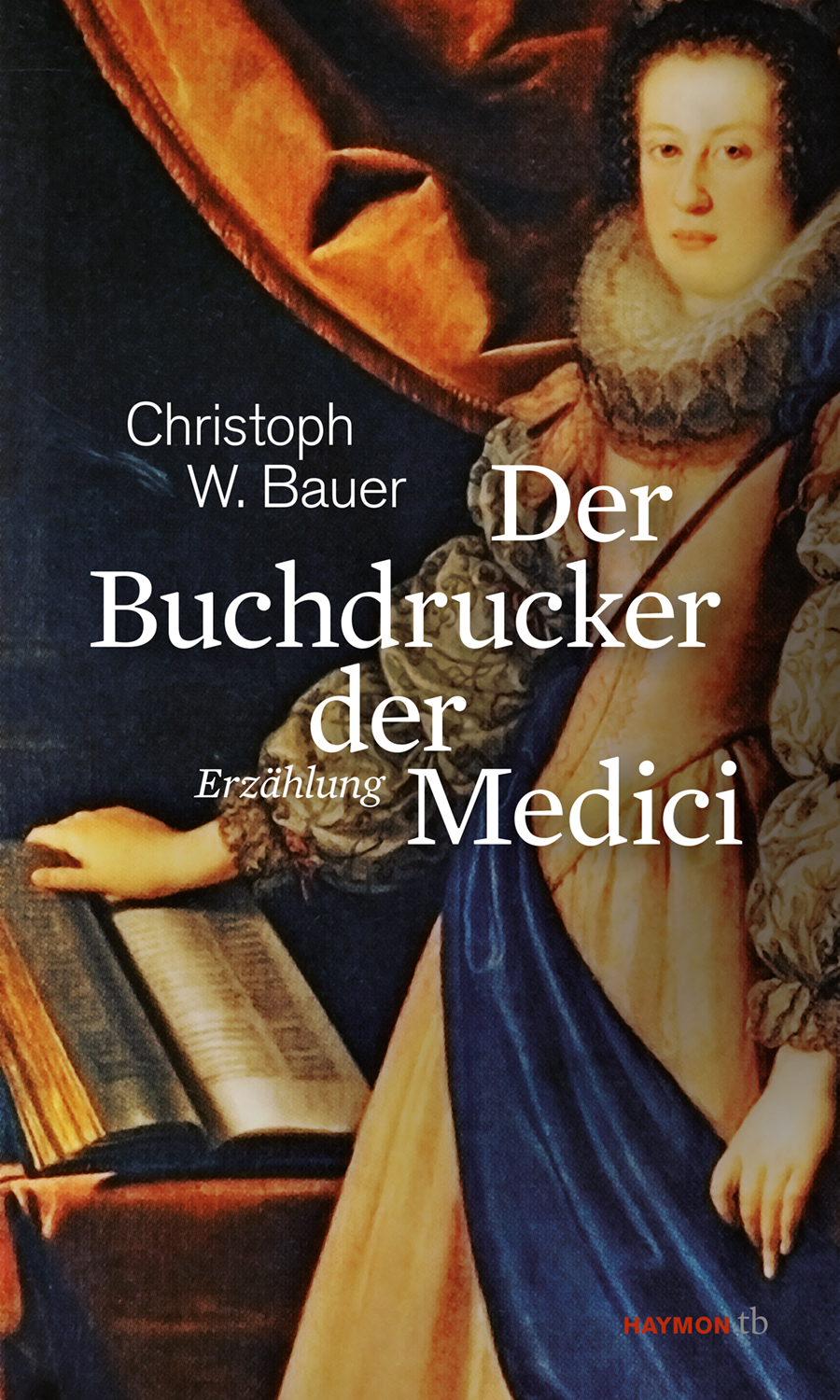Im Oktober 2021 veröffentlichte die Universität Rostock die Fortschrittsstudie „Sichtbarkeit und Vielfalt“. Die Leiterin der Studie, Prof. Dr. Elizabeth Prommer, bilanzierte: „Die Ergebnisse zeigen, dass unser Fernsehprogramm noch nicht die Vielfalt der Bevölkerung abbildet.“ Bei queerer Repräsentation wird festgestellt, dass „nur rund 2 Prozent der im Beobachtungszeitraum erfassten Personen nicht heterosexuell waren.“ Sichtbar wurden nur homosexuelle (0,9%) und bisexuelle (1,3%) Charaktere. Bei 27,4% war die sexuelle Orientierung „nicht erkennbar“.
Weiterführende Erhebungen und repräsentative Zahlen für alle anderen Medienbereiche im deutschsprachigen Raum gibt es bisher nicht. Das möchte die Queer Media Society unter anderem ändern.
Gespräch mit Alexander Graeff von der Queer Media Society: „Unsere Sprache transportiert so oft vermeintliche Selbstverständlichkeiten, Unverrückbarkeiten. Damit blenden wir den Blick darauf aus, dass wir in mehrerer Hinsicht vage Wesen sind, unsere Identitäten sind porös und wandeln sich ständig.“
Die Queer Media Society, kurz QMS, ist eine ehrenamtlich organisierte Initiative von Medienschaffenden, die sich gegen Diskriminierung von queeren Personen in allen Mediensparten einsetzt und sich für eine offene Gesellschaft engagiert. Es ist bisher das einzige Netzwerk dieser Art im gesamten deutschsprachigen Raum – und womöglich darüber hinaus. Wir haben uns mit Alexander Graeff, Leiter der Sektion „Literatur/Graphic Novel/Verlagswesen“ über die Notwendigkeit queerer Initiativen und Bücher unterhalten.
Lieber Alexander, fangen wir am besten am Anfang an: Wer und was ist die QMS, wie ist sie organisiert?
Die QMS ist mehr eine soziale Bewegung, als eine Organisation im engeren Sinne. Wir sind keine NGO oder ein Verein, haben keine Rechtsform. Die QMS existiert allein durch das individuelle und kollektive Engagement unserer ehrenamtlichen Mitstreiter*innen. Jenseits dieser selbst verwalteten Gruppenstruktur gibt es keine übergeordneten Gremien, keinen Vorstand oder Ähnliches. Es gibt Aktive und Menschen, die durch ihre Stimme dem Kollektiv eher passiv Gewicht geben.
Welche Veränderungen hat die QMS bisher vorangetrieben? Wo tritt die QMS auf und mischt sich ein?
Wir versuchen, branchenpolitisch auf die unzureichende Repräsentation queerer Medienschaffender und ganz allgemein auf queere Sichtbarkeit im Hinblick auf produzierte und rezipierte Medien aufmerksam zu machen. Dabei verfallen wir nicht in den binären Modus, dass wir als marginalisierte Personen moralin auf die Mehrheitsgesellschaft zeigen. Wir kooperieren mit den Brancheninstitutionen, mit Verbänden, Produktionsfirmen, Verlagen, um gemeinsam mit den Machtzentren im Medienbereich über Machtverhältnisse und -strukturen zu sprechen. Ergebnisse sind zum einen Aufklärungsarbeit und Beratung, etwa durch Trainings zu relevanten Themen der Diversität, zum anderen möglichst pressewirksame Aktionen, Diskussionspanels, Debatten- und Diskursbeiträge sowie Veranstaltungen, die möglichst hohe queere Sichtbarkeit und Öffentlichkeit im Medienbereich generieren.
Eine große erfolgreiche Aktion der Vergangenheit war z. B. die Vorbereitung der #ActOut-Kampagne 2021 innerhalb der Film-Sektion. Allerdings hölt auch hier steter Tropfen den Stein. Ich denke, kontinuierliche Angebote sind wirksamer, weil sie regelmäßig und dauerhaft an die Schieflagen innerhalb unserer Kultur erinnern, und so die Effekte nicht nach einem Aktionsjahr wieder verpuffen. Nur so viel: Trotz #ActOut ist für 2023 ein Rückgang queerer Figuren in deutschen Filmproduktionen zu verzeichnen.
Mit der Literatur-Sektion veranstalten wir außerdem jährlich zur Buchmesse in Leipzig ein Panel zu relevanten Themen. Der Haymon Verlag ist ja unser Kooperationspartner bei diesem Projekt. Ebenso kooperieren wir auch jährlich mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels für die #PrideBuch-Social-Media-Aktion im Pridemonth Juni.

Alexander Graeff ist Schriftsteller, Philosoph und Literaturvermittler. Er schreibt Lyrik, Prosa sowie biografisch-philosophische Essays – und mischt die Gattungen ganz gern. Er ist Leiter des Programmbereichs Literatur im Berliner Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik sowie Initiator der Lesereihe „Schreiben gegen die Norm(en)?“. In der Queer Media Society setzt er sich für mehr Sichtbarkeit queerer Personen und Stoffe im deutschsprachigen Literaturbetrieb ein. Graeff engagiert sich kulturpolitisch, u. a. in der Berliner Literaturkonferenz (BLK), im Netzwerk Freie Literaturszene Berlin (NFLB) und im PEN Berlin.
Foto: Sarah Berger
Johannes Kram, Autor, Blogger und QMS-Mitstreiter sagte in seinem Vortrag bei der Kick-Off-Veranstaltung der QMS im Februar 2019 in Berlin, es sei wichtig, dass sich mehr queere Medienschaffende outen würden. Gleichzeitig räumte er ein, dass das Coming-Out insbesondere für Schauspieler*innen eine Belastungsprobe für die Karriere sei. Hieraus ergeben sich gleich mehrere Fragen: Was denkst du, warum halten sich ausgerechnet in der Kulturszene solch starre Strukturen so hartnäckig? Und: Wie schätzt du den Stellenwert des Outings ein für das übergeordnete Ziel, eine offenere und bessere Kreativlandschaft zu erreichen? Sollten sich in einer gerechteren Welt nicht alle Menschen outen müssen – oder niemand? Anders ausgedrückt: Ist diese Erwartungshaltung an ein Outing nicht eine weitere Zumutung für queere Personen, die Ungerechtigkeit zementiert?
Wir wissen ja aus der Geschichtswissenschaft, dass Kunst und Kultur zentrale Parameter einer Aktualisierung gesellschaftlicher Normen waren und sind. Romane, Theaterstücke, Gemälde, Opern usw. waren immer schon Sprachrohre mehrheitsgesellschaftlicher Lebensideale. Die frühe bürgerliche Gesellschaft wäre ohne die Ideologisierung ihrer Werte nicht ausgekommen, Stichwort: Dialektik der Aufklärung. Die Kunst half genauso mit wie die Erziehung. Ein prominentes Beispiel ist die Romantik als Kunstströmung um 1800. Ohne sie hätte sich die heteronormative Matrix mit binärer Geschlechterhierarchie, romantischer Zweierbeziehung und Reproduktionszwang nie so nachhaltig in unsere Hirne und Herzen einpflanzen können.
Die Notwendigkeit eines Outings ist in sozialwissenschaftlich-kritischer Perspektive natürlich immer ein Problem. In lebensweltlicher Hinsicht oft auch. Ich muss mir das Coming-out als notwendigen Entwicklungsschritt schönreden. Emanzipation innerhalb einer Gesellschaft ist nie erreicht, wenn die Markierung von Personen, Perspektiven und Identitäten als Erwartungshaltung existiert. Einfach, weil die Abweichung von der Norm die hegemoniale Norm bestätigt. Nur in einer idealen Gesellschaft braucht es kein Coming-out. Wir leben aber leider nicht im Wolkenkuckucksheim, sondern in einer durch und durch hierarchischen, patriarchalen und von Machtinteressen gesteuerten Kultur mit problematischer, meist unreflektierter Geschichte. In der realistischen Perspektive also ist das Outing immer noch wichtig, um den ersten Schritt der Markierung abweichender Positionen zu machen. Die traditionell nicht markierte Norm folgt dann im Prozess der historischen Emanzipation. Das hat auch viel mit Sprachfindung zu tun, denn Markierung heißt ja nichts anderes als Zustände via Sprache bezeichnen zu können. Zur Erinnerung, das Wort „trans“ ist älter als das Wort „cis“.

Du selbst bist Schriftsteller, Philosoph und Literaturvermittler – und du leitest die Sektion „Literatur/Graphic Novel/Verlagswesen“ bei der QMS. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du zur QMS gekommen bist und wie deine Netzwerk-Arbeit aussieht?
Ich war 2019 beim Kick-Off der Film-Sektion dabei. Dort lernte ich den QMS-Initiator und Regisseur Kai S. Pieck kennen. Gemeinsam mit einer Gruppe von ungefähr zwölf Autor*innen und Comic-Zeichner*innen baute ich dann die Literatur-Sektion auf. Es gab regelmäßige Treffen, bei denen wir über mögliche Aktionen brainstormten. Daraus sind dann die aktuellen Dynamiken erwachsen. Leider hatte uns die Corona-Krise stark getroffen und in Sachen Engagement sehr viel Wind aus den Segeln genommen. Viele ehemals Aktive sind dadurch leider in der Versenkung verschwunden.
Heute koordiniere ich die Aktionen, die wiederum andere, neue Aktive realisieren. Dazu zählen die Panels im Rahmen der Leipziger Buchmesse und die #PrideBuch-Kampagne. Wir arbeiten so, dass jede*r das macht, was sie*er machen kann. Unsere Arbeit ist immer ehrenamtlich, d. h. angesichts der prekären beruflichen Situation vieler Autor*innen und anderer Personen, die im Literaturbetrieb arbeiten, muss die aktivistische Mehrarbeit gut geplant und effizient realisiert werden.
Welche persönlichen Beweggründe gab und gibt es für dein Engagement für die QMS?
Für mich ist mein Engagement für die QMS bis heute eine Konsequenz meiner eigenen Politisierung seit 2014. In dieser Zeit wurde mein Schreiben insgesamt politischer, und ich auch mutiger. Das war der innere Beweggrund. Es gab auch einen äußeren. Die gesellschaftlichen und wenig später parlamentarischen Veränderungen in Deutschland machten für mich die Sache dringlich. Soviel wusste ich nämlich aus der Geschichte dieses Landes: Die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Tendenz, abweichende Teile des sozialen Miteinanders unsichtbar zu machen, ermöglichte erst den Aufstieg rechtsnationalistischer und faschistischer Projekte und Parteien. Es war fast so, als ob der immer dringlicher werdende Kampf gegen die politischen Unsäglichkeiten der letzten zehn Jahre in meine Literatur und in mein Handeln innerhalb der Branche drängte.
Was würdest du dir für die Zukunft der Buchbranche wünschen? Wo siehst du besonderen Handlungsbedarf?
Handlungsbedarf sehe ich vor allem da, wo unter Diversität ein eigenartiges Neben- und Herausstellen von vermeintlichen Werten betrieben wird. Verlage etwa, für die Queerness bloß ein mehr oder minder abstraktes Thema ist und dieses breitenwirksam verkaufen wollen, beschädigen die Emanzipationsbewegung. Queere Sichtbarkeit ist auf jeden Fall nicht, dass im selben Verlagsprogramm rechtspopulistische Propaganda neben dem Coming-of-Age-Roman eines trans Autors steht, nur weil sich damit mittlerweile auch Geld verdienen lässt. Einige konservative Verlage gehen immer noch so vor. Sie verändern ihr Programm nicht, weil sie sich ihrer Verantwortung als Kulturinstitution und gegenüber einer Gesellschaft, die sich emanzipiert, bewusst werden, sondern weil sie neue Marktanteile gewinnen wollen. Noch enttäuschender finde ich es allerdings, wenn vermeintlich progressive Autor*innen in exakt diesen paternalistischen und konservativen Institutionen ihre Bücher veröffentlichen.
Woran liegt es deiner Meinung nach, dass echte Diversität und Stimmenvielfalt am Buchmarkt scheinbar so schwer zu erreichen sind?
Ich traue Echtheit nicht über den Weg. Wann ist Echtheit erreicht? Wann ist Diversität echt? Unsere Sprache transportiert so oft vermeintliche Selbstverständlichkeiten, Unverrückbarkeiten. Damit blenden wir den Blick darauf aus, dass wir in mehrerer Hinsicht vage Wesen sind, unsere Identitäten sind porös und wandeln sich ständig. Diesen Sachverhalt durch Literatur in die Hirne und Herzen zu bringen, ist mir wichtiger, als Begriffe exakt definieren zu können.
Aber zum Inhalt deiner Frage: Es liegt an einem insgesamt prekären Betrieb, in dem sich bildungsbürgerliche Ideale verknoten mit einem beruflich bedingten Konkurrenzkampf um Honorare, Preise, Kritiken, Programmplätze usw. All das ist begrenzt und unsere Branche ist finanziell schlecht ausgestattet. Der Druck, Literatur als hehres demokratisches Instrument sehen zu wollen bei gleichzeitig unauskömmlicher Finanzierung der Sparte, macht etwas mit seinen Akteur*innen. Offenheit für Diversität jenseits des oben erwähnten Tokenismus ist also nach wie vor schwer herzustellen. Der Literaturbetrieb hat ganz grundlegend ein Verteilungs- und ein Solidaritätsproblem.
Als abschließende Frage: Wer kann Teil des QMS-Netzwerks werden und wie geht das?
Jede*r, die*der professionell im Medienbereich tätig ist, kann mitmachen. Um sich der sozialen Bewegung anzuschließen und einem wachsenden Kollektiv Nachdruck zu verleihen, sind zwei Dinge nötig: Gesicht zeigen und Stimme erheben. Auf der Internetseite der QMS kann man sich mit seinem persönlichen Foto-Statement anmelden.
Du arbeitest im Medienbereich und hast Lust, Teil der Queer Media Society zu werden?
Hier findest du alle Infos, die du brauchst!