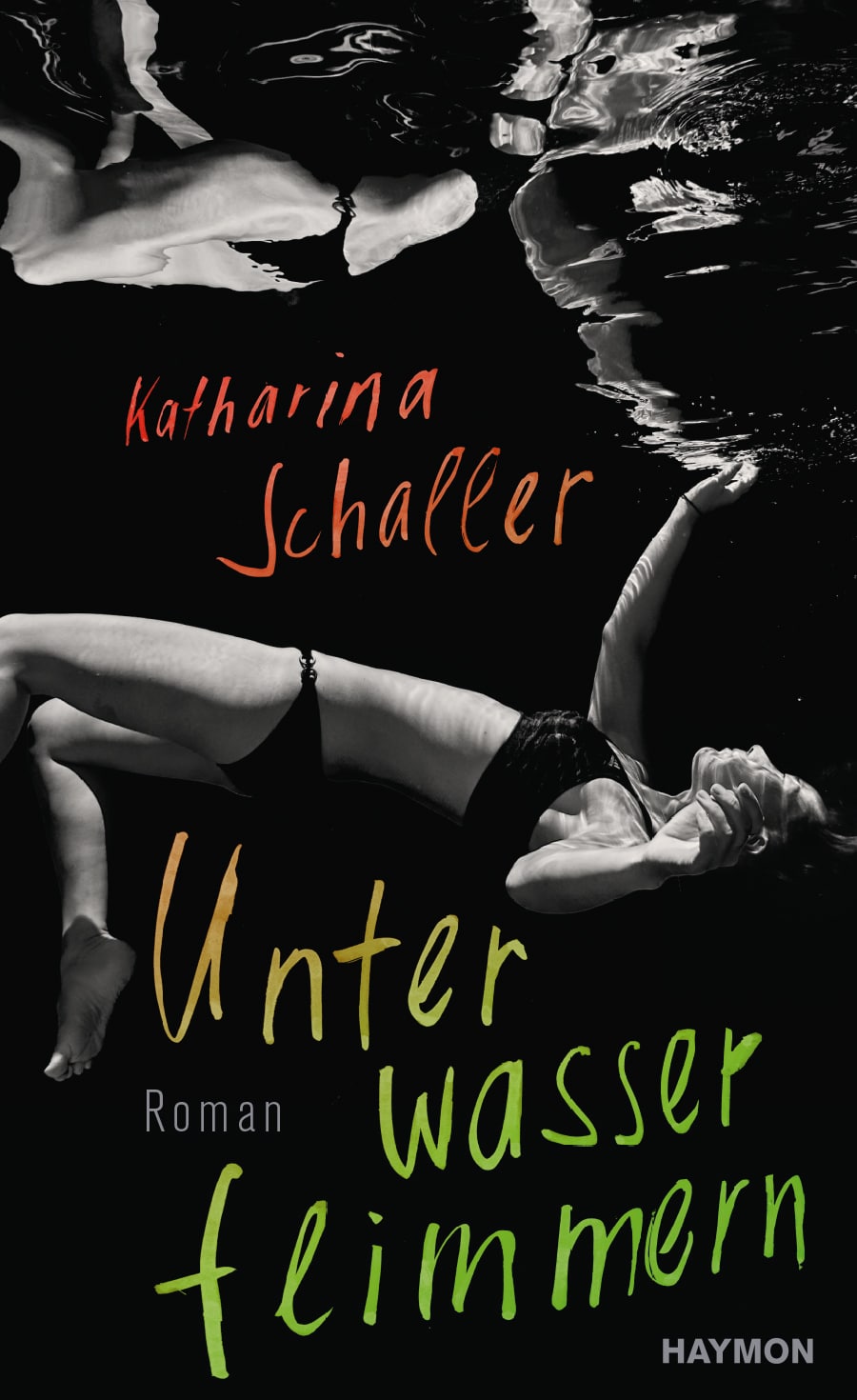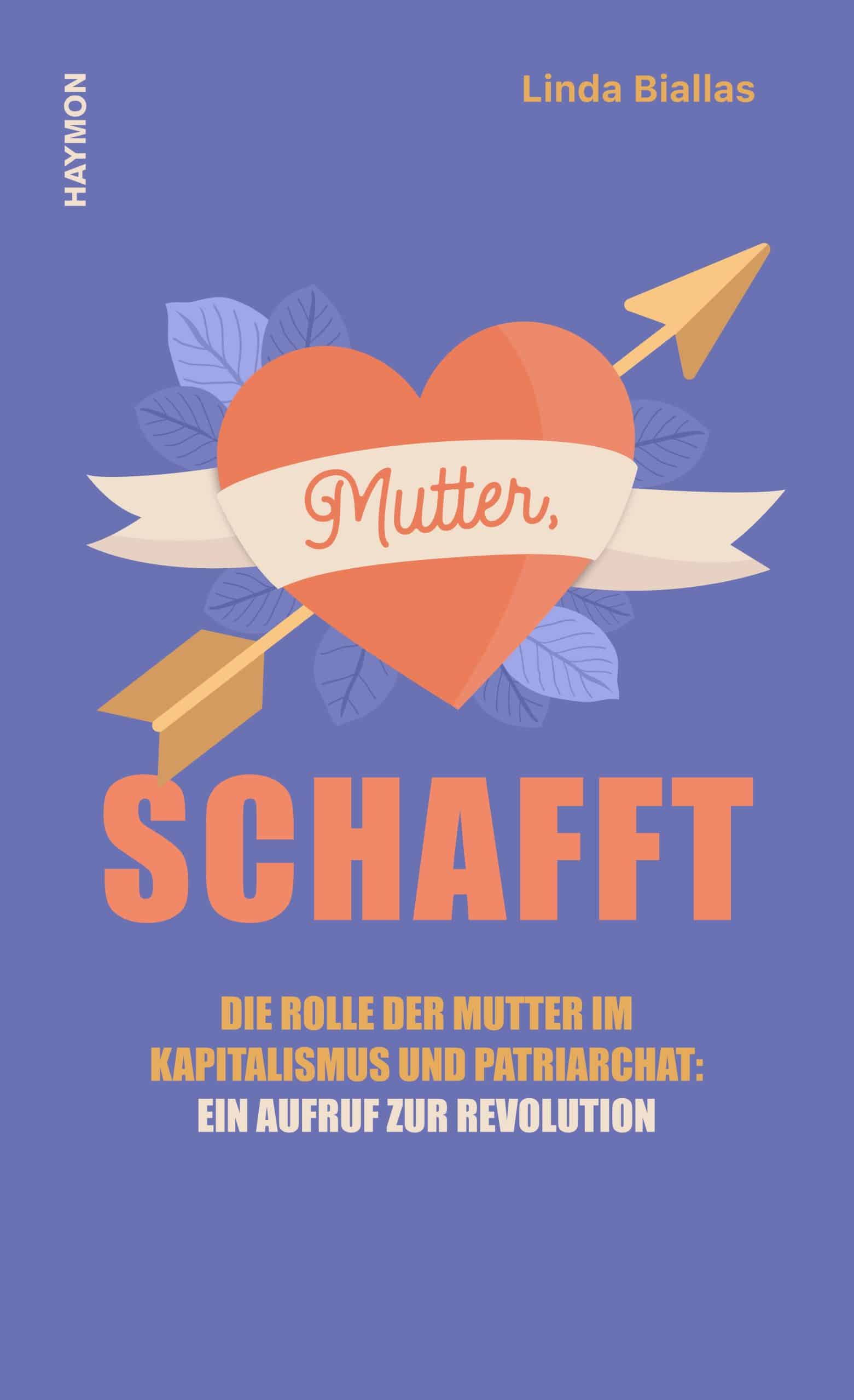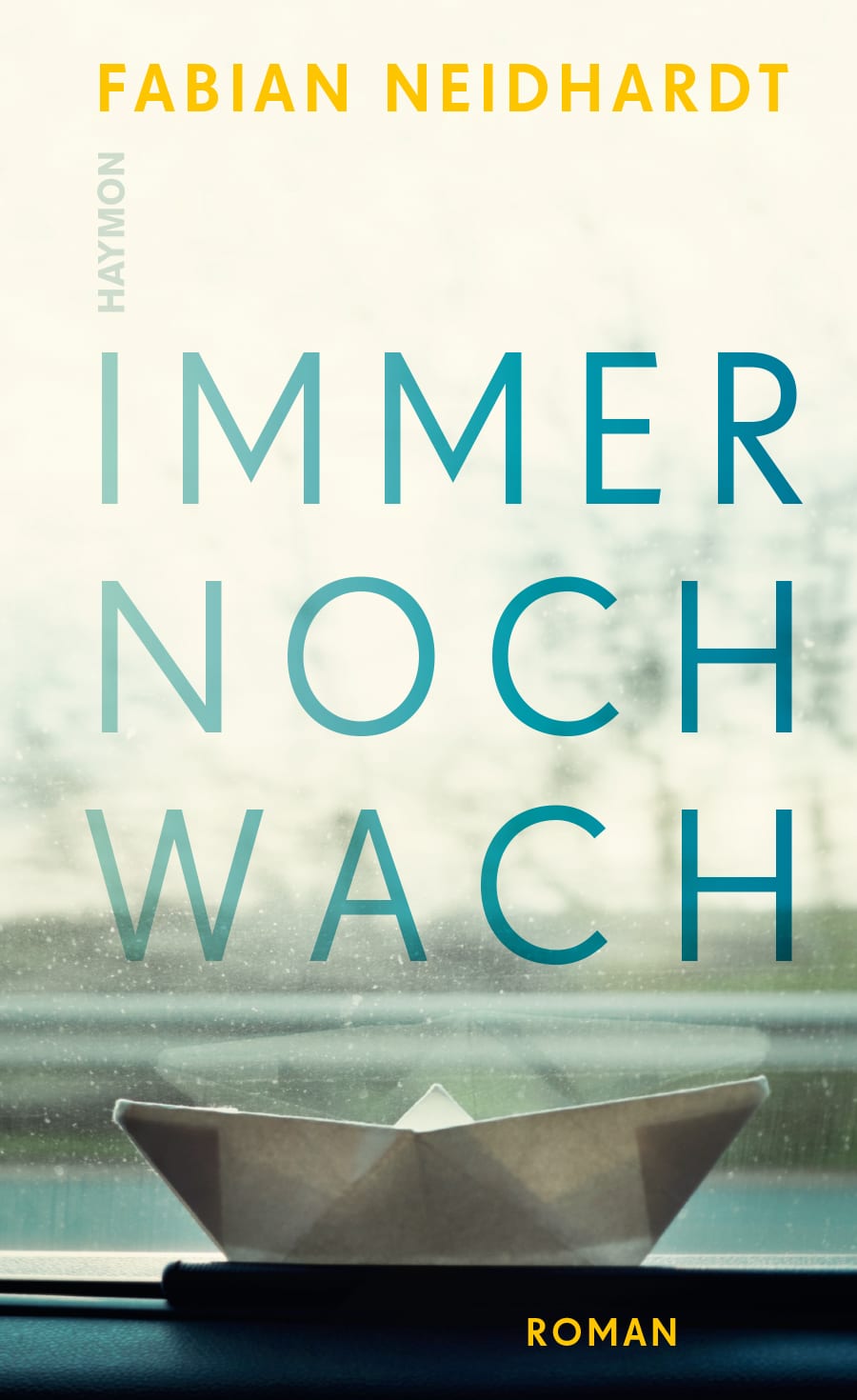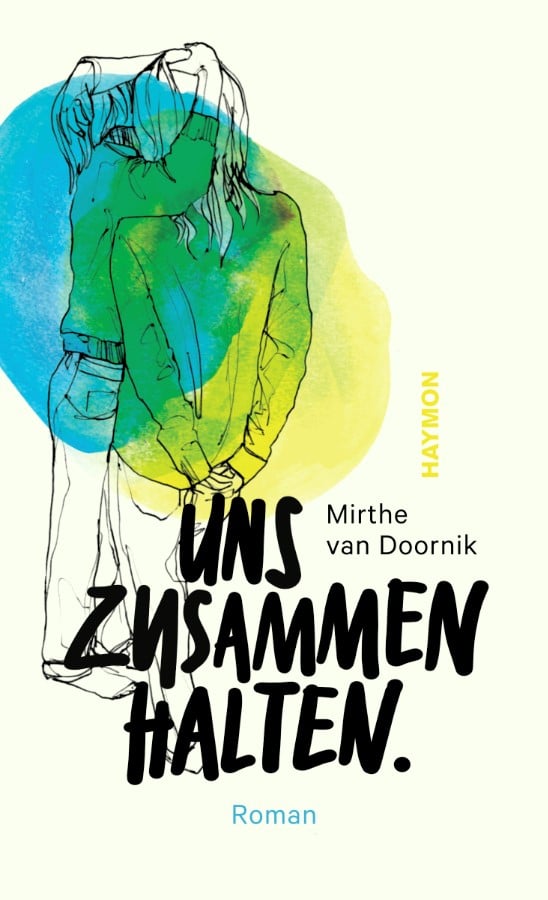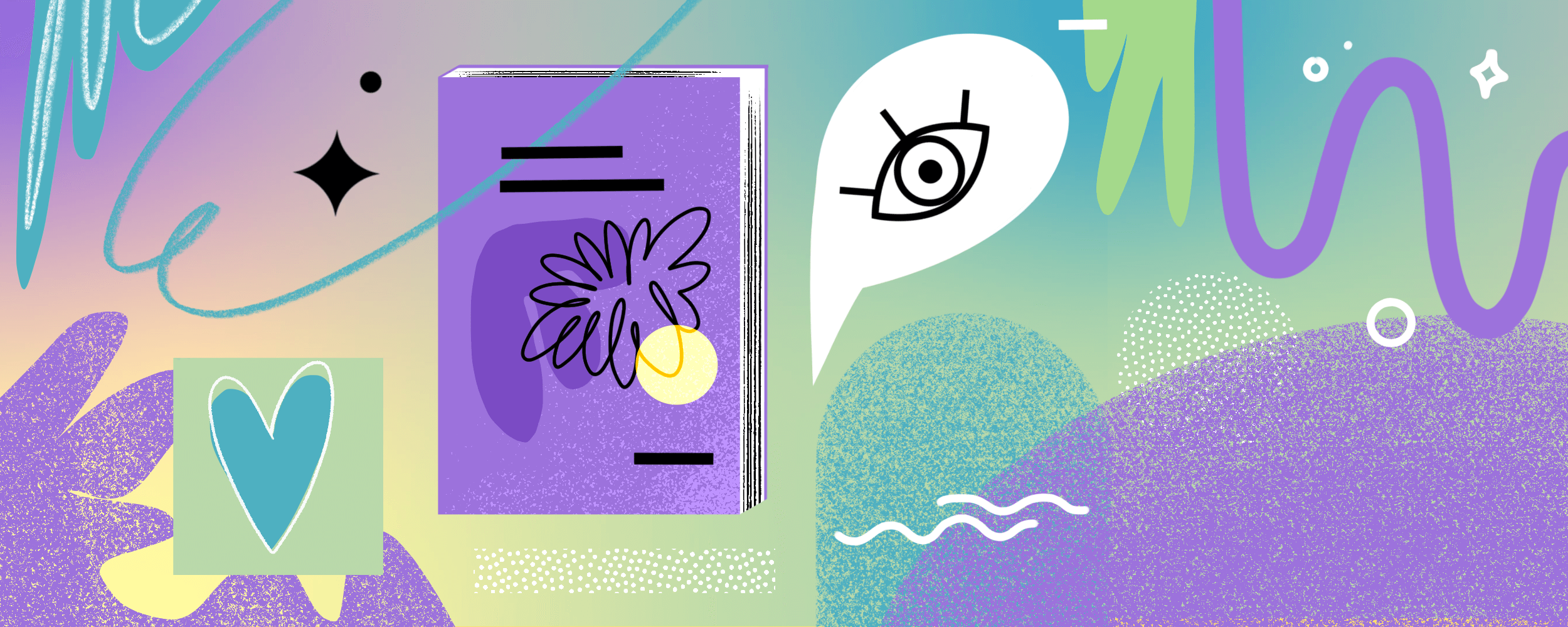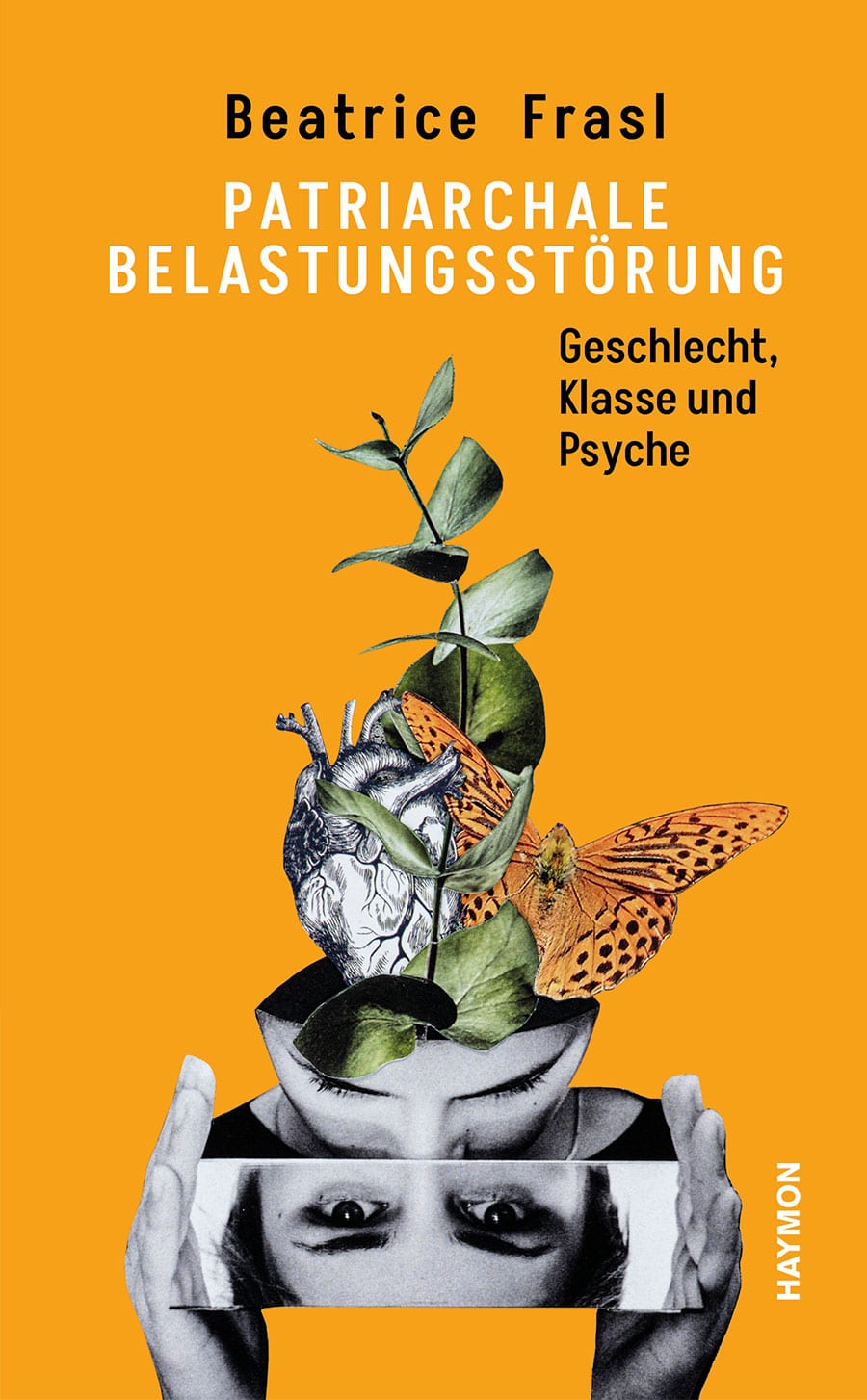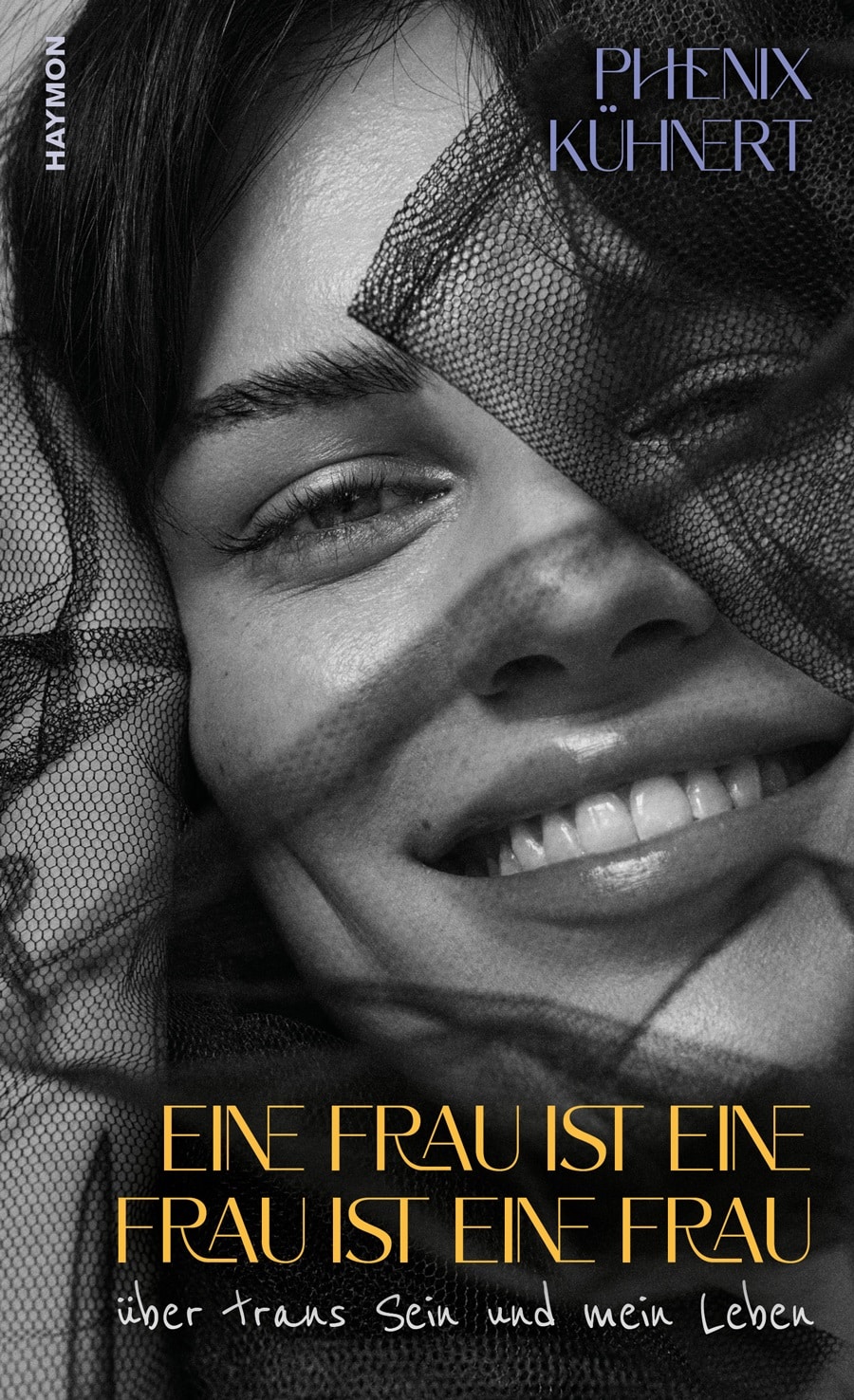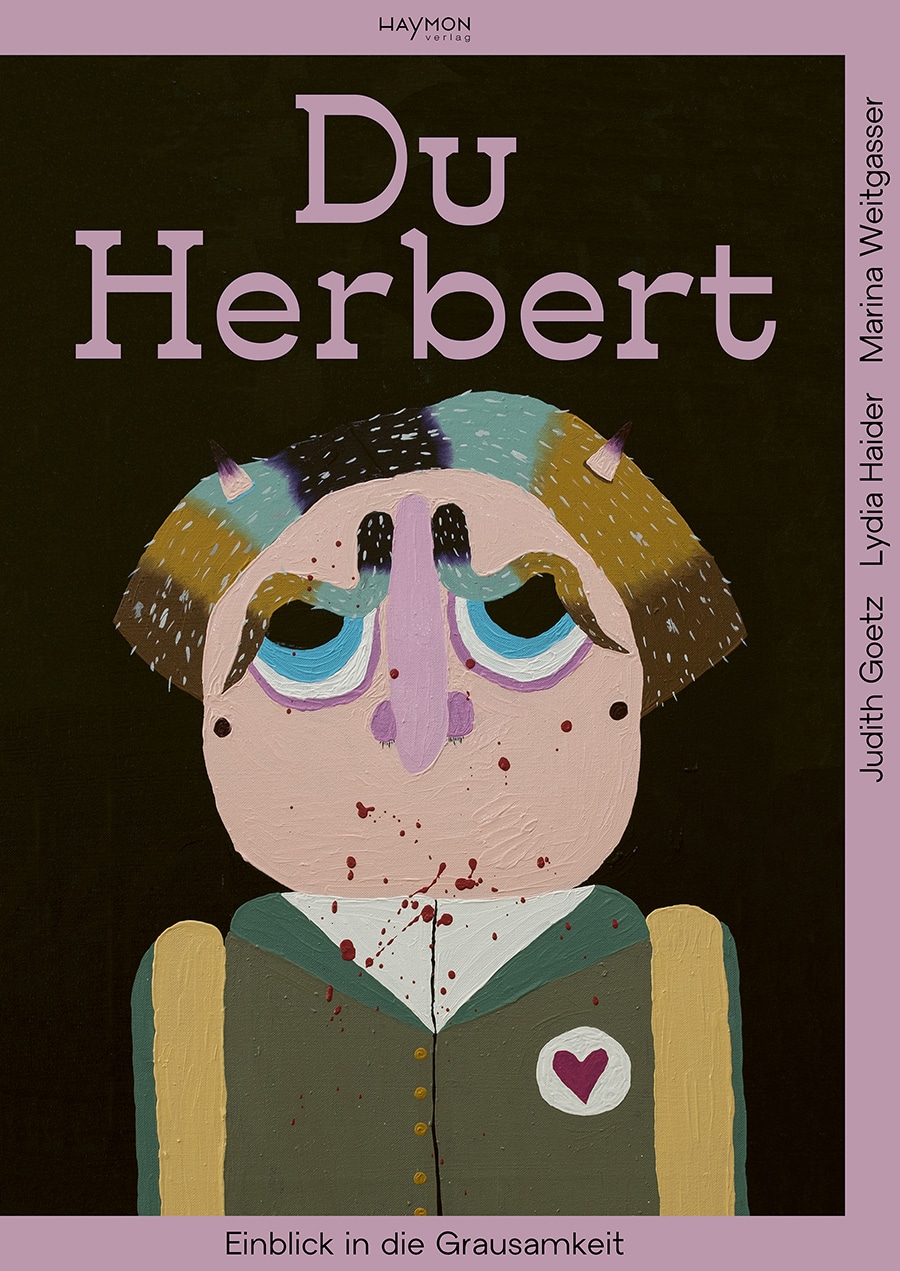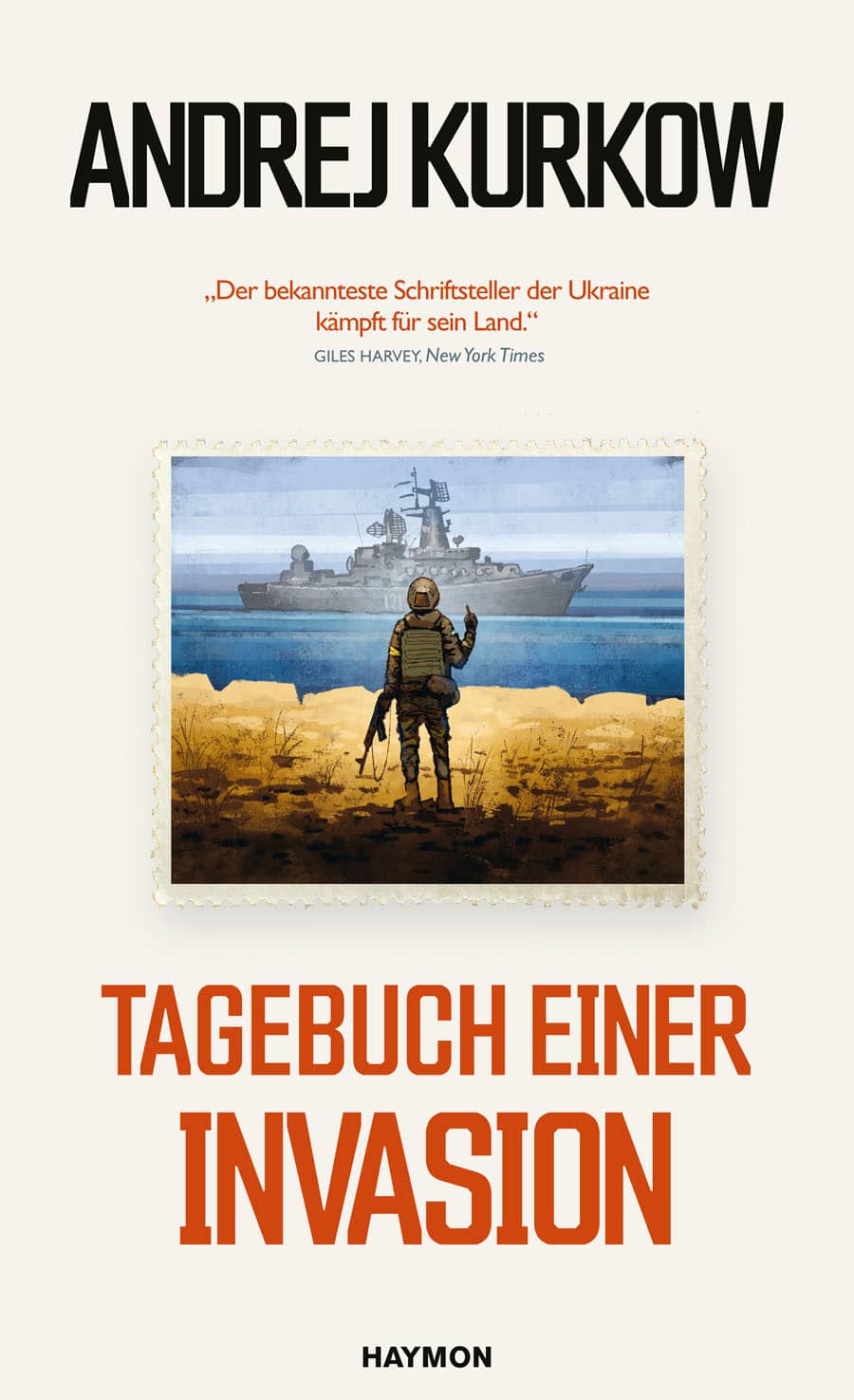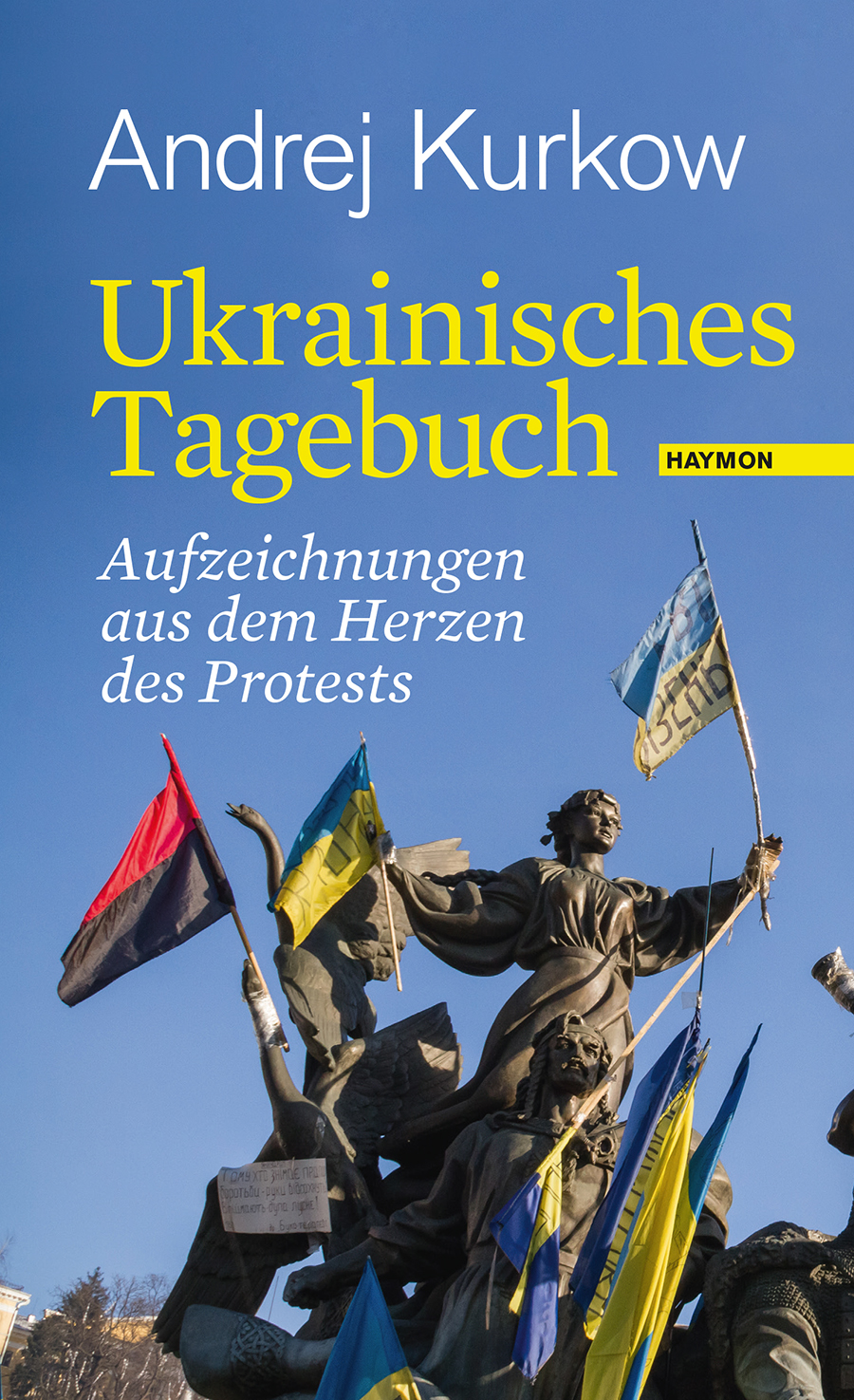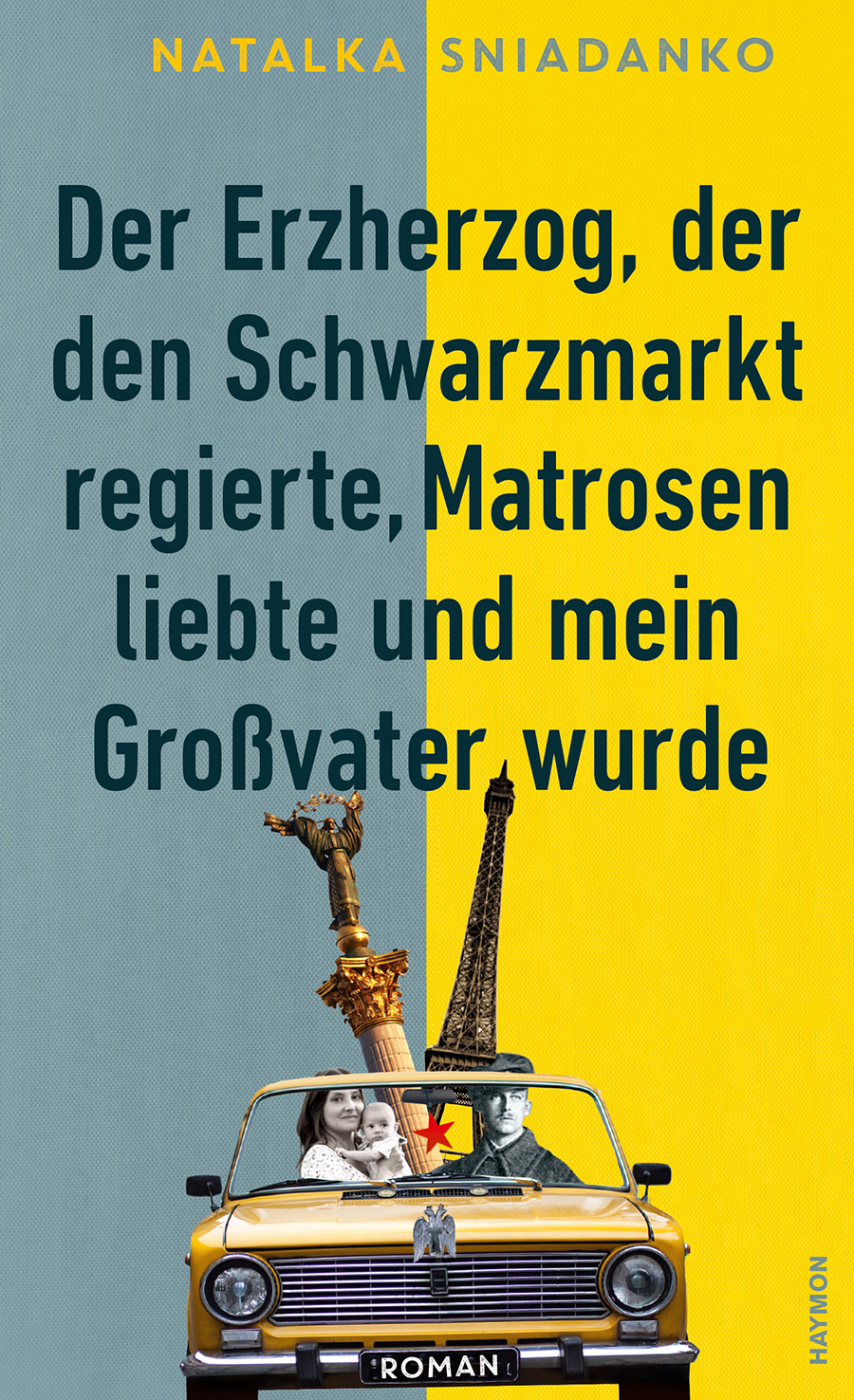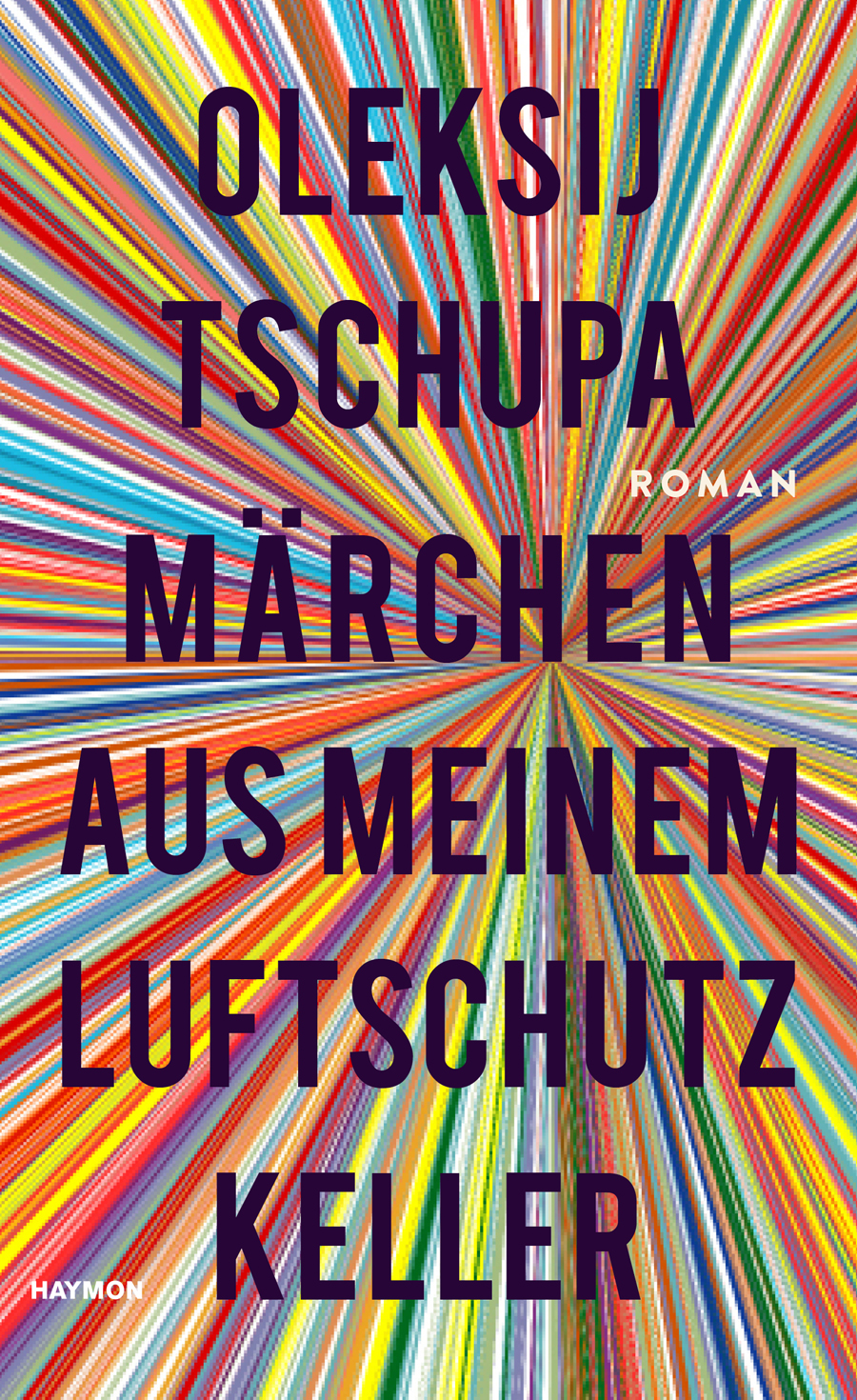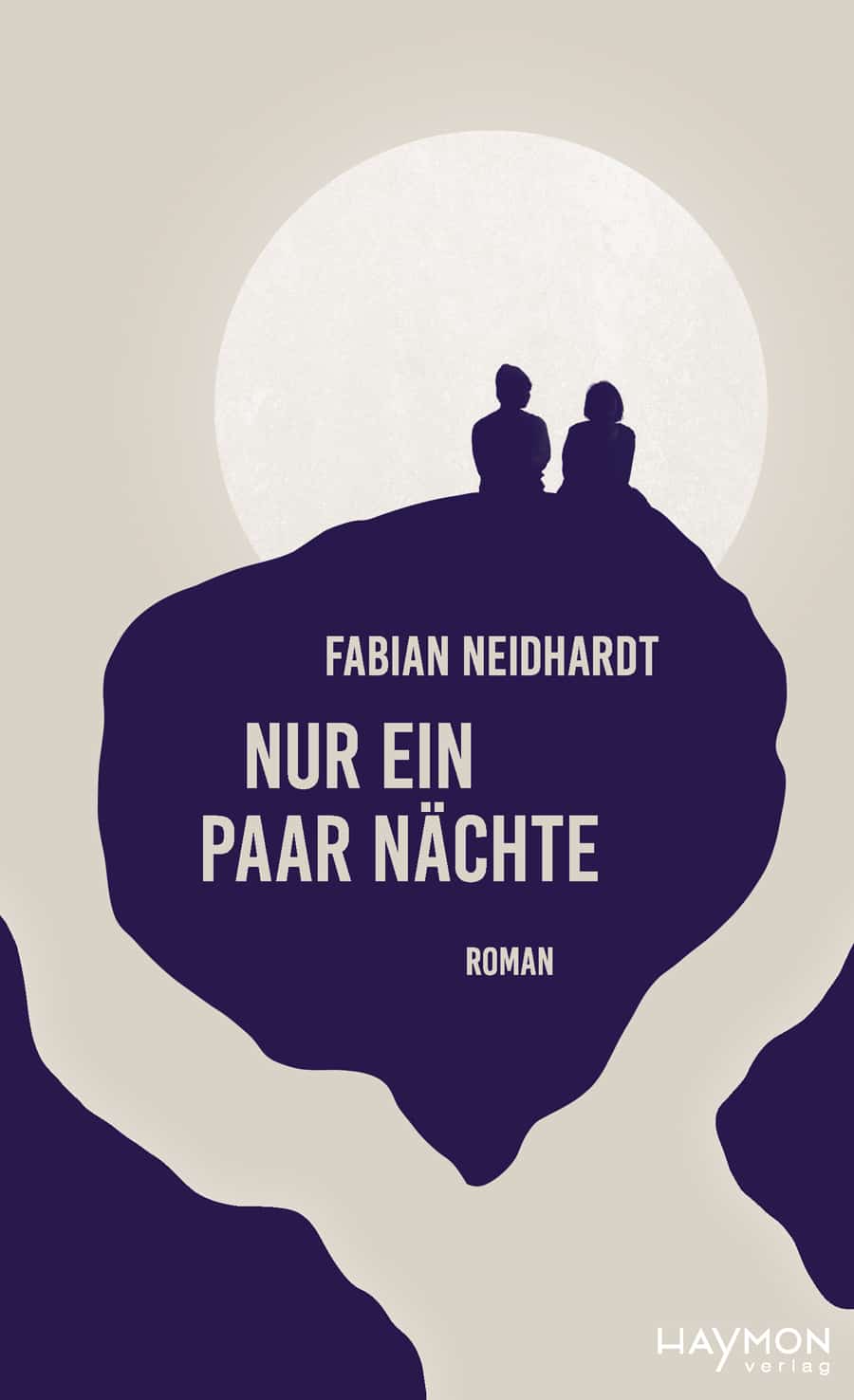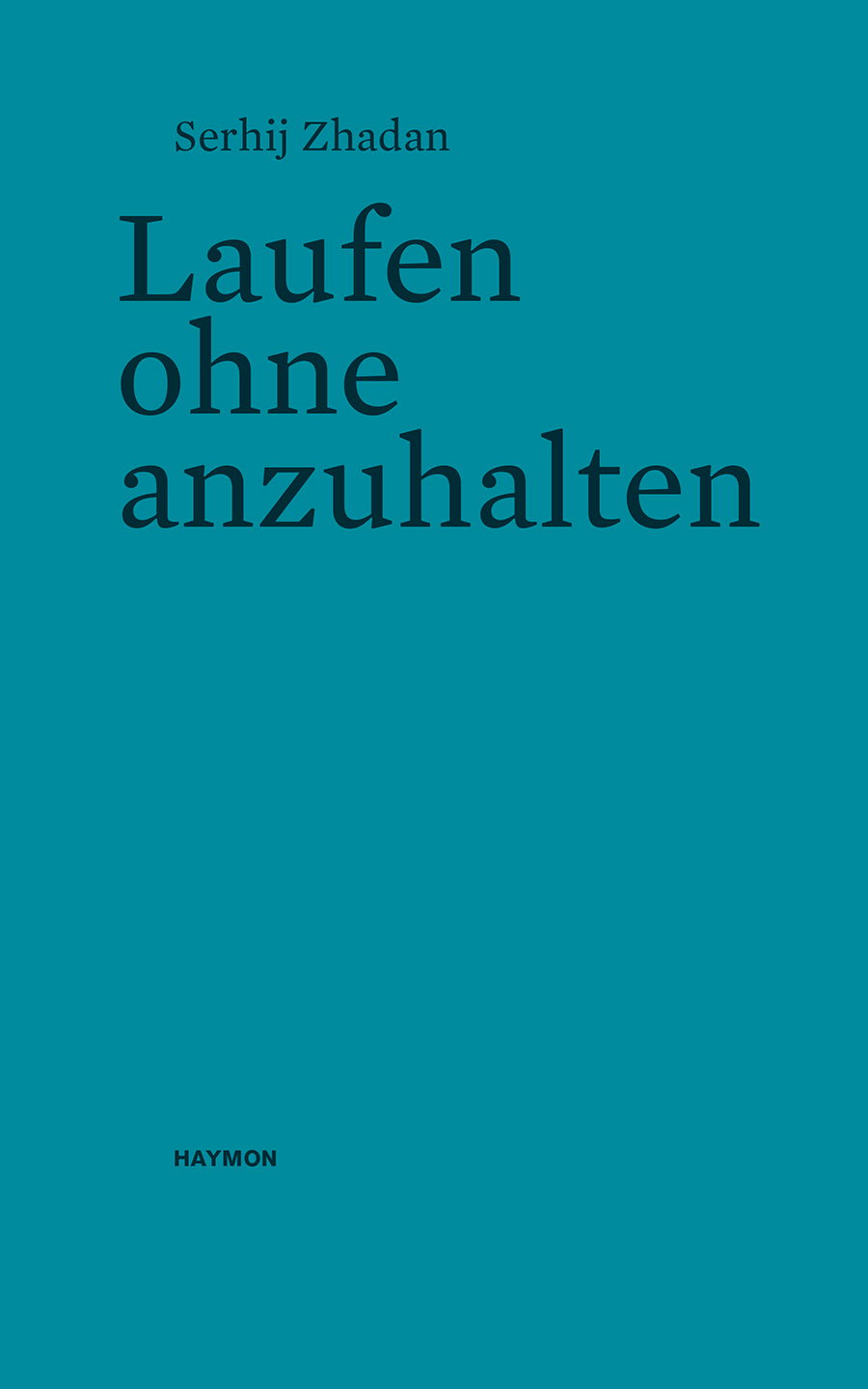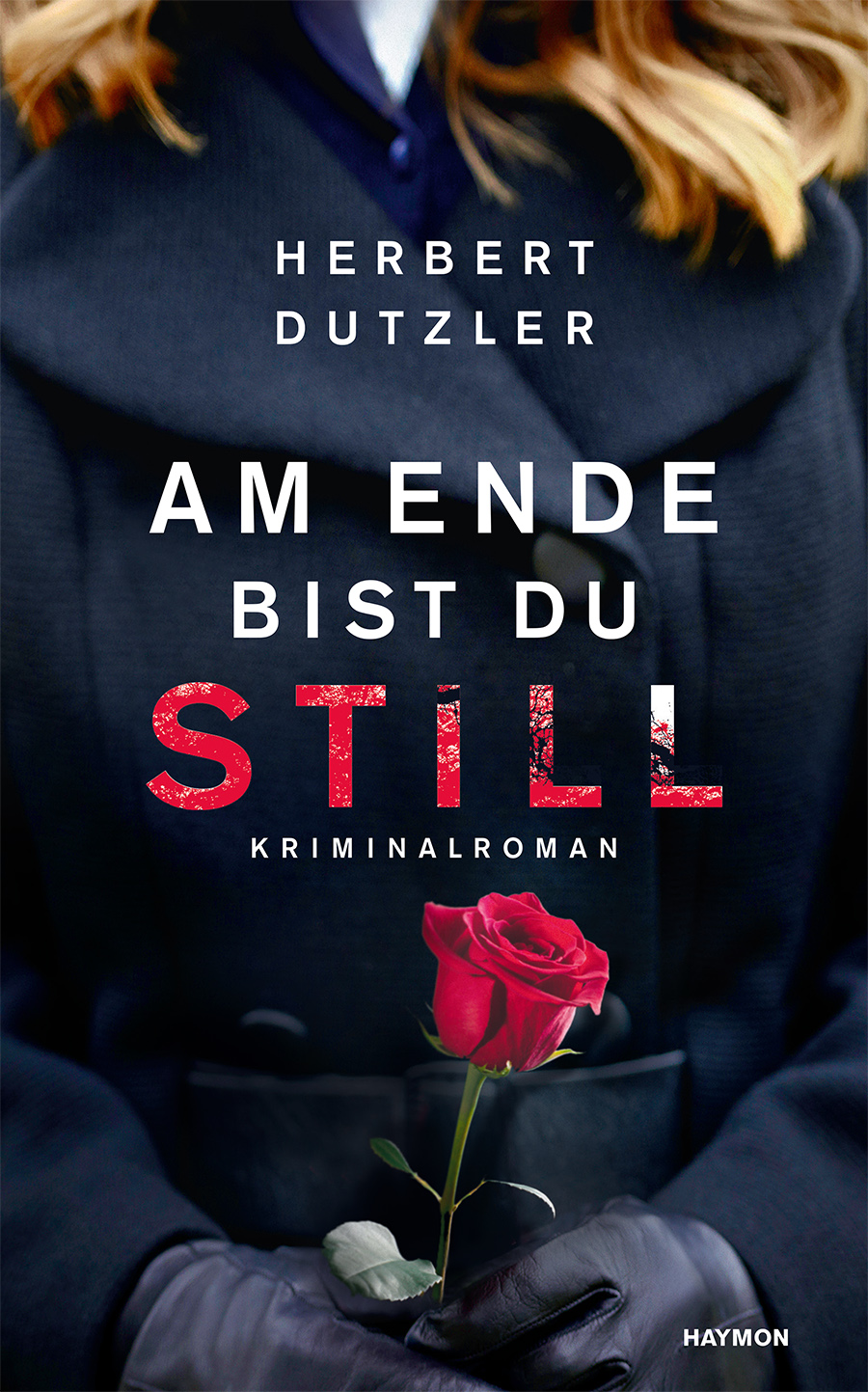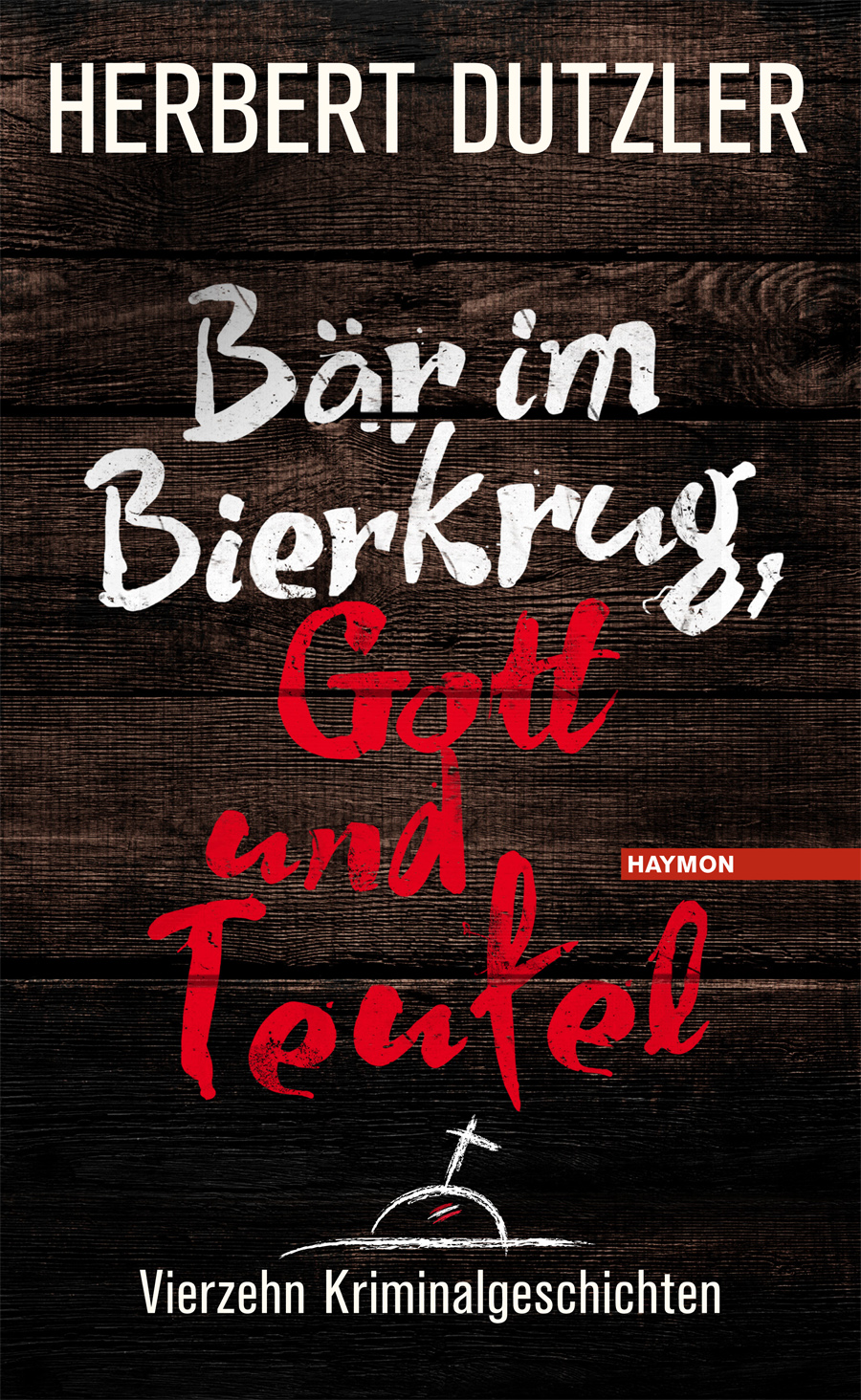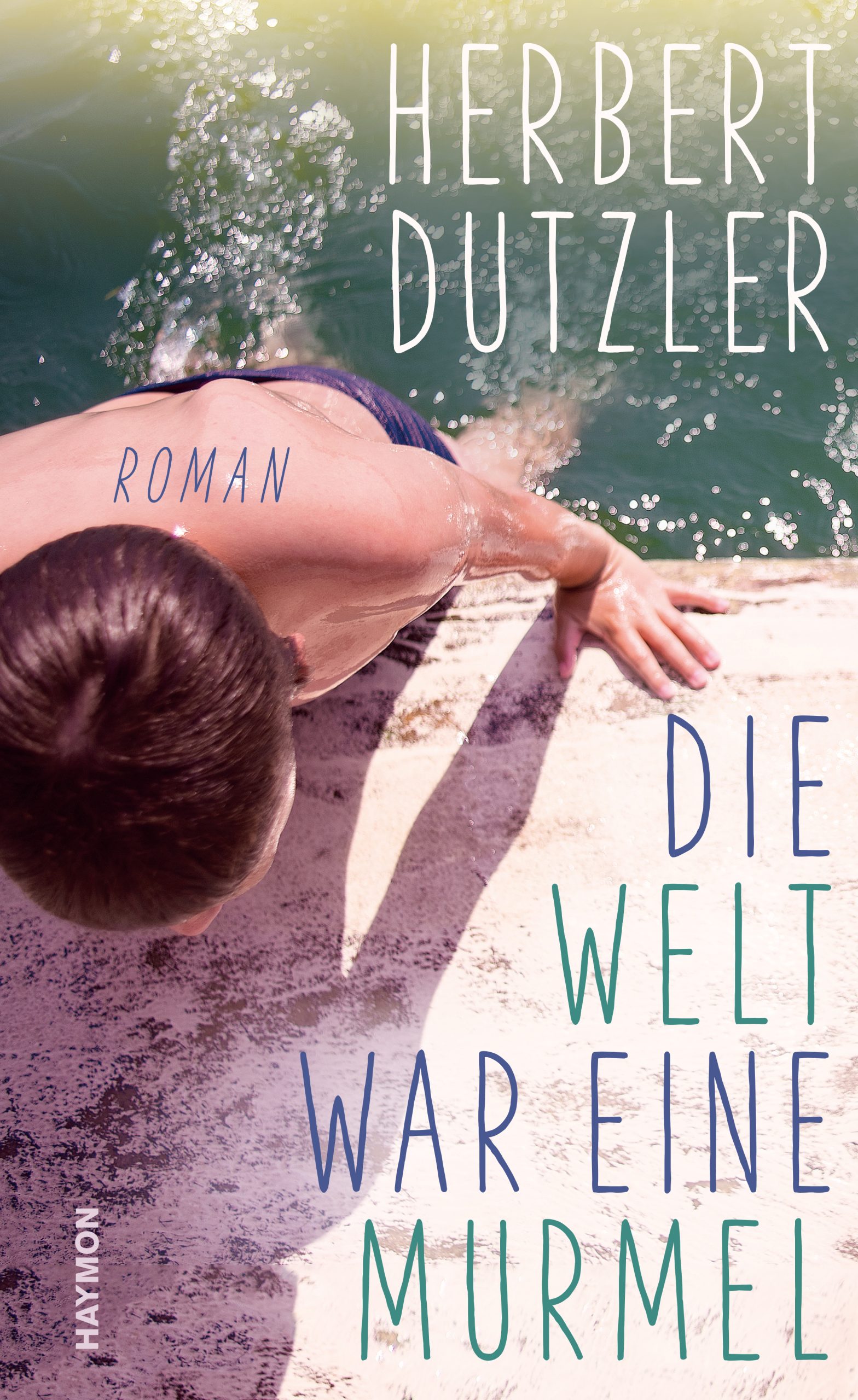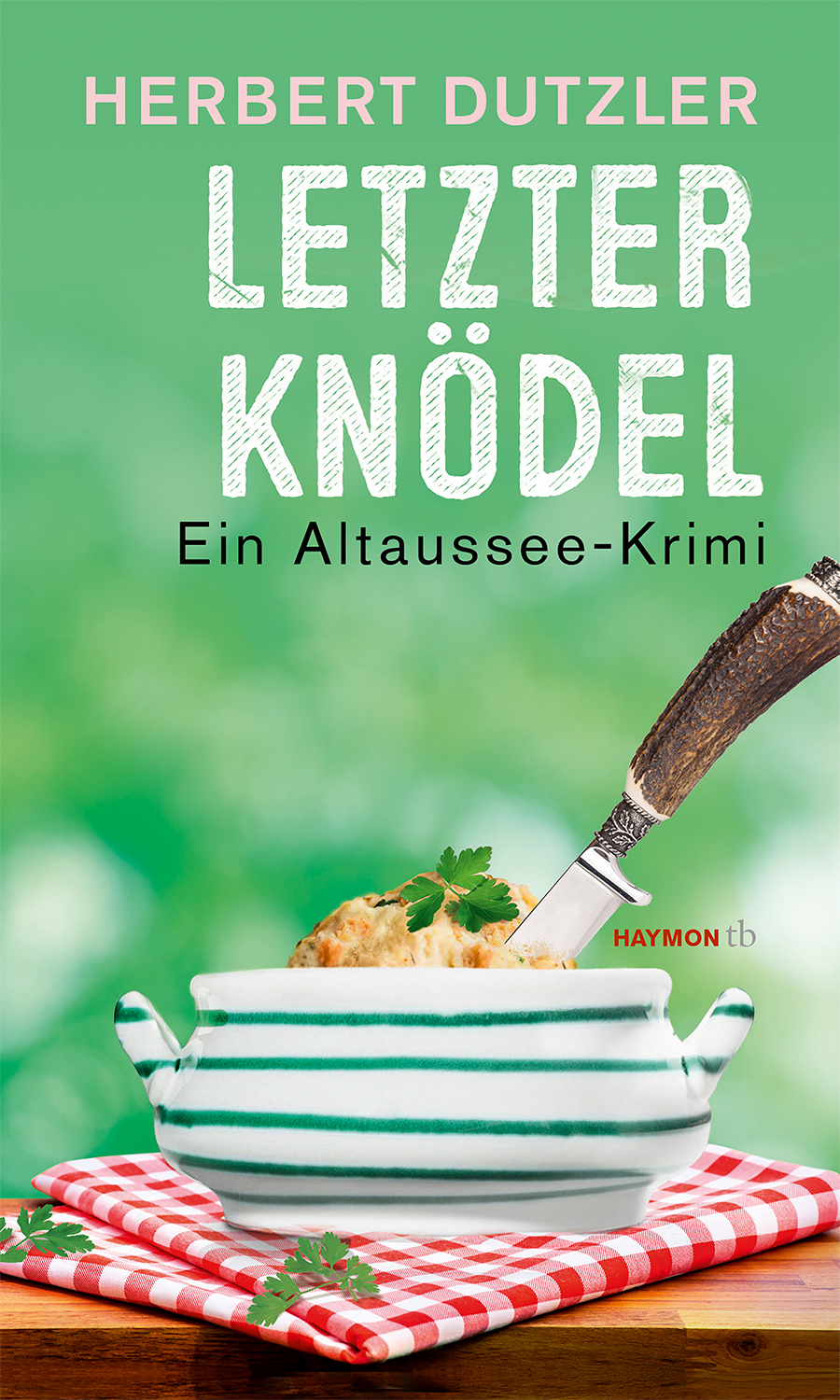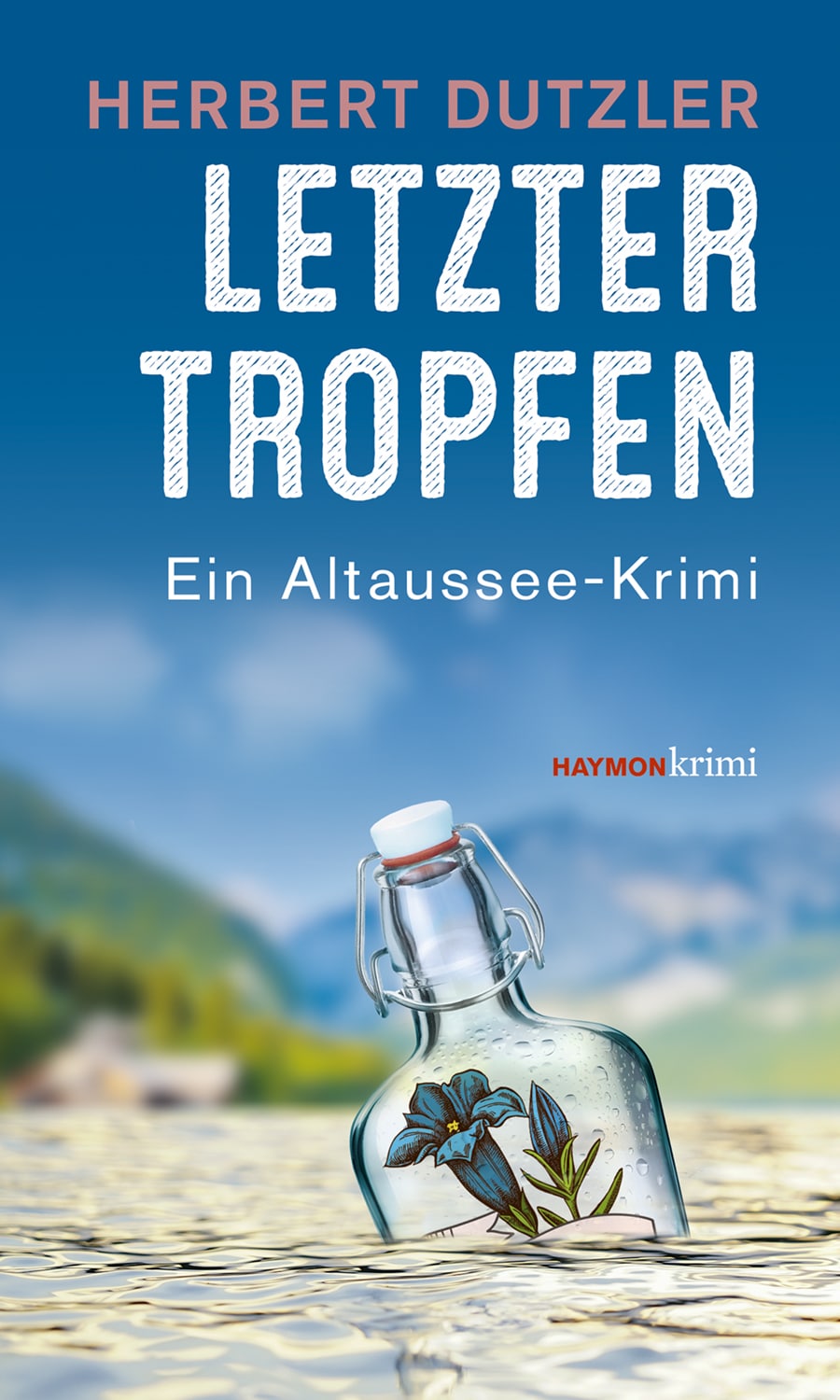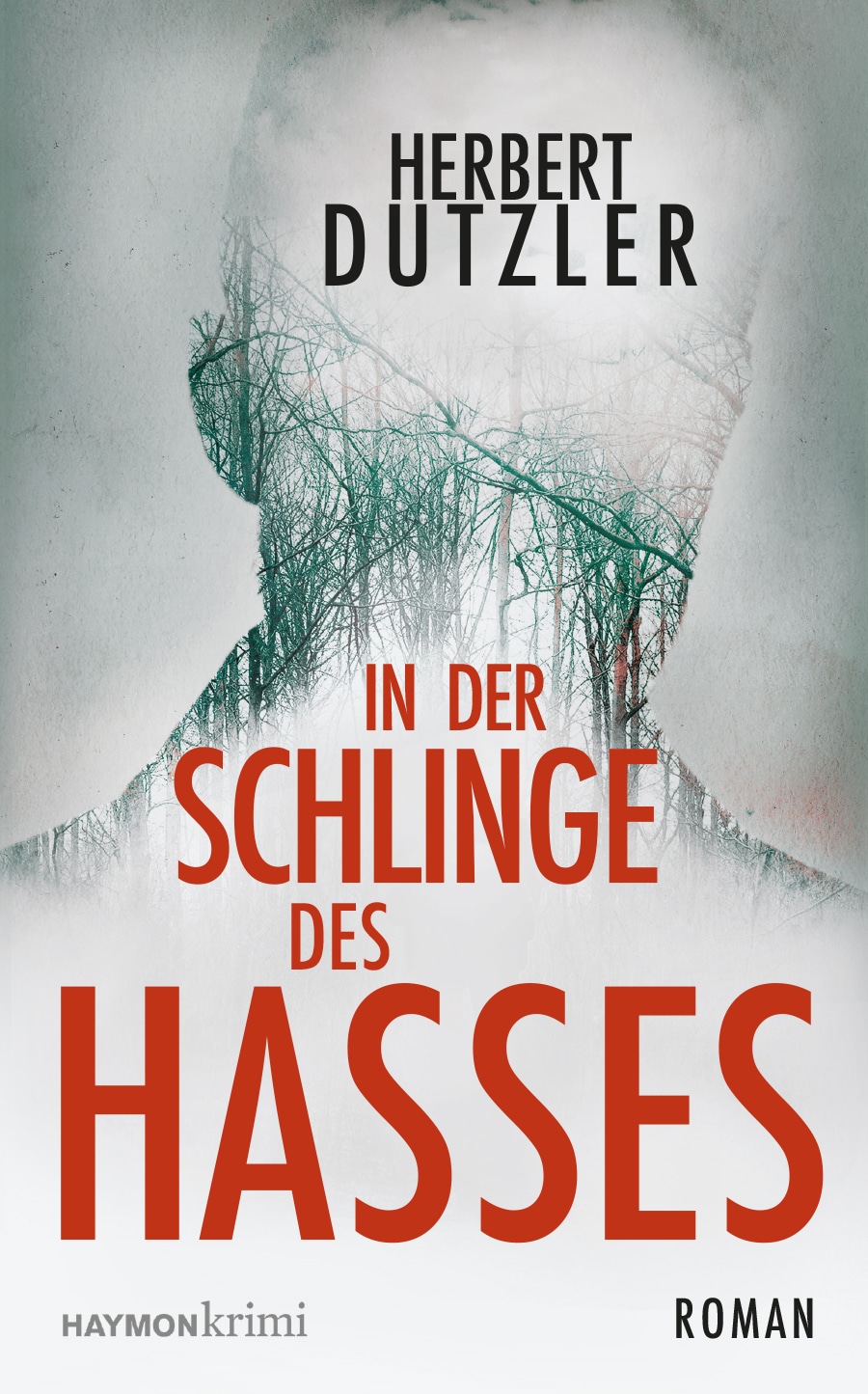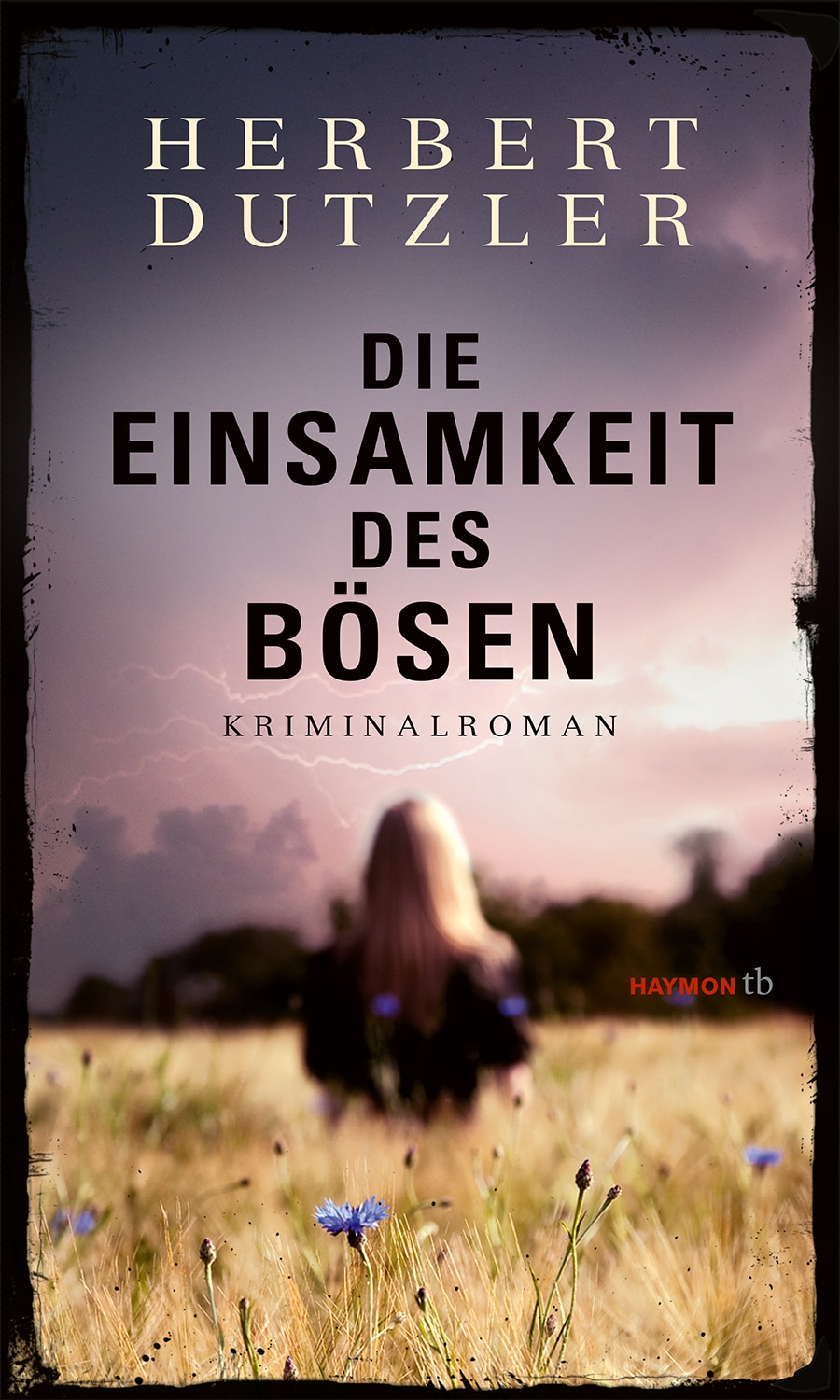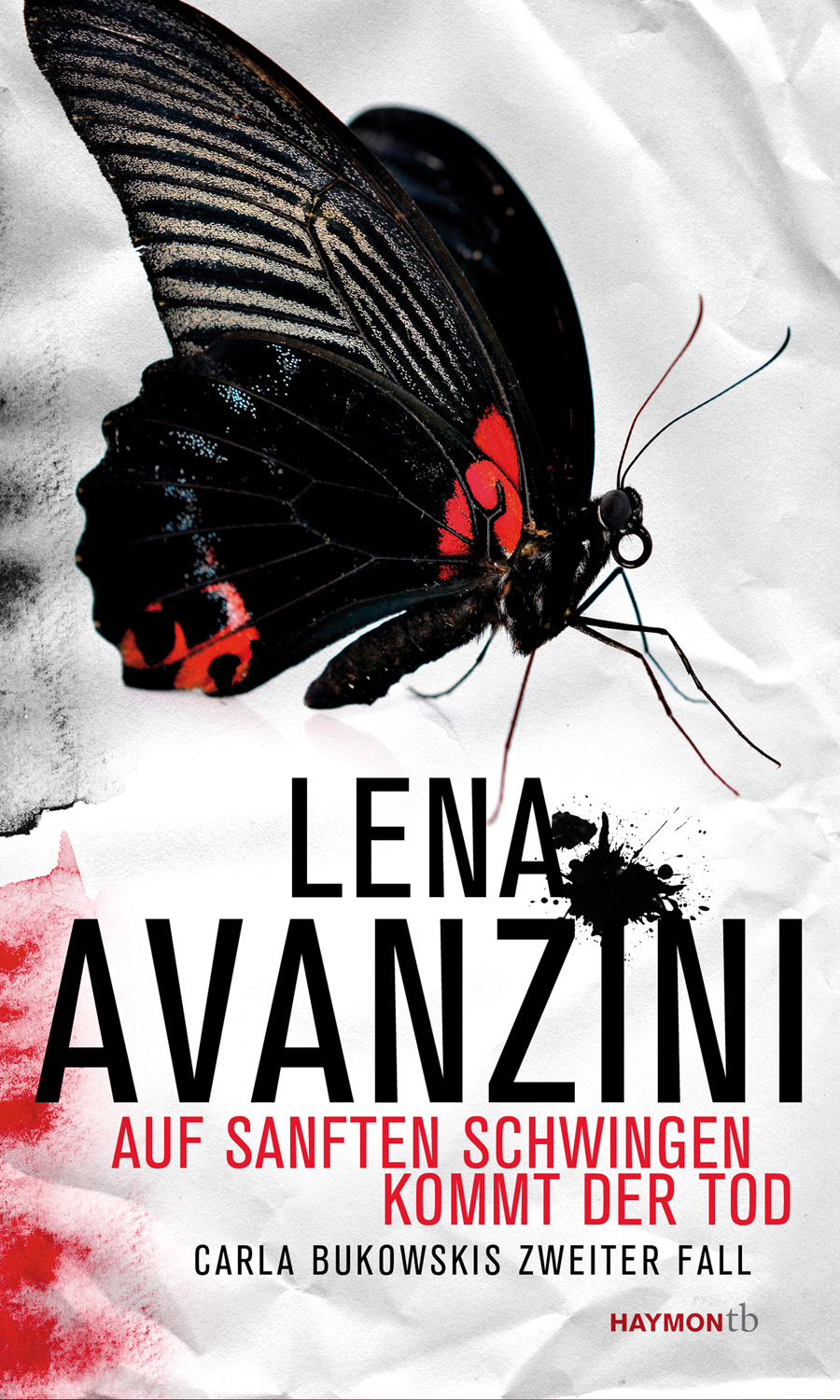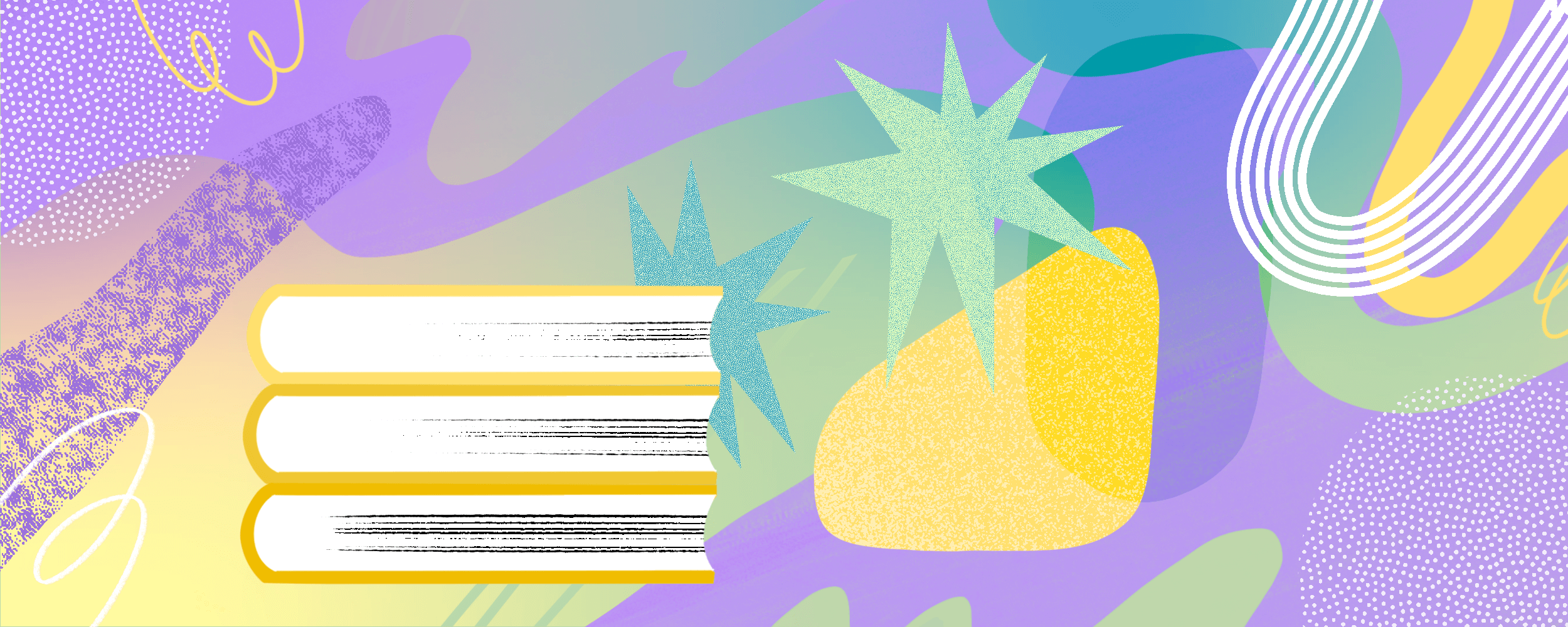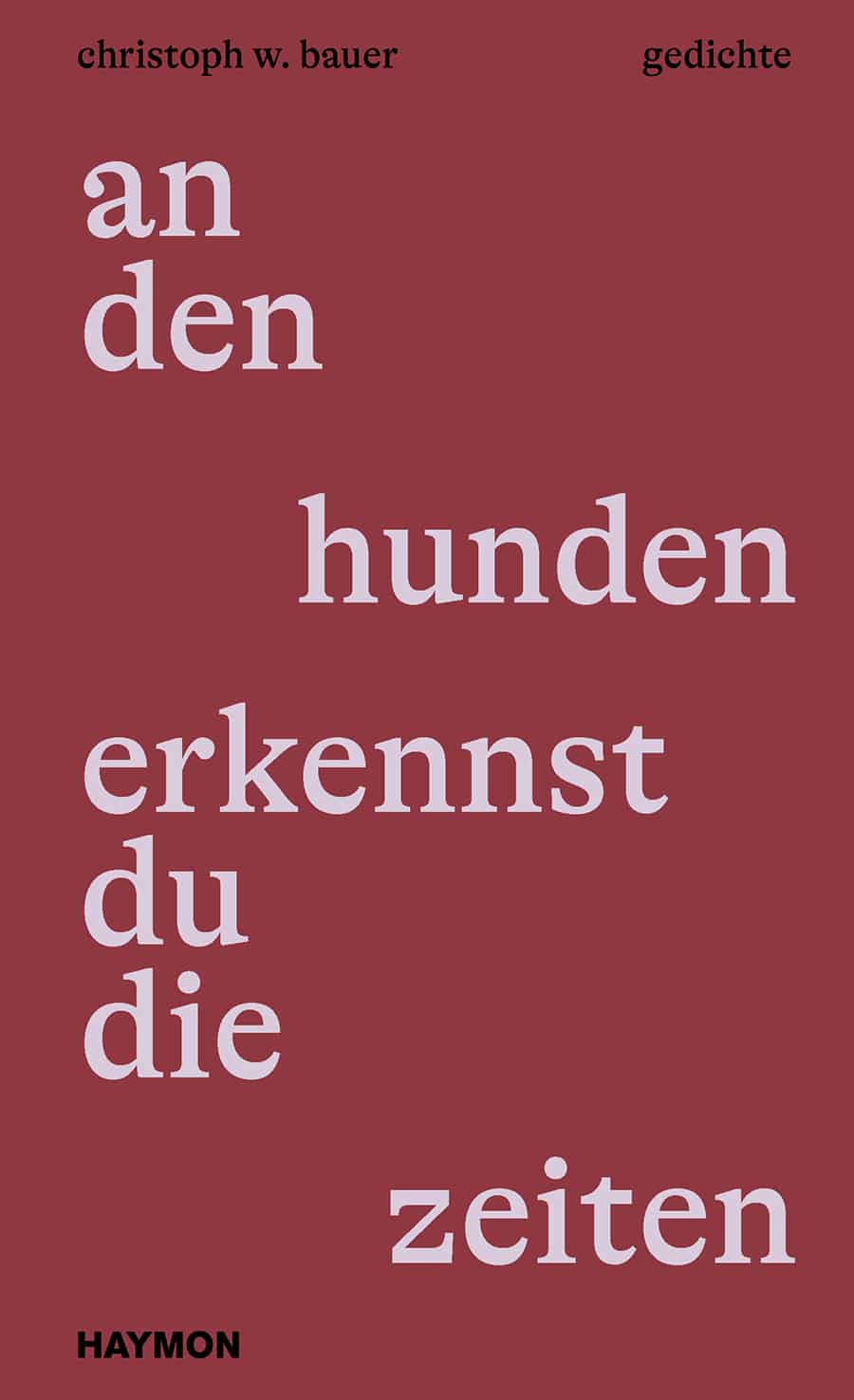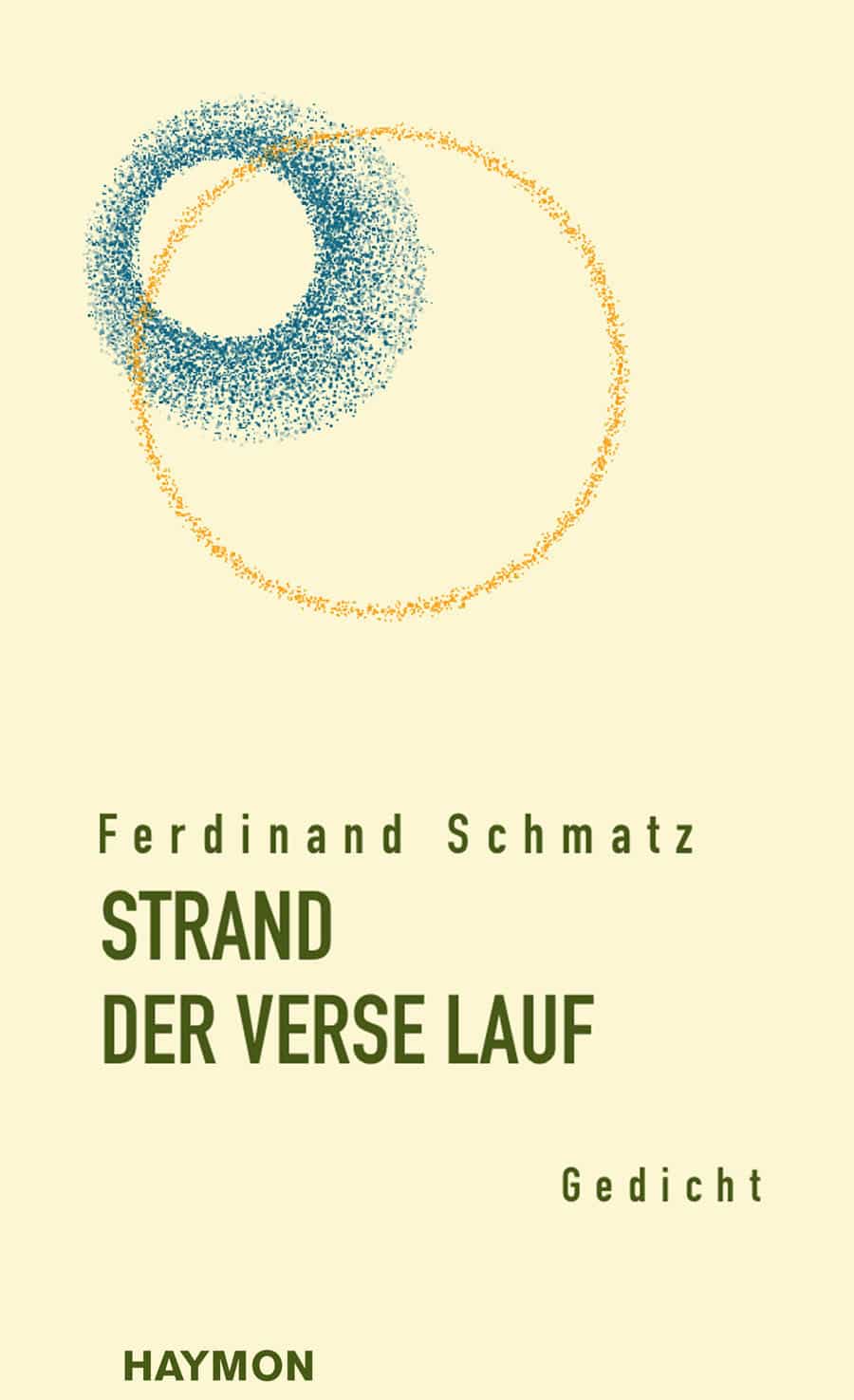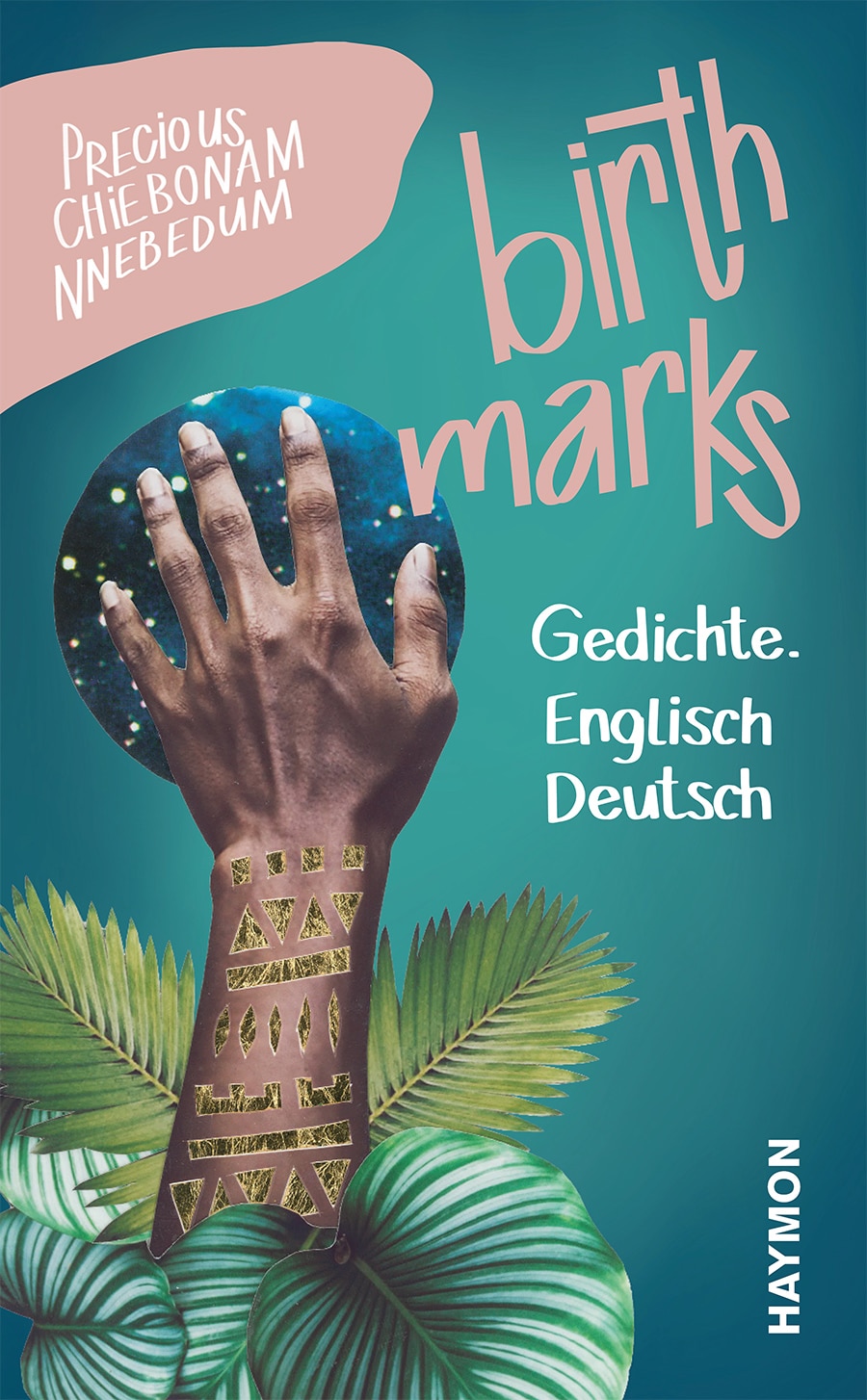„In unserer Gesellschaft gibt es offensichtlich keinen akzeptablen Grund, als Frau ein Kind zurückzulassen.“ – Fabian Neidhardt im Interview über „Nur ein paar Nächte“
Wie kann Familie aussehen? Was kann Familie sein? – Diese Fragen stehen im Zentrum von Fabian Neidhardts neuem Roman „Nur ein paar Nächte“: Ben ist Mitte 30 und hat sich sein Leben mit der 12-jährigen Tochter Mia, die er alleine großzieht, gut eingerichtet. Doch dann wird Bens Leben auf den Kopf gestellt. Sein Vater steht plötzlich vor der Tür und muss ein paar Tage bei ihm unterkommen. Und Mia wird von der Polizei nach Hause gebracht. Sie ist ausgebüxt, um ihre Mutter zu finden … Im Interview spricht Fabian Neidhardt über patriarchale Elternrollen, die Erwartungen, die an Frauen* gestellt werden, das Vater- und Sohnsein und die Komplexität familiärer Beziehungen.
Gleich zu Beginn des Buches tauchen wir mit Ben direkt in das Chaos ein, das plötzlich auf ihn einprasselt. Er wird schlagartig damit konfrontiert, dass er auf einmal als Vater für Mia nicht mehr genug sein könnte. Die Sorge macht sich in ihm breit, die Angst, Mia zu verlieren. Ben und seine Tochter Mia sind die zentralen Figuren in „Nur ein paar Nächte“. Wer sind sie und was macht ihre Beziehung zueinander so besonders?
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ihre Beziehung so besonders ist. Ben will „der beste Vater“ sein und es „besser“ machen als sein eigener Vater, aber scheitert darin natürlich. Und ich glaube, so geht es vielen jungen Eltern. Vielleicht ist besonders, dass es in diesem Fall ein Vater ist statt einer Mutter. Aber ich denke, das Streben und das Gefühl und das Scheitern im Vorhaben ist oft ähnlich.

Fabian Neidhardt schreibt mit links, seit er einen Stift halten kann, und erzählt Geschichten, seit er 12 ist. 1986 wurde er als erstes Kind von vieren in eine polnisch-italienische Familie geboren, studierte u. a. Literarisches Schreiben in Hildesheim und lebt in Stuttgart. Wie schon in seinem Verlagsdebüt „Immer noch wach“ (Haymon Verlag, 2021) erzählt er in seinem zweiten Roman „Nur ein paar Nächte“ von Konflikt und Akzeptanz, von Gefühlen für- und zueinander. Ein rauschender Text über die Beschaffenheit von Beziehungen. – Foto: Daniel Gebhardt
Beziehungen spielen ja generell eine sehr große Rolle in „Nur ein paar Nächte“. Ben und Mia. Mia und ihre Mutter Orna. Orna und Ben. Ben und sein Papa. Wie ist es, über so viele Beziehungsgeflechte auf einmal zu schreiben und gibt es vielleicht ein Duo, über das du am liebsten geschrieben hast?
Für mich waren die Beziehung zwischen Ben und seinem Vater Emil, aber auch die Beziehung zwischen Ben und Mia die Ausgangspunkte für die Geschichte. Weil Ben immer stärker bewusst wird, dass er eigentlich keine richtige Beziehung zu seinem Vater hat, ist in ihm dieser Drang, es mit seinem Kind besser zu machen. Nur, um zu merken, dass das gar nicht so einfach ist. In den ersten Fassungen des Buches waren die anderen Beziehungen auch noch kaum ausgearbeitet. Da waren erstmal Ben und sein Papa und Ben und seine Tochter. Und dann wurde mir – dank meiner Betaleser:innen – immer klarer, dass auch alle anderen Beziehungen dazwischen wichtig sind. Und so sind sie mit jeder Runde stärker geworden. Dieses organische Wachsen hat mich einigermaßen den Überblick bewahren lassen. Aber auch nicht durchweg, es gab tatsächlich Momente, da habe ich das Buch vor lauter einzelner Szenen und Beziehungen nicht mehr überblicken können. Das sind dann die Momente des größten Zweifelns. Kann ich das? Ist dieses Themengeflecht nicht viel zu wirr für mich? Ich musste dann selbst erstmal Abstand zum Buch bekommen, um es wieder als Ganzes zu erfassen. Und auch ganz am Ende, nach all den Beziehungen, war klar, am liebsten habe ich Ben und Mia geschrieben. Mia zu schreiben war sowieso das Beste. Für mich ist sie eine Schwester im Geiste von Kasper aus „Immer noch wach“, meinem Verlagsdebüt bei Haymon. Kasper durfte machen und sagen, was er wollte. Jetzt ist es Mia. Solche Figuren sind immer spannend und machen Spaß. Und die Beziehung, die mir wirklich nahe, ist die zwischen Ben und Emil. Diese Vater-Sohn-Beziehung war der Auslöser für das ganze Buch und das habe ich auch beim Schreiben durchweg bemerkt.
„In großer Wärme erzählt Fabian Neidhardt von den Ecken und Kanten seiner Protagonist:innen, von dem Monstrum und Glück, das sich Familie nennt.“ – So hat sich Autorin Marie Gamillscheg über deinen neuen Roman geäußert. Familie kann eben vieles sein: Im Fall von Ben bedeutet sie Schutz, aber auch eine gewisse Belastung. Während Orna keine Mutter sein und auch keine eigene Familie haben will, möchte Ben der beste Vater für Mia sein. Gleichzeitig wird die Beziehungskrise seiner Eltern bei ihm zu Hause ausgetragen und Ben durch die Anwesenheit seines Papas fast wieder zum Kindsein gedrängt. Was war für dich persönlich das Spannendste an der Dynamik zwischen Ben und seinem Vater?
Ich bin nicht Ben und mein Vater ist nicht Emil, aber ein Großteil der Dynamik zwischen Ben und seinem Vater ist natürlich von meiner Dynamik mit meinem Vater übernommen. Mein Vater liest meine Bücher immer in Rohfassungen und dieses Mal war ich ziemlich aufgeregt und gespannt, wie er reagieren würde. Er hat großartig reagiert und sehr schön zwischen uns und diesem Vater-Sohn-Paar im Buch unterscheiden können. Und trotzdem glaube ich, dass mein Schreiben über diese Dynamik auch unserer Dynamik gut getan hat. Und ganz vielleicht hilft das auch anderen in ihrer Beziehung zu ihren Eltern.
Orna möchte keine Kinder bekommen, Ben möchte, kann aber nicht. Glaubt er zumindest. Wir kennen dieses Thema eher in umgekehrter Form. Was war für dich am Tausch dieser klassischen Rollenbilder so interessant?
Unter uns: Zuallererst war das „Zufall“. Ich hatte das nicht geplant. Ich wollte einen Mann zwischen seinen Vater und sein Kind stellen und ihn daran scheitern lassen. In den frühen Versionen gab es Orna im ersten Teil des Buches quasi nicht. Aber wenn ich die Geschichte so erzählt habe – mit einer Mutter, über die nichts bekannt ist, die aber offensichtlich noch lebt – dann war für fast alle Menschen, denen ich das erzählt habe, klar, dass das eine Rabenmutter sein muss. Weil es in unserer Gesellschaft offensichtlich keinen akzeptablen Grund gibt, als Frau Kinder zurückzulassen. Aus dieser Erkenntnis ist dann dieses umgedrehte Rollenbild entstanden. Und je länger ich darüber erzählt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie krass Menschen darauf reagieren und wie viele sagen, „so geht es mir auch“. Das hat mir gezeigt, dass ein Rollenbild zwar klassisch sein kann, weil wir es oft wiederholen und lesen und sehen. Das heißt aber nicht, dass es der Gefühlswelt aller entspricht, sondern ganz viele genauso normale Rollenbilder verblassen lässt, einfach dadurch, dass wir nicht darüber reden. Und das allein war Grund genug, es diesmal so zu erzählen.
Ornas Wunsch, keine Mutter zu sein, ist nachvollziehbar. Dem gegenüber: Mia. Ein junges Mädchen, das seine Mama kennenlernen möchte. Ebenso verständlich. Wie war es für dich, in diese so lebensnahe wie komplizierte Situation einzutauchen und darüber zu schreiben?
Vielleicht ist erstmal das Wichtige, dass es keine allgemeingültige Wahrheit und keine einfache Antwort gibt. Ich selbst finde Geschichten dann spannend, wenn ich die Motivation aller Figuren verstehen kann, wenn niemand plump „gut“ oder „böse“ ist. Und wenn genau diese Blickpunkte aber zum Problem führen. So habe ich Mia und Orna geschrieben: immer mit der Idee, dass ich sie jeweils total nachvollziehen kann. Und mit dem glücklichen Wissen, dass ich gar keine Antwort auf dieses Dilemma geben muss. Das muss jede:r für sich ausmachen. Aber ich kann versuchen, allen Seiten gleich viel Aufmerksamkeit, Empathie und Zeit zu geben. So habe ich das auch mit diesen beiden gemacht.
Noch immer ist es kein Tabu, weiblich gelesene Personen nach ihrem Kinderwunsch zu fragen. Impliziert wird dabei immer erwartet, dass es diesen grundsätzlich geben muss. Wie ist es für dich gewesen, über das Mutter- bzw. Nicht-Mutter-werden-Wollen einer Frau zu schreiben?
Das war wohl der schwerste, aber irgendwie auch der schönste Teil beim Schreiben. Weil ich eine Weile, bevor all diese Gedanken überhaupt zu einem Buch wurden, erstmal selbst verstehen musste, wie groß dieses Thema „(Nicht)Mutterschaft“ eigentlich ist.
Ich bin als erstes von vier Kindern groß geworden, in einem Dorf, in dem all meine Freund:innen Geschwister und Vater und Mutter hatten. Ich wollte das genauso haben: Familie, vier Kinder, am besten schon mit 23 Vater sein. Alle happy und so und alles easy. Nur, dass ich dann mit 23 überhaupt nicht an dem Punkt war, Vater sein zu wollen. Und ganz langsam verstanden habe, dass ich zwar eine glückliche Kindheit, aber auch Eltern habe, die genauso nur Menschen mit Ängsten, Sorgen, Streiten und Nöten sind. Und als dann die ersten Kinder meiner Bekannten und Freund:innen auf die Welt kamen, ich zum ersten Mal von einer Abtreibung erzählt bekommen habe, von Fehlgeburten und Kinderwunschzentren, wurde mir mit etwa Mitte 30 klar, dass es das zwar gibt, dieses vier Kinder und alle happy und alles easy. Aber es gibt daneben auch ganz viel anderes, über das wir aber nicht so oft und offen reden. Also habe ich irgendwann auf Instagram gefragt: „Liebe Frauen*, will jemand von euch keine Kinder? Und falls ja, warum nicht?“ Und darauf habe ich überraschend viel und offen Antwort bekommen. So habe ich es dann mit jedem Aspekt in diesem Roman gehalten. Ich habe mit sehr vielen Menschen geredet. Über das Mutter sein und das nicht Mutter sein wollen. Über Schwangerschaften und Geburten und all die Scheiße, die passieren kann, über die wir aber nicht so oft reden. Das hat mir auf der einen Seite extrem tolle und intime Gespräche beschert. Und auf der anderen Seite gezeigt, dass das ein wirklich großes und hochsensibles Thema ist, bei dem ich keine Fehler machen möchte und niemanden verletzen will. Deshalb sind diese Aspekte und Szenen im Buch nicht erfunden. Hier wollte ich nicht auf meine enge und männliche, vielleicht sogar romantisierte Fantasie zurückgreifen, sondern schreiben, was mir andere Menschen aus ihrer Erfahrung anvertraut haben. Besonders diese Teile sind Mosaike, die ich zusammensetzen durfte. Und tatsächlich habe ich auch besonders Angst davor, was Leser:innen zu diesen Teilen sagen werden. Gerade weil das Themen sind, die ich ja gar nicht selbst erlebt habe oder gar erleben könnte.
Ben ist leidenschaftlicher Holzschnitzer. Für „Nur ein paar Nächte“ hast du extra einen Schnitzkurz absolviert. Warum gerade schnitzen? Ist nicht gerade das eine Tätigkeit, die eher wieder der klassischen Männerrolle entspricht?
(lacht) Witzig, dass du das so siehst. Weil ich meinen Workshop bei einer großartigen Frau absolviert habe, Paulina von Gemeines Holz. Mir war es für Ben wichtig, dass er nicht einfach nur am Rechner sitzt. Ich wollte ihn was mit seinen Händen machen lassen. Und dann immer noch lieber Holzlöffel schnitzen als an alten Autos schrauben, oder?
„Nur ein paar Nächte“ behandelt viele ernste Themen, gleichzeitig ist es aber auch ein Buch voller Liebe, Herzenswärme und mit viel Witz. Welche Szene hast du besonders gern geschrieben?
Puh. Schwer. Da gibt’s einige schöne Szenen, die Spaß gemacht haben. Aber ich glaube, wenn Mia dabei ist, ist es noch ein bisschen witziger gewesen, sie zu schreiben. Ich hoffe, ihr habt an Mia und dem ganzen Buch genauso Spaß wie ich.
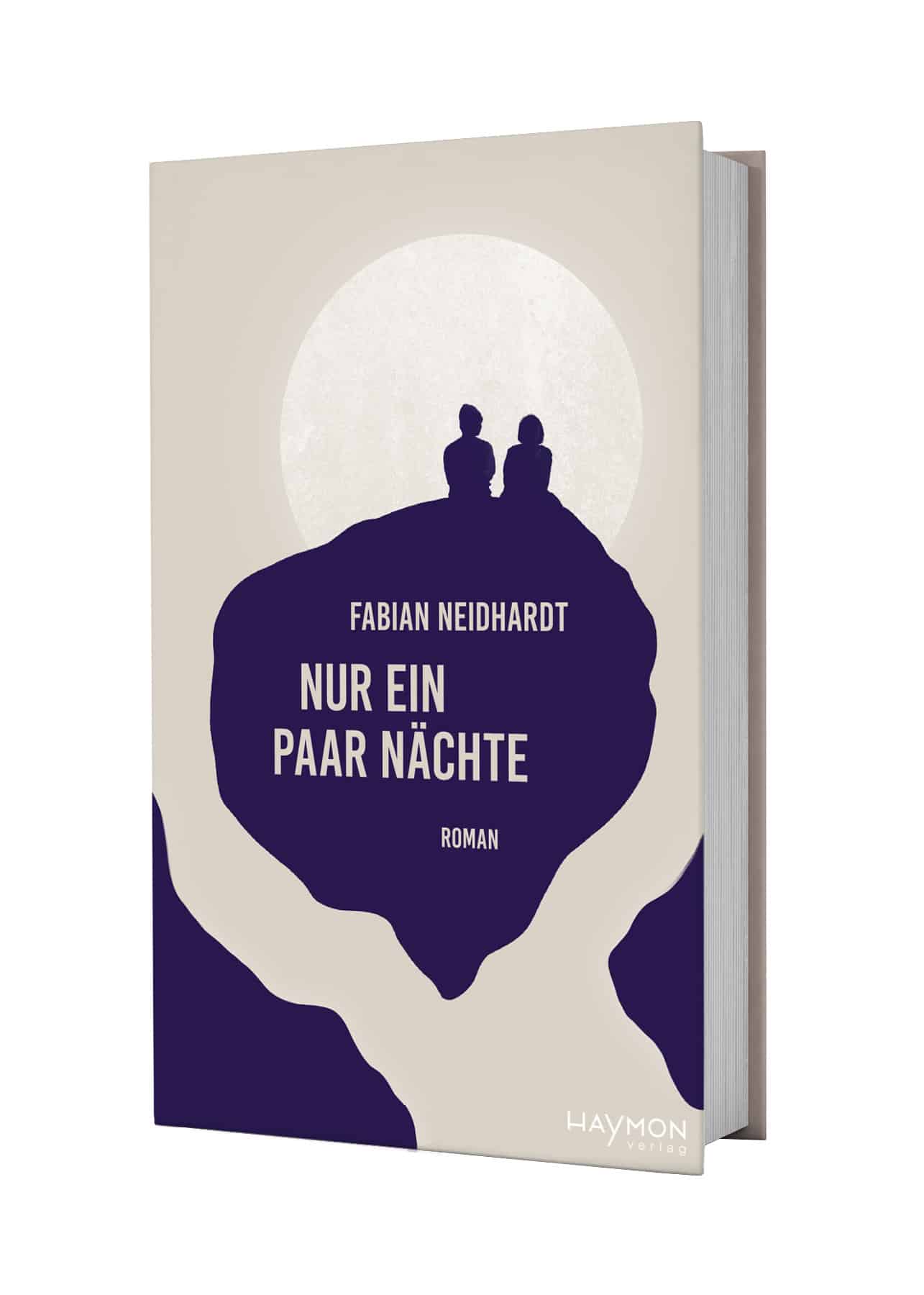
Von einem alleinerziehenden Vater und einer Tochter, die sich kaum bändigen lässt, von Nähe und Loslassen, von Entscheidungen, die das Leben verlangt. Ben, seinem Vater, Mia und Orna bleibt ein Wochenende, um Generationen an Unausgesprochenem zu artikulieren, um Fehler zu akzeptieren, neue zu machen und sich zu entschuldigen. Sich einzugestehen, dass es kein Versagen auf ganzer Linie ist, zuerst das verletzte Kind in sich selbst heilen zu müssen, um sich besser um das eigene kümmern zu können. Bist du neugierig geworden? Hier kommst du zu „Nur ein paar Nächte“!